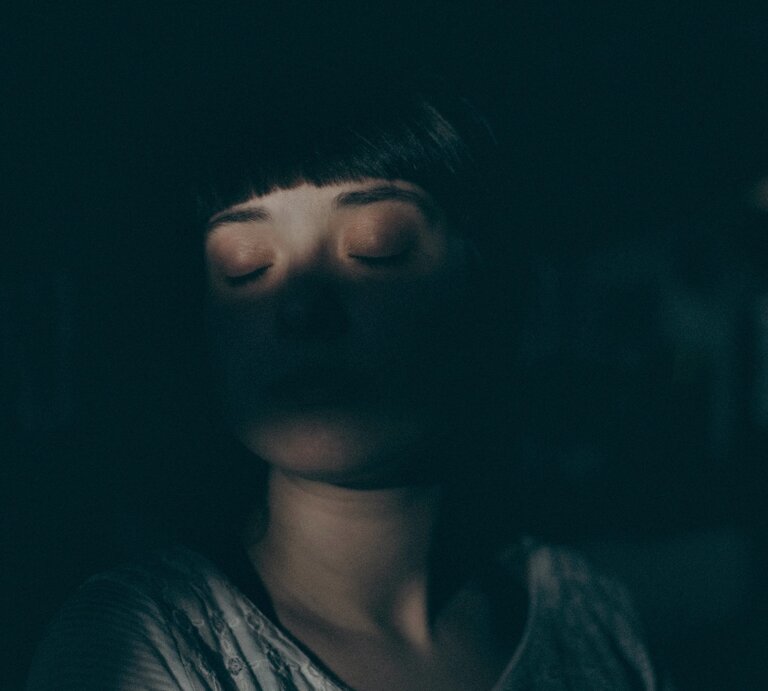Rieke Havertz: „Europa muss aus Amerikas Fehlern lernen“
Im Interview erklärt ZEIT-Korrespondentin Rieke Havertz, warum die Lebensumstände in den USA für queere Menschen, Frauen und Migrant*innen immer bedrohlicher werden, welche Warnsignale Europa daraus ziehen muss – und weshalb sie Amerika dennoch nicht abschreibt.
Die USA erleben einen tiefen politischen und gesellschaftlichen Wandel, der besonders queere Menschen, Frauen und Migrant*innen trifft. Rechte Bewegungen gewinnen an Einfluss, reproduktive Rechte werden eingeschränkt, Identitäten zur Zielscheibe – und eine Sprache der Entmenschlichung prägt zunehmend die öffentliche Debatte. Die Journalistin Rieke Havertz beobachtet diese Entwicklungen seit mehr als zwanzig Jahren: zuerst als Studentin, später als US-Korrespondentin und Autorin, heute als eine der wichtigsten Stimmen für das Verständnis amerikanischer Politik im deutschsprachigen Raum.
In ihrem Buch „Goodbye, Amerika?“ beschreibt sie ein Land, das sie liebt – und das ihr gleichzeitig fremd geworden ist. Im Gespräch mit EDITION F erzählt Havertz, warum die aktuelle Lage für marginalisierte Gruppen existenziell bedrohlich ist, welche Dynamiken aus den USA auch Europa erreichen könnten und was sie trotz allem hoffen lässt.
Dein Buch beginnt mit dem Satz: „In Athens, Ohio, habe ich gelernt, Amerika zu verstehen. Und begonnen, ein Amerika zu lieben, das ich doch nie ganz verstehen werde“. Was liebst du ganz besonders an Amerika und was wirst du nie ganz verstehen?
„Amerika ist nicht Donald Trump, deswegen bleibe ich bei dieser Aussage. Die Offenheit, die Amerika auszeichnet und die vielen Teile der amerikanischen Gesellschaft prägt, die Lässigkeit und das Weitläufige dieses Landes – das liebe ich. Was mich dagegen nicht besonders begeistert, ist die Arroganz, die man dort manchmal wahrnimmt, und die Unnachgiebigkeit sowie die Ungerechtigkeit, die man innerhalb der USA zwischen den Menschen erlebt. Gerade wenn man über Armut nachdenkt, in einem der reichsten Länder der Welt. Das sind Dinge, die werde ich nie ganz verstehen.“
Die USA galten lange als „Versprechen“: Jede*r könne dort etwas „werden“. Welche Gruppen – Frauen, Schwarze Menschen, Migrant*innen, Queers – hast du in den vergangenen Jahren und in Vorbereitung auf das Schreiben deines Buches getroffen, für die dieses Versprechen besonders stark bröckelt?
„Das Freiheits-Versprechen, das Donald Trump seinen Wähler*innen im Wahlkampf gemacht hat, bedeutet vor allem eines: Freiheit, die oft nur existiert, wenn man die Freiheit anderer einschränkt. Mein Gefühl – auch im Rückblick darauf, wie ich Amerika vor über 20 Jahren erlebt habe, als ich dort studiert habe, und wenn ich heute durch das Land reise – ist, dass diese Präsidentschaft, diese MAGA-Bewegung, versucht, Räume für Menschen enger zu machen. Und genau das bedroht, was ich gerade beschrieben habe und was ich so wahnsinnig toll an den USA finde: diese Offenheit.
Bedroht wird sie vor allem für Menschen, die nicht in das Schema und die Ideologie der MAGA-Bewegung passen, die dominierend weiß und klar heteronormativ geprägt ist. Diese Ideologie stellt, kurz gefasst, die Familie mit einem starken Mann und der Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt, ins Zentrum. Frauen können sich darin wiederfinden, weil ihnen die wichtige Rolle als Mutter und moralische Beschützerin der Familie zugeschrieben wird. Ausführlich ist das im ‚Project 2025’ beschrieben, das Grundlage dieser Präsidentschaft ist. Auch wenn Donald Trump im Wahlkampf versucht hat, sich dagegenzustellen. Jetzt aber sind viele der Project 2025-Autoren – durchweg männliche Autoren – sehr nah an seiner Administration.
Das heißt: Für alle, die sich diesem Rollenbild nicht unterordnen wollen, oder für queere Personen, die, wenn sie es wollen, nicht mehr die Möglichkeit haben, etwa in Reisepässen ein drittes Geschlecht anzugeben – für all diese Menschen wird der Raum enger. Ich glaube aber auch, dass für viele vermeintliche Trump-Zielgruppen die Räume enger werden, vor allem für diejenigen ohne viel Geld, weil die Ungerechtigkeit im Land auch unter einem Trump immer größer wird.“
Hast du einen Moment erlebt, in dem dir klar wurde: Hier geht es nicht mehr nur um Politik, sondern um gezielte Entmenschlichung?
„Auf Wahlkampfveranstaltungen oder konservativen Treffen gab es Momente, die mir das gezeigt haben. Der republikanische Senator Ted Cruz sagt zum Beispiel gern den Satz: ‚My pronouns are kiss my ass’ – eine völlige Degradierung dessen, was für viele Menschen zentrales Teil ihrer Identitätsfindung ist. Oder wenn man sich JD Vance anschaut, Trumps Vizepräsidenten: Er hat im Wahlkampf gemerkt, dass er eigentlich nicht besonders witzig ist, deshalb wurden ihm irgendwann die Witze aus seinen Auftritten gestrichen.
Aber ein Satz, den er fast immer gesagt hat, war am Ende jeder Rede: ‚Wir gehen zurück nach Washington und wir bringen den Müll raus. Und der Müll ist Kamala Harris’. Das ist frauenverachtend, rassistisch und auch in einem stets schmutzigen Wahlkampf problematisch. Das sind politische Beispiele, die aber aus meiner Sicht dazu führen, dass sich viele in der Gesellschaft ermächtigt fühlen, es diesen mächtigen Männern gleichzutun.“
In Deutschland wird oft auf Amerika geblickt, um vor einer „Amerikanisierung“ unserer politischen Debatten zu warnen. Gibt es Entwicklungen in den USA, die du tatsächlich als „Vorboten“ für Europa siehst?
„In den USA können unbegrenzt Gelder in Wahlkämpfe gesteckt werden. Was dazu führt, dass Wahlkämpfe immer länger und umkämpfter werden und dass Interessenakteur*innen oder Einzelpersonen wie Elon Musk enormen Einfluss gewinnen. Das ist in den USA noch einmal stärker ausgeprägt als bei uns. Aber wenn ich daran denke, dass ich im vergangenen Jahr im Wahlkampf bei einer Trump-Veranstaltung in der Schlange stand und mit verschiedenen Menschen sprach, erinnere ich mich an einen Trump-Anhänger, der mich fragte: ‚Sag mal, wie sind eigentlich die Menschen, die bei Kamala Harris anstehen?’ Er kannte seine eigenen Nachbar*innen, seine Mitmenschen, nicht mehr – und ich, die europäische Journalistin, sollte ihm erklären, was er nicht mehr versteht oder vielleicht nicht mehr verstehen will: ‚die anderen’.
Aus meiner Sicht gibt es diese Tendenz auch in der deutschen Gesellschaft: Wir sind immer weniger bereit, Menschen mit einer gegenteiligen Meinung noch zu verstehen, ihnen zuzuhören oder uns vielleicht auch einmal von einem Argument überraschen zu lassen. Das heißt nicht, dass man offen sein soll, etwa für Rassismus oder Menschenfeindlichkeit. Aber auf einer viel basaleren Ebene hören wir auf, miteinander zu sprechen. Auch das ist in den USA noch extremer – und genau daraus sollten wir lernen.“
Der Konflikt um reproduktive Rechte ist in den USA brutal eskaliert. Wenn du auf die Anti-Schwangerschaftsabbruch-Bewegung vor Ort blickst: Welche Taktiken oder Argumentationsmuster tauchen dort auf, die Europa unbedingt im Blick behalten muss?
„Was wir unbedingt im Blick behalten sollten, sind die Argumentationsmuster der Pro-Life-Bewegung. Sie verschiebt jede Diskussion sofort: Eine Entscheidung, die für mich ganz klar eine medizinische und persönliche Lebensentscheidung einer Frau ist, wird von ihnen konsequent auf eine moralische Ebene gehoben. Genau diese Verschiebung macht ihre Taktik so wirkungsvoll.“
Wie begegnen dir diese moralischen Verschiebungen konkret im Alltag politischer Akteur*innen?
„Ich habe schon vor Jahren einen Senator in Texas getroffen, der ein Gesetz mitgeschrieben hat, das in Texas umgesetzt wurde: den Heartbeat Act. Also das Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche untersagt, sobald ein hörbarer Herzschlag festgestellt wird. Sie setzen diese Grenze bei sechs Wochen, auch wenn der Herzschlag dann laut Mediziner*innen kein echter ist. Er resultiert aus elektrischer Aktivität, aber die Herzklappen haben sich noch nicht entwickelt, es bedeutet nicht, dass die Schwangerschaft lebensfähig ist. Sechs Wochen also, wenn man sich das mal überlegt: Wie lange braucht es manchmal, um zu begreifen, dass man schwanger ist? Gerade, wenn man in einer prekären Lebenssituation ist. Wann bekommt man einen Arzttermin? Wann hat man Gewissheit? Und dann soll man in einem Wimpernschlag entscheiden, ob man eine Schwangerschaft beendet oder nicht – eine ohnehin schon enorm schwierige Entscheidung für jede Betroffene."
Wie schafft man es, solch eine Entscheidung zu rechtfertigen?
„Der Senator hat im Gespräch mit mir immer nur von ‚little babies’ gesprochen. Egal, worüber wir gesprochen haben – es waren immer die ‚little babies’. In Texas gilt das Gesetz auch nach Vergewaltigung oder Inzest. Die Argumentation: Ein Abbruch sei dann nur noch ein weiteres Trauma für die ohnehin schon traumatisierte Frau. All das zeigt diese Überhöhung, diese Moralisierung dieses Themas. Ich glaube, das ist etwas, das sehr gefährlich ist – und sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite: Wenn man sich Umfragen in den USA anschaut, ist eine überwiegende Mehrheit der Gesellschaft – in allen politischen Lagern – dafür, dass es ein moderates Schwangerschaftsabbruch-Recht gibt. Also, dass die betroffene Frau zumindest innerhalb gewisser Grenzen die Chance hat, selbst zu entscheiden. Aber die Gruppe der evangelikalen Christen, die dieses Thema so groß gemacht hat, pusht es extrem in den Mainstream.
Und wenn wir dann noch einmal in die Politik schauen: JD Vance hat seinen ersten öffentlichen Auftritt als gewählter Vizepräsident in Washington bei einer Veranstaltung der Pro-Life-Bewegung gemacht. Da sieht man, wie eng das alles miteinander verknüpft ist – vor allem durch finanzielle Mittel der Evangelikalen. Auch wenn Kirche für viele meiner Freund*innen in Ohio schon vor 20 Jahren nicht mehr so eine große Bedeutung hatte, war sie für viele Familien weiterhin ein wichtiger Ort – ein sozialer Raum, der bis in Schulen und Communities hineinwirkt. Und die evangelikalen Kirchen radikalisieren sich mehr und mehr. Das haben wir auch nach dem Attentat auf Charlie Kirk gesehen, das religiös stark überhöht wurde.
Diese Bewegung forciert das Thema. Und sie sorgt auch dafür, dass keine republikanische Präsidentschaftskandidatur jemals öffentlich eine moderate Haltung zu Abtreibungen vertreten wird.“
Viele rechtspopulistische Bewegungen arbeiten mit dem Narrativ, „Gender“ sei eine Bedrohung für die Gesellschaft. Was hast du auf deinen Reisen gelernt: Woher kommt dieser tiefsitzende Anti-Gender-Reflex in den USA?
„Donald Trump inszeniert sich seit 2016 sehr erfolgreich als Strongman, als jemand, der Amerikaner*innen*innen, die sich verlassen fühlen das Gefühl gibt, dass ihr Leben wieder etwas zählt. Viele glauben, ihr Leben nicht mehr zu verstehen, ihr Land nicht mehr zu verstehen. Und man muss Menschen ja auch zugestehen, dass ihnen manche Entwicklungen zu schnell gegangen sind.
Aber dem jetzt entgegenzusetzen, was wir erleben – nämlich zu sagen: Nur weil einige da nicht mitgehen oder überfordert sind und es für sich selbst anders entscheiden würden, drehen wir alles in die entgegengesetzte Richtung und schränken Freiheiten wieder ein –, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Das, was die Amerikaner*innen einmal besonders gut konnten, dieses ‚Leben und leben lassen’ und die Freiheit, das eigene Leben so zu gestalten, wie man möchte, auch weil der Staat nicht so eine große Rolle spielt – das wird von so einer administrativen Regierungsebene aus plötzlich massiv eingeschränkt. Und das widerspricht eigentlich allem, was Amerika ausmacht.“
Gleichzeitig scheint politisch aber genau dieses Vorgehen zu funktionieren. Oder?
„Ja, weil die Republikaner ihrer Wähler*innenbasis wieder vorführen, wie das Amerika aussehen könnte, das sie verloren glauben. Dabei wird viel mit Angst gearbeitet: der Angst, dass Frauen, Queers, Migrant*innen – alle, die ‚anders’ sind – zu einer Bedrohung werden. Genau die ‚anderen’, die der Trump-Wähler, den ich letztes Jahr getroffen habe, nicht mehr verstanden hat, weil er sich nicht mehr mit ihnen auseinandergesetzt hat. Diese Gruppen werden in ein Angstszenario gepackt, und daraus wird Politik gemacht. Das ist aus meiner Sicht sehr kurzsichtig, aber für den Moment erfolgreich. Trump ist sicher nicht der größte MAGA-Ideologe, den die Welt je gesehen hat, aber er nutzt diese Ideologie strategisch geschickt für sich und seine Regierung.
Dass sich auch Frauen in diesem Weltbild wiederfinden, liegt – wie ich gerade schon angedeutet habe – an diesem sehr traditionellen Familienbild, das dort gezeichnet wird. Frauen sind darin nicht das ‚Heimchen am Herd’, sondern sie haben eine zentrale Funktion, die so überhöht wird, dass sie quasi die Schlüsselfigur dieser Familie sind. Es ist in der Erzählung eine starke Rolle, die aber in sehr engen Bahnen verläuft.“
In deinem Buch widmest du viele Seiten dem Wandel rund um Frauenrechte, DEI, ‚Wokeness’ und Identität. In den USA werden Bücher zu Themen wie Geschlecht oder LGBTQ verboten und wichtige Begriffe aus offiziellen Dokumenten gestrichen – Entwicklungen, die vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren. Du hast diesen gesellschaftlichen Kippmoment aus nächster Nähe erlebt. Gibt es Situationen, in denen er für dich besonders spürbar wurde?
„Corona hat ja vieles in der Gesellschaft verändert – in allen Gesellschaften und in der Politik. In den USA habe ich miterlebt, wie stark das überbetont wurde, zum Beispiel in den Debatten um Maskenpflicht oder darum, ob Schulen offenbleiben. Ich glaube, darin lag ein Moment, in dem die Bewegung – also die Anhänger*innen jener, die keine gendergerechte Sprache mehr an Schulen wollen oder Bücher zensieren möchten – etwas erkannt hat: dass Schulen ein Ort sind, an dem man sehr früh ideologische Grundlagen legen kann, in die eine oder in die andere Richtung.
Zahlen zeigen auch, dass Homeschooling in den USA weiter zunimmt – vor allem in konservativen Kreisen. Schule wird dort als ein Ort wahrgenommen, an dem Kontrolle über das Kind ausgeübt wird, die man als Elternteil nicht möchte. Dort beginnt im Grunde genommen der Kampf um die Ideologie: in den Köpfen der Kinder. Wenn man kontrolliert, was in Schulen unterrichtet wird, kann man eine zukünftige Generation an Wählerinnen und Wählern heranziehen, die das eigene politische Weltbild weiterträgt.“
In den USA herrscht ein Zweiparteiensystem: Seit 225 Jahren wählen die Menschen entweder demokratisch oder republikanisch. Auch in Deutschland erleben wir trotz Mehrparteiensystem eine Tendenz zu Binärität – trägt eine immer dünner werdende Mitte zum extremen Klima bei?
„Man sieht auch hier Entwicklungen, die man aus den USA kennt: dass es immer mehr Themen gibt, bei denen man das Gefühl hat, sich eindeutig positionieren zu müssen. In den USA fallen einem sofort fünf, sechs Bereiche ein – Waffen, Religion, Abtreibung, Gesundheitsversorgung, Migration. Und wenn wir jetzt etwa auf Migration schauen oder das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch: Das sind Themen, bei denen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa der Eindruck entsteht, die Debatte wird so scharf geführt, dass man sich nur noch auf der einen oder der anderen Seite wiederfindet.
Sobald man sich so extrem positionieren muss, wird es, glaube ich, schwieriger, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dann erodiert die Mitte weiter, weil es gar keinen Raum mehr für Diskussionen gibt. In den USA habe ich mehrfach versucht – ich nehme jetzt ein sehr US-spezifsches Thema –, mit Menschen über Waffengewalt zu sprechen, die enorm ist. Die Masse an Waffen, die im Umlauf ist, kann man sich kaum vorstellen.
Und in keiner dieser Diskussionen habe ich jemals gesagt: ‚Ich möchte dir das Recht auf eine Waffe nehmen’ oder ‚Ich möchte den zweiten Verfassungszusatz ändern.’ Ich habe im Gegenteil immer betont, dass ich weder den Verfassungszusatz angreifen noch jemandem das Recht auf eine Waffe nehmen möchte. Aber dass man darüber hinaus eine differenzierte Debatte führen kann. Trotzdem war ich für die meisten dann automatisch auf der ‚anderen Seite’. Diese Themen häufen sich – und das trägt dazu bei, dass wir das Gefühl haben, dass die Mitte weiter erodiert.“
Ein Jahr nach Trumps Wahlsieg haben die Demokraten wichtige Erfolge erzielt – sie gewannen die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey, in New York zieht mit Zohran Mamdani ein linker Demokrat ins Amt ein, und Kalifornien hat einem neuen Zuschnitt der Wahlkreise zugestimmt, der den Demokraten 2026 zusätzliche Sitze bringen könnte. Wie ordnest du diese Ergebnisse ein: Sind sie ein frühes Signal für eine mögliche politische Trendwende?
„Sie sind nicht unbesiegbar. Das waren allerdings alles Wahlen, bei denen Donald Trump nicht zur Wahl stand – und genau das wird wahrscheinlich die spannendste Frage in der amerikanischen Politik auf dieser Seite: Was passiert mit der MAGA-Bewegung, wenn Trump nicht mehr auf dem Ticket steht?
Auf der anderen Seite waren die Demokraten nach dessen Wahlsieg in einer Schockstarre – und sind sehr lange darin geblieben. Jetzt aber haben sie mit diesen gewonnenen Wahlen gezeigt, dass sie in ganz unterschiedlichen Konstellationen erfolgreich sein können: mit einem sehr progressiven jungen Kandidaten in New York und eher moderaten Frauen in Virginia und New Jersey. Ob progressiv in New York oder moderat in Virginia – alle hatten eine Botschaft, die die Wähler*innen erreicht hat: ‚Wir hören euch. Wir hören, dass ihr euch das Leben nicht mehr leisten könnt.’ Das ist eine Botschaft, die Trump im Wahlkampf überbetont hat. Er werde dafür sorgen, dass die Preise sinken. Das Leben aber ist teurer geworden, Umfragen zeigen, dass viele Menschen die Wirtschaft in einem schlechteren Zustand bewerten als am Ende der Biden-Präsidentschaft. Die zehn Monate Trump-Regierung haben den Menschen kein besseres Gefühl gegeben.
Das haben die Demokraten nun endlich erkannt. Sie haben gesagt: ‚Wir hören das.’ Die Frage der affordability, also sich das Leben leisten zu können, ist zentral geworden. Das hat erst einmal nichts mit Identitätspolitik zu tun – es betrifft fast alle Menschen im Land. Es sind längst nicht mehr nur die Ärmeren oder die untere Mittelschicht. Auch Menschen mit einem eigentlich vernünftigen Einkommen haben Probleme, sich das Leben in den USA noch leisten zu können. Da liegt für die Demokraten eine gute Strategie. Das heißt nicht, dass man andere Themen aufgeben muss, aber dass diese ökonomische Botschaft auf demokratischer Seite geschärft werden muss. Dann kann man auch gegen die Republikaner gewinnen.
Der nächste Test wird im November 2026 die Zwischenwahlen sein. Gleichzeitig hat auch die MAGA-Bewegung erkannt: Trump ist in seiner letzten Amtszeit. Er ist zu alt und zu unfit, um wirklich eine dritte anstreben zu wollen – ganz unabhängig davon, dass das die Verfassung auch nicht vorsieht. Da beginnt jetzt die Suche danach, wer die neue Führungsfigur werden kann, Bewegungen wie MAGA brauchen eine Lichtgestalt.
Deswegen stehen eigentlich beide Parteien vor interessanten Zeiten. Deshalb kann man noch nicht sagen, dass das schon die Trendwende für die Demokraten war. Aber sie haben zumindest etwas erkannt, das ihnen gute Politik ermöglicht.“
Gibt es aus deiner Sicht etwas, das für marginalisierte Gruppen in Zukunft noch bedrohlicher werden könnte als die Trump-Ära?
„Trump-Kritiker*innen sagen jetzt schon über seinen Vizepräsidenten JD Vance, dass er noch deutlich ideologischer ist. Wir wissen nicht, wie es intern in der MAGA-Bewegung weitergeht. Auch dort gibt es Debatten. Das ist ja keine homogene Masse, die alle gleich denken. Da gibt es die Peter Thiels in der Tech-Welt, da gibt es die Steve Bannons, die national-identitär auftreten Dann gibt es die religiösen Gruppen, über die wir schon gesprochen haben.
Wenn zum Beispiel ein JD Vance als Gewinner aus dieser internen Debatte hervorgeht – der vielleicht nicht das politische Talent eines Donald Trump hat, aber jung ist und gerade viel lernt – dann kann das aus meiner Sicht auch noch dramatischer werden für Menschen in den USA. Das ist natürlich noch weit weg. Was wir bei alldem nicht vergessen würden: Es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, sie finden gut, was Trump macht – und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Er ist nicht ohne Grund gewählt worden. Es gibt Menschen, die das befürworten.
Aber aus der Perspektive marginalisierter Gruppen hat Trump in den kommenden drei Jahren noch sehr viel Zeit, Freiheiten zu begrenzen, Unsicherheiten zu erhöhen und Räume zu nehmen. All das lässt sich dann auch nicht so leicht zurückdrehen, selbst wenn 2028 vielleicht kein Donald Trump mehr im Weißen Haus sitzt, sondern eine demokratische Präsidentin oder ein demokratischer Präsident.“
Als Journalistin begegnest du in den USA Männern wie Bryan Hughes. Ein, wie du sagst, gottesfürchtiger Mann, Republikaner, Cowboystiefel. Hughes wirkt wie die Blaupause eines Mannes, dem viele Männer auch in Deutschland wieder nacheifern. Haben wir hier „das Zeug dazu“, diesen Mann zum Mainstream werden zu lassen? Oder denkst du dir: Peanuts, diese pervertierte Form der Männlichkeit lässt sich vor allem in den USA ausleben?
„Ich pauschalisiere Männlichkeitsbilder ungern. Denn diese Bilder sind sehr individuell und hängen auch stark von nationaler Identität ab. Was ich seit Trumps Rückkehr an die Macht erlebt habe – und zwar nicht nur bei männlichen Politikern, sondern auch bei Menschen auf der Straße, bei Trump-Wählern –, ist dieses Ermächtigungsgefühl seiner Anhänger. Und ich glaube, das können wir auch in Deutschland erleben, das kann man überall auf der Welt erleben.
Es gibt nicht ohne Grund bei den Demokraten Strategiepapiere, in denen – überspitzt gesagt – überlegt wird, wie man Männer anspricht. Gleichzeitig ist es aber viel zu pauschal, weil man nicht in ein Strategiepapier schreiben kann: ‚So sprechen wir Männer an.’ Männer sind keine homogene Gruppe – genauso wenig wie Frauen.“
Du endest dein Buch mit dem Versprechen an dich, Amerika (noch) nicht ganz aufgeben zu wollen. Nun hat die Hälfte des Landes mit einer rekordhohen Wahlbeteiligung für Donald Trump gestimmt. Wie viele Tabubrüche in Sachen Selbstbestimmung und Feminismus hält deine Liebe zu diesem Land aus?
„Meine Liebe hält noch ein bisschen was aus. Meine Liebe zu Amerika hängt an meinen Freund*innen und an meiner ‚Chosen Family’. Sie sind zu meiner Familie geworden, weil sie mich aufgenommen haben, weil ich mit ihnen im Pandemie-Winter Weihnachten gefeiert habe. Und Menschen gibt man nicht so leicht auf, auch wenn die Politik immer weiter Tabubrüche begeht.
Das heißt aber nicht, dass ich nicht verstehe, wenn mir jetzt – auch im Zuge von Lesungen – Menschen begegnen, die auch eine enge Bindung zum Land haben, aber gerade nicht hinfahren wollen. Weil sie Sorge haben, weil sie es nicht aushalten oder weil sie das Land nicht wiedererkennen. Diese Sorge treibt mich auch um: dass ich irgendwann an den Punkt komme, an dem ich sage, dieses Amerika verstehe ich wirklich nicht mehr, betrachte ich nicht mehr als meine zweite Heimat.
Meine Freund*innen werden immer meine Heimat bleiben. Aber das Land vielleicht nicht mehr. Ich glaube, vor dieser Frage stehen viele. Deswegen schreibe ich im Buch, dass ich festhalte an dem, was so entnervend und gleichzeitig so beeindruckend an den USA ist: dass Amerikaner*innen*innen nie aufgeben. Das kann einen manchmal verrückt machen, aber es ist auch eine Eigenschaft, die ich all denen zuschreibe, die nicht Trump gewählt haben – und damit meine ich nicht nur progressive Menschen. Ich würde diesem Land eine kluge, gute konservative Partei wünschen, aber eine, die die Demokratie achtet, die Menschenrechte achtet, die die Verfassung achtet, die nicht versucht, Wahlen zu erschweren und den Zugang zu Wahlen so zu beschneiden, dass es für bestimmte Gruppen schwierig wird. Eine Partei, die auf dem gleichen Spielfeld spielt, auf dem demokratische Parteien spielen sollten.
Die Menschen, die an dieses Amerika glauben – an denen halte ich fest.“
Euren Podcast „OK, America?“ beenden Klaus Brinkbäumer und du immer mit einem persönlichen „Get out“. Was ist dein heutiger Get Out für uns?
„Der Podcast ,We Can Do Hard Things‘ von Glennon Doyle, Abby Wambach und Amanda Doyle. Sie waren kurz nach der Wahl auch auf Tour und haben gesagt: Wir haben auch keine Antworten, aber wir kommen zusammen und sprechen. Das war genau der Spirit, den viele Amerikaner*innen*innen gesucht haben: Menschen, die sagen, niemand hat die eine Antwort, aber we show up.“