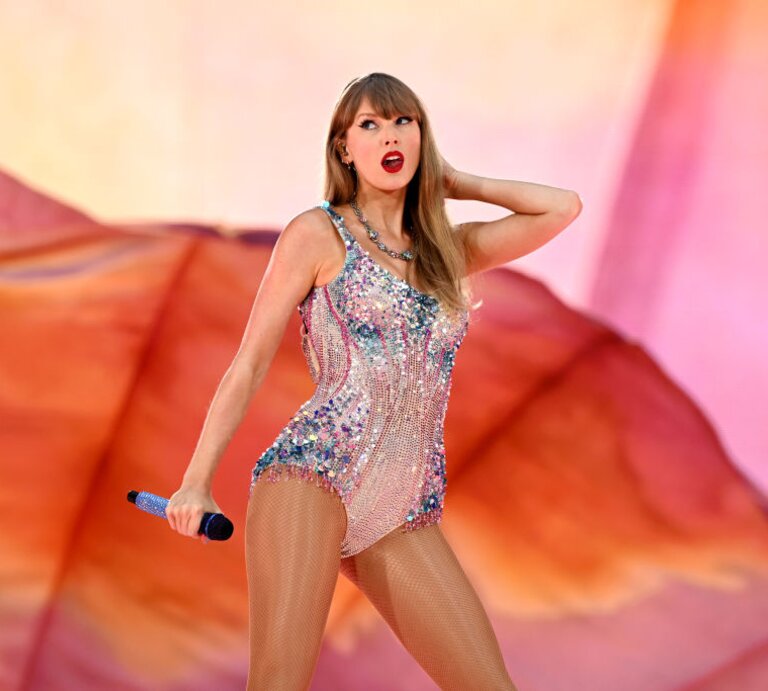Ein Nachruf auf einen Lebenden – Über „Babo – Die Haftbefehl-Story”
Ein Mann sitzt im Halbdunkel. Die Kamera fängt jeden seiner schweren Atemzüge ein. Aus dem Off ertönt die Frage: „Aykut, wie geht’s dir?“ – „Du fragst mich wie mein Therapeut, Bruder. Wie es mir geht? Gut geht’s mir.“
Alle, wirklich alle, selbst jene, die weder mit dem Rapper noch mit Rap an sich etwas zu tun haben, sprechen über nichts anderes als Aykut Anhan, Haftbefehl, den Babo. Über Rap, über Drogen und eine Industrie, die ihre besten Künstler*innen kaputtarbeitet.
Warum spricht diese Doku, dieser Nachruf auf einen Lebenden, so viele Menschen an? Vielleicht, weil Haftbefehl die deutsche Amy Winehouse ist und „Babo – Die Haftbefehl-Story” das deutsche „Tiger King”? Vielleicht weil wir längst süchtig danach sind, anderen Menschen beim Leiden zuzusehen? Oder weil der Film mehr über Deutschlands Musikbetrieb, patriarchale Männlichkeit, Klassismus, Rassismus und Konsum erzählt, als wir erwartet haben?
Aykut Anhan – Vom Kind zum „Babo“
Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, ist der Sohn eines türkischen Vaters und einer kurdischen Mutter. Mit seinen Brüdern wächst er in Offenbach in der Nähe von Frankfurt auf. Die Doku zeigt einen kleinen Jungen, der schon als Kind völlig besessen von Musik ist. „Bring mir alle Hip-Hop-CDs der Welt“, sagt er zu seinem Bruder Aytac. Es werden Szenen gezeigt, in denen er im Kinderzimmer Songtexte schreibt und im Jugendzentrum ins Mikro rappt. Es entsteht das Bild eines von Beginn an getriebenen Jungen, der schon immer Künstler war.
Der Suizid des Vaters Jelal, der in der Dokumentation fast mystisch als Figur der Frankfurter Unterwelt dargestellt wird, ist der Wendepunkt im Leben des damals 14-jährigen Aykut. Von einem Tag auf den anderen ist er kein Kind mehr. Er beschreibt, wie er sich für seinen kleinen Bruder Cem verantwortlich fühlt. Dies soll der Beginn einer langanhaltenden Überforderung sein, die später in Musik, Exzess und Zerstörung mündet.
Die Figur des Vaters prägt die Erzählung maßgeblich. In nachgestellten Szenen sehen wir zunächst einen charismatischen Mann und Casinobesitzer, der alle, die ihn kannten, in seinen Bann gezogen haben soll. Niemand, nicht einmal seine eigene Familie, weiß genau, womit er sein Geld verdiente. Klar scheint nur: Er war jemand, den man kannte, und er hatte zwei Millionen D-Mark unter dem weißen Teppich in seiner Wohnung im Block. Den Zuschauer*innen wird aber auch ein anderes Bild gezeigt: Das des abwesenden und gewalttätigen Familienvaters, dessen psychische Probleme die Familie von Anfang an prägen.
Haftbefehls Mutter, die eigentlich ihre ganz eigene Dokumentation verdient hätte, bleibt dagegen Randfigur. Regisseur und Spiegel-Journalist Juan Moreno erklärt im Podcast „Shortcut – schneller mehr verstehen”, es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, in Absprache mit ihr selbst. Ein Interview war geplant, doch sie habe es abgelehnt – zu schmerzhaft sei es, über den Suizid ihres Mannes und den Gesundheitszustand ihres Sohnes zu sprechen. Das ist nachvollziehbar, und trotzdem bleibt ihre Abwesenheit ein blinder Fleck. Denn ihre Perspektive und ihre Rolle in dieser Familie wird somit aus der Darstellung gelöscht.

„Den Aykut lieb‘ ich, den Haftbefehl nicht.“
Über 90 Minuten zeichnet Babo das Bild eines Mannes, der gleichzeitig Opfer und Täter ist. Als Erwachsener wird Haftbefehl zu einem, der er nie sein wollte. Er wird zu seinem Vater, verbringt mehr Nächte zugekokst in Hotels, statt zuhause bei seiner Familie. Die Doku zeigt diesen Werdegang mit scheinbar schonungsloser Authentizität und lässt auch nicht aus, was Anhans Erfolg und der damit einhergehende Absturz mit seiner Frau Nina und seinen Kindern macht: „Ich bin jetzt nicht alleinerziehende Mutter… Aber fast schon“, sagt Nina Anhan im Interview. Wir sehen ihr dabei zu, wie sie allein den Alltag der Familie managt, ihren Mann im Auto zu Terminen fährt. Hinter der männlichen Tragödie steht immer unsichtbar die weibliche Care-Arbeit. Während Männer ihre Krise ausleben, tragen Frauen sie mit.
Warum wir Untergänge lieben
Nicht das Talent allein, sondern auch Backstory und Trauma prägen das Bild des Menschen, der später zu „Babo“ wird. „Kein Wunder, dass er Künstler geworden ist, mit dieser Geschichte“ hören wir Bazzazian, Haftbefehls Musikproduzenten, zu Beginn des Films sagen. „Ich war schon tot“, sagt Anhan selbst.
Die Doku inszeniert Haftbefehls Story mit der Dramatik eines Nachrufs, als sei er bereits gestorben – obwohl er mitten im Leben steht. Thematisch wird das sogar nochmal aufgegriffen in einer Szene, in der Hafti als „lebende Legende“ auf der Bühne angekündigt wird. „Legende sagt man nur zu Toten, Bruder. […] Ich lebe noch.“
Die gesellschaftliche Faszination für den Untergang ist kein neues Phänomen. Menschen fühlen sich zu Geschichten hingezogen, in denen andere scheitern. Historische Beispiele: Amy Winehouse, Kurt Cobain, Britney Spears. In allen Fällen wird die Zerstörung des Individuums zur Projektionsfläche für die Gefühle der Zuschauenden. Haftbefehl verkörpert das deutsche Pendant. Sein Leben zeigt Trauma, Sucht, Gewalt, Überforderung. Hafti selbst wird als Sprachrohr einer ganzen Generation gefeiert. Er ist jung, kurdisch, nimmt kein Blatt vor den Mund, redet frei von seinen Erfahrungen. In seinen Songs ist er hart und trotzdem nahbar. In Interviews ist er vor allem unfassbar humorvoll. Gerade in Interviewclips aus seiner Anfangszeit sehen wir einen Künstler, der trotz seines immensen Erfolgs, goldenen Uhren und schnellen Autos auf dem Boden geblieben scheint und mit Reporter*innen herumwitzelt.
Wer so erfolgreich ist wie er, muss nicht wissen, was ein Frikativ ist oder warum er für seine Karriere so relevant ist. Dafür lieben ihn die Menschen. Weil er einen Fick auf Hochkultur gibt, weil es nicht relevant ist.
Der Haftbefehl, wie die Doku ihn zeigt, ist das alles nicht mehr. Er ist ein sturer, gebrochener Mann, ein kokainabhängiger, unzuverlässiger Künstler, der keine Zeit für seine Kinder hat und die Sünden des Vaters zwar lyrisch aufarbeitet, jedoch trotzdem nicht drumherkommt, sie zu reproduzieren. Einem wird fast schwindelig dabei, wie zwischen Haftbefehl dem Künstler und Aykut der Privatperson gewechselt wird.
Den Zuschauenden wird vollkommen klar, dass Aykut Anhan weder ein guter Vater, noch ein guter Ehemann oder ein vertrauensvoller Freund ist. Aber weil wir sehen, wie er sich selbst dafür verurteilt, wirkt er real und greifbar. Wir wollen ihn hassen. Für das, was er seiner Familie und sich selbst antut. Gleichzeitig wollen wir ihn retten, weil wir seine Entwicklung medial begleitet haben und weil er als größter deutscher Rapper immer noch so nah zu sein scheint.
In „Babo“ wird der Untergang nicht nur nacherzählt, sondern von allen sehr wirkmächtig emotional nacherlebt. Aykut Anhan wird als Protagonist zum Antihelden seiner eigenen Geschichte. Wir, das Publikum, sehen darin eine Art Heilung, so als würde seine Zerstörung unsere Katharsis sein.
Ich finde, es ist schwer, über diese Doku zu schreiben, ohne sich schuldig zu fühlen. Schuldig, weil man sie und ihren Protagonisten gut findet, schuldig, weil man sie schlecht findet, ihn hasst – aber trotzdem fühlt?

Voyeurismus als Volksport
Eine der zentralen Fragen, die sich mir nach dem Ansehen der Dokumentation stellte, war: Wie nah darf man einem Menschen kommen, um authentisch nachvollziehen zu können, was ihn zerstört?
In einer Szene liegt Haftbefehl mit glasigen Augen und zitterndem Körper auf dem Sofa, sein Atem geht schwer. Wir sehen ihn schreien, zusammenbrechen, kaum anwesend mit seinen Dämonen reden. Die Kamera hält drauf, was das Zeug hält, manchmal auch, so scheint es, gegen den Willen des Regieteams. Es soll – das ist der immer wieder ausgesprochene Wunsch von Aykut – ungeschönt erzählt werden, wer dieser Mensch hinter dem Albumcover ist. Regisseur Moreno betont, er habe schlimmere Szenen, in denen aktiv konsumiert wird, bewusst außen vor gelassen, um Anhans Würde zu bewahren.
Dass wir uns bei all den Emotionen als Voyeur*innen wiederfinden, ist kein Unfall, sondern Teil des Deals. Wir konsumieren Schmerz, wir kommentieren ihn, wir teilen ihn. In gewisser Weise machen wir uns – auch wenn das vielleicht streitbar ist – mitschuldig. Unsere Aufmerksamkeit wird monetarisiert und das Leiden des Einzelnen ist Teil der Ware. Und obwohl der Film all das zeigt und kritisiert, bleibt er doch in ebendiesem Mechanismus gefangen. Beim Sehen der Doku wird uns das bewusst, und trotzdem können wir nicht anders, als hinzusehen.
Die Doku will gnadenlos ehrlich sein. Ganz ehrlich: Visuell hat sie mich krass abgeholt. Aber natürlich dient auch das alles der Legendenbildung. Licht, Schnitt, Musik. Alles entsteht aus der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wer profitiert am Ende davon? Was wird gefördert? Und wer unterstützt Nina Anhan dabei, aus dieser Ehe auszubrechen?
Hier geht es irgendwie viel weniger um das eigentliche Werk, sondern mehr um die Suche nach größtmöglicher „Authentizität“. Die eigentliche Tragödie ist, dass eine ganze Industrie Profit daraus zieht, wie sich ein Mensch für sie kaputtmacht, nur um daraus noch mehr Profit zu ziehen.
Einer der für mich mit Abstand erschreckendsten Teile der Doku war das Geburtstagskonzert in der Jahrhunderthalle, bei dem Haftbefehl trotz bekannter gesundheitlicher und psychischer Probleme auftritt. Acht Monate Planung, Unsicherheit und Anspannung. Ein Manager wird als armes Häschen dargestellt, weil er nicht weiß, ob sein mit einem Fuß im Grab stehender Künstler ihn nicht doch noch mit einem großartigen Konzert beglücken kann. Zu seinem eigenen Geburtstag. Und ja: Haftbefehl zeigt sich in der Doku beratungsresistent. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Mensch, wie wir durch die Perspektive seines kleinen Bruders Cem sehen, nicht mehr zurechnungsfähig ist. Am Ende gibt es Applaus für einen Mann, der kaum ansprechbar ist. Das Publikum feiert seine Stärke. Seine Frau steht neben der Bühne und kann nur schwer ertragen, was da gerade passiert. Und der Typ von Universal findet es krass geil, wie viele von Haftis Rapkollegen gekommen sind. Hafti-Abi, der große Bruder, lädt zum Familientreff.
„Mein Leben ist keine Kellogg's-Werbung“ – Männlichkeit und Mythos
So real die Doku auch sein will, so klar muss auch sein, dass jede Szene, auch die von Downs und Rückkehr nach Drogenexzessen, den Marktwert von „Babo“ steigert. Die Doku verdeutlicht, dass individuelles Leid extrem gut kapitalisierbar ist. Denn nichts anderes passiert. Aber hohe Suizidraten, Suchtproblematiken und Gewalt – das sind keine individuellen Probleme, sondern männliche Themen und im Patriarchat geborene Übel. Sure, ein Patriarchat, das von Männern erschaffen wurde und vor allem von Männern aufrechterhalten wird. Aber es schadet auch denen, die es erbaut haben und aufrechterhalten, in großen Teilen enorm.
Laut Statistischem Bundesamt wurden 71,5% aller Suizide 2024 von Männern begangen. Kokain wird von Männern viermal häufiger genutzt als von Frauen. Hauptmotive für den Konsum sind laut addiction.de Stress, Leistungsdruck, Selbstmedikation und psychische Probleme. Männer in ambulanten Suchthilfeeinrichtungen sind im Schnitt 38 Jahre alt und zeigen bei fast allen Suchtdiagnosen höhere Raten als Frauen (außer bei Alkohol- und Stimulanzienkonsum). Aykut Anhans Geschichte spielt vor dem Hintergrund dieser Zahlen.
Viele fühlen sich von der Doku abgeschreckt, sind emotionalisiert, bemitleiden, verurteilen aber auch. Aber da bin ich mir sehr sicher: Es gibt auch diejenigen, die sich gerade von einer Inszenierung dieser Art angesprochen und inspiriert fühlen, eben weil sie so extrem ambivalent ist. Denn durch die Art des Erzählens wird auch eine große männlich-kapitalistische Sehnsucht bedient: die nach Erlösung durch Scheitern. Endlich körperlich so erschöpft zu sein, dass man nichts mehr tun muss. Die psychische Gesundheit allein reicht dafür nicht aus. Erst die komplette körperliche Aufgabe rechtfertigt die Pause. Mit anderen Worten: Nur wer einmal richtig am Boden war, darf endgültig aufsteigen, und Mitgefühl gibt es erst kurz vor Schluss. Und all das scheint in Aykut Anhans Fall in Ordnung zu sein, denn er ist ein Rockstar, der sich dieses Leben und die Drogen offensichtlich selbst ausgesucht hat. Er hätte es ja auch lassen können.
Meiner Meinung nach ist Babo als Film der Beweis, dass auch Männer sehr wohl öffentlich leiden dürfen – solange sie dabei eine gute Soundkulisse liefern. Anstatt einen einfühlsamen Blick zu wagen, wird hier der Fokus auf Dysfunktionalität und Egozentrismus gelegt, die zur Persönlichkeit und Marke gemacht werden. Und das ist, wie gesagt, kein individuelles Problem. Es gibt auch sonst genügend Männer, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Depression, ihre Trauer zu ihnen gehört, in ihre DNA eingeschrieben ist. Sie hassen sich und die Tatsache, dass sie schlechte, emotional distanzierte Väter sind, die nicht aus ihrer Haut können. Aber ändern tun sie trotzdem nichts. Ihr Leid? Ungehört. Niemand würde sie jemals verstehen, niemand könnte sie jemals retten. Es sind Männer, die ihr eigenes Leid gleichzeitig ernst und doch nicht ernst genug nehmen, um sich helfen zu lassen.

Vom Aufstieg eines Mannes und dem Versagen der Gesellschaft
Bei all dem Fokus auf Männlichkeit, kommen wir aber nicht umhin, auch zwei weitere Faktoren mit in den Blick zu nehmen: Rassismus und Klassismus in Deutschland. Es ist nicht allein Aykuts Schuld, dass er diesen Weg gegangen ist. Er trägt zwar auch Verantwortung, aber die Doku nimmt wieder nur den nächsten Mann, den Vater, ins Auge und vergisst dabei meiner Meinung nach, auf die systemische Ebene zu schauen. Denn da sind – und das jetzt nur in Haftis Fall – andere Männer, die nur am Rande schockiert sind von den menschlichen Abgründen, die sich da auftun. Sie debattieren, wie sie damit weiter reich werden können.
Außerdem geht es nicht nur um einen Mann, der „abgestürzt“ ist, sondern auch um eine Gesellschaft, die migrantische Männer erst dann nicht mehr als Gefahr wahrnimmt, wenn sie zu Legenden aufgestiegen sind.
Klar, Babo soll natürlich keine Systemkritik, sondern in erster Linie ein Künstlerporträt sein. So ist das Projekt zumindest gestartet. Vielleicht sollten wir nicht den Anspruch haben, dass dieser Film das alles mit einfängt. Aber: So groß wie er ist, so krass wie er ist, hätte es eine nicht zu unterschätzende Wirkung gehabt, wenigstens kurz darüber zu sprechen, wie Rassismus, Trauma und Konsum im Patriarchat zusammenhängen.
Was ich sagen will, ist: Gesellschaftlich scheinen wir immer noch nicht so recht zu wissen, wie wir über Männlichkeit sprechen sollen, ohne dabei in Märchenerzählungen abzuschweifen. „Babo“ ist kurdisch und bedeutet „Vater“. „Babo – Die Haftbefehl Story“ hätte auch die Geschichte von Jungs sein können, die ohne Väter aufgewachsen sind. Oder von Vätern, die nie gelernt haben, Väter zu sein, und von Müttern, die sich völlig aufopfern, um für ihre Kinder da zu sein. Sie hätte auch eine Geschichte von Familien sein können, die sich in Deutschland „integrieren“ sollten, ohne dass ihnen dabei tatsächlich Unterstützung angeboten wurde. Sie muss es nicht sein, aber sie hätte es sein können.
Linken-Politikerin Mersedeh Ghazaei äußerte sich auf ihrem Instagram-Kanal @sucukmama dazu:
„Was Hafti zeigt, ist kein Einzelfall. Es ist Realität für viel zu viele migrantische, arme, queere, abgehängte Menschen in diesem Land. Und es ist das Ergebnis einer Politik, die lieber Polizei aufrüstet und die Jugend kriminalisiert als Sozialarbeit auszubauen und Zukunftsperspektiven zu schaffen.”
Und so ziemlich auf den Punkt bringt es Juristin und Antidiskriminierungsexpertin Dr. Asmaa El Idrissi, die schreibt:
“Ich wünsche meinem kurdischen Abi von HERZEN alles Gute. Diese Doku wäre die Chance gewesen, nicht nur einen Stern zu erklären, sondern ein ganzes Sonnensystem.”
„Weißt du, warum ich hier bin? Falls mir irgendwann mal was passiert, dass meine Geschichte richtig erzählt wird, aus meiner Sicht.“
Solange wir solche Geschichten medial groß aufarbeiten, tragen wir selbst zur Legendenbildung bei, lassen den Mythos weiterleben und reproduzieren damit auch den Missbrauch, der zu seiner Entstehung geführt hat. Es bleibt, was schon immer gestimmt hat: (Bild)sprache bildet nicht nur Realität ab, sondern schafft sie auch.
Hilft Babo gegen das offensichtliche Drogenproblem, das gerade die Musikindustrie heimsucht? Hält diese Doku Jugendliche davon ab, seine Geschichte zu romantisieren und ihm nachfolgen zu wollen? Soll sie das überhaupt leisten? Wie bereits gesagt, finde ich die Doku extrem relevant. Mit genau diesem Gefühl gehen gerade viele Menschen aus dem Film. Die Doku ist wichtig, weil sie vor allem eines ist: eine Gesprächsgrundlage für so viele Themen, die über Rap hinausgehen.
Lasst uns gerade jetzt aber auch darüber sprechen, was es bedeutet, als migrantisches Kind in Deutschland aufzuwachsen, was es heißt, als Kurd*in in Deutschland aufzuwachsen, was es heißt, mit einem toxischen Männlichkeitsbild im Block aufzuwachsen und mit 13 das erste Mal Kokain konfrontiert zu werden.