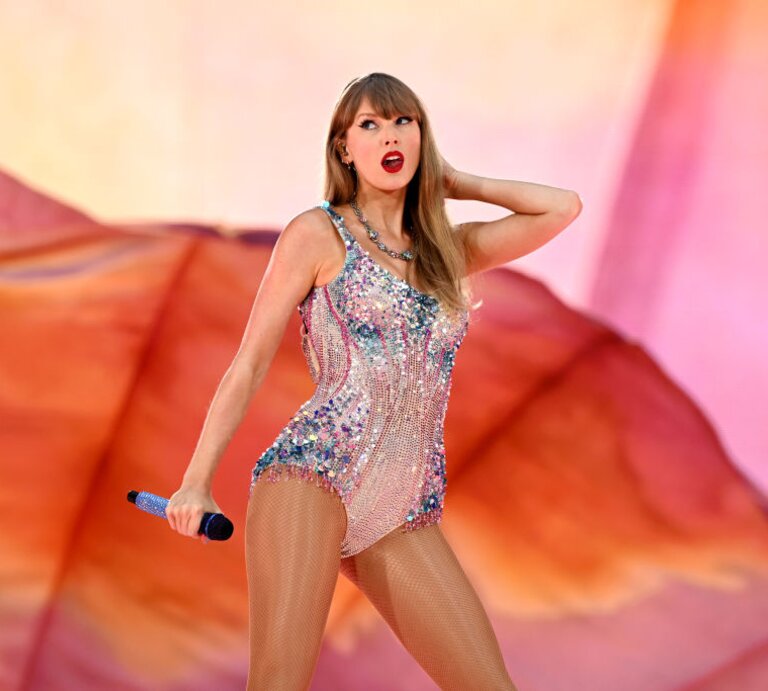Daniela Dröscher: „Krankheit – das heißt nicht schwach sein, sondern unglaublich stark“
Mit ihrem neuen Roman „Junge Frau mit Katze“ wirft die Autorin Daniela Dröscher einen schonungslosen Blick auf die unsichtbaren Kämpfe von FLINTA*-Personen im Gesundheitssystem. Ein Gespräch über Körper, Heilung und Entschlossenheit.
Mit „Junge Frau mit Katze“ legt die Autorin Daniela Dröscher nach ihrem gefeierten Bestseller „Lügen über meine Mutter“ einen ebenso klugen wie berührenden neuen Roman vor. Im Mittelpunkt stehen grundlegende Fragen weiblicher Existenz: Wie beeinflussen gesellschaftliche Strukturen unsere Gesundheit, wie erleben Frauen ihren Körper in einem System, das sie allzu oft ignoriert – und was bedeutet es, jeden Tag mit den unsichtbaren Bürden von Krankheit zu leben?
Daniela Dröscher erzählt von Medical Gaslighting, Gender Health Gap und den Kämpfen von FLINTA* um Selbstbestimmung und Heilung – und sie gibt damit all jenen eine Stimme, deren Leid im Alltag oft übersehen wird. Im Interview spricht die Autorin offen über die Hintergründe ihres Romans, über die Figur Ela, weibliche Körper und den langen Weg zu mehr Sichtbarkeit in der Medizin.
Liebe Daniela, in diesen Tagen erscheint dein neues Buch „Junge Frau mit Katze“. Es ist der Nachfolger deines Bestsellers „Lügen über meine Mutter“. Für alle Leser*innen, die die Protagonistin noch nicht kennen: Wer ist Ela?
„Ela ist eine knapp 30-jährige junge Frau, die Geisteswissenschaften studiert hat und jetzt an ihrer Promotion schreibt – die Arbeit liegt in den letzten Zügen. Sie hat eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter, man könnte fast sagen, es ist eine symbiotische Mutter-Tochter-Beziehung.
Ela hat eine enge Freundin, Leo. Und Leo hat ein fünf Jahre altes Kind, Henny. Die drei sind eine Art Wahlfamilie, mit dem heutigen Vokabular. Ela hat zu dem Zeitpunkt der Geschichte keinen Partner.
Und: Sie hat einen sehr komplizierten Körper oder sagen wir: ein sehr kompliziertes Verhältnis zu einem komplizierten Körper. Ansonsten würde sie, glaube ich, von sich behaupten wollen, dass sie eine ganz normale junge Frau ist. Und mit dem Wort ,normal’ fängt das Problem vielleicht schon an.“
Du hast mal gesagt, dass du dich mit jedem neuen Text auf eine Suche begibst, dass du etwas verstehen willst, was du vor dem Schreiben noch nicht verstanden hast. Auf welche Suche begibst du dich mit deinem neuen Buch „Junge Frau mit Katze“?
„Mich hat der Zusammenhang zwischen Körper und Seele interessiert, oder zwischen Körper und Geist. Wie kommunizieren die beiden miteinander? Oder ist es überhaupt richtig, von ,beiden’ zu sprechen, weil auch unser Geist ja physische Bedingungen hat, unser Gehirn ist ein Organ. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen.
Ich wollte in erster Linie verstehen, wie diese Systeme Körper und Seele in dieser konkreten Figur kommunizieren. Kommen sie sich in die Quere, wie bedingen sie einander?
Man sieht hier einen Menschen in der Krise. Und diese Krise hat sehr stark damit zu tun, dass Ela nicht gelernt hat, ihren Körper zu verstehen. Das ist ja erstmal eine interessante Beobachtung, weil der Körper so elementar ist für jeden Menschen und wir aber wenig aufgeklärt sind über basale Funktionsweisen und schon gar nicht über die Interaktion von Körper und Geist, also das Feld der Psychosomatik. Das ist zu dem Zeitpunkt der Geschichte, also im Jahr 2008, noch gravierender als heute.
Damals bestand, glaube ich, noch sehr stark die Konnotation: Wenn etwas psychosomatisch ist, dann ist es psychologisch, eingebildet oder übertrieben. – Ela macht sich auf die Suche nach den Ursachen ihrer Beschwerden und stößt so immer weiter vor zu der Verbindung dieser beiden Gefilde.“
Es kommt hier auch noch die Komponente der Arbeit hinzu. Wie hängen Arbeit, Psyche und Körper zusammen – gerade in Bezug auf Erschöpfung, Überlastung, also die Reaktion eines Körpers auf extreme Arbeitsphasen?
„Ela hat vieles nicht gelernt. Ich will das nicht als ihren individuellen Fehler markieren, aber sie hat nicht gelernt, Pausen zu machen. Sie hat nicht gelernt, Stopp zu sagen, wenn sie erschöpft ist. Sie hat nicht gelernt, krank zu sein.
Sie ist krank, aber sie darf nicht krank sein, denn als freiberufliche Person geht das nicht. Wenn die Arbeit liegen bleibt, wird die Miete nicht bezahlt, es gibt kein Sicherheitsnetz, das sie auffängt. Und die Arbeit ist der große Motor, ein Korsett, in dem sie steckt. Er presst sie sehr stark in diesen permanenten Leistungszwang.“
Sind in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft insbesondere weibliche Körper gefährdet, auf einen Abgrund zuzusteuern? Rebelliert der weibliche Körper letztendlich gegen die patriarchale Struktur?
„Absolut. Das ist, glaube ich, der Protest in Reinform, den dieser Körper versucht zum Ausdruck zu bringen. Interessant ist, dass es gar keinen konkreten Patriarchen gibt, der Ela sagt: ,Du musst dies und das.’ Der Vater ist abwesend, wirft aber noch seine langen Schatten voraus, weil er selbst im Leistungsmärchen total verhaftet ist.
Die Mutter, die auch eine wichtige Rolle spielt, hat das ebenso stark verinnerlicht, dass sie nur dann einen Wert hat, wenn sie arbeitet. Und der Doktorvater ist ein sehr freundlicher Mensch, der selbst in den Mühlen dieses akademischen Systems steckt, aber nicht als Patriarch inszeniert wird.
Das Interessante beim Schreiben war zu sehen, wie stark Ela diesen Leistungs-Ethos verinnerlicht hat. Da braucht gar niemand mit der Peitsche neben ihr stehen und sagen: ,Du musst’, sondern der Selbstwert ist so extrem an Leistung gekoppelt, dass sie das von alleine tut.“
Kämpfen in Ela nicht auch diese zwei Seelen? Einerseits dieses „Ich muss arbeiten, das bin ich, das ist meine Identität“ und andererseits die Erkenntnis, dass sie daran zugrunde geht?
„Absolut. Diese beiden Seelen kämpfen das ganze Buch hindurch, mal hat die eine die Oberhand, mal die andere. Und wie jeder Mensch sehnt sie sich nach Freiheit und nach einem Leben, das ihr entspricht und sie nicht ins Krankenhaus oder in den nächsten Burnout bringt. Sie sucht nach einer Lebensform und einer Arbeitsweise, die zur ihr passen.
Das ist eine individuelle Suche, die ich da beschreibe, und ich glaube, insgesamt gelingt sie für die allerwenigsten und immer nur vorläufig. Man muss wie mit einer Spürnase und ganz viel Privilegien und Glück die Lücken ausfindig machen, damit man sich in diesem feindlichen System irgendwie schützen oder so einrichten kann, dass man vielleicht Hebel in die Hand kriegt, um das Ganze zu verändern. Ela sucht diese Lücke.“
Was meinst du mit damit, die Suche gelinge immer nur vorläufig?
„Ela verlässt ja die Wissenschaft und betritt das Feld der Literatur und sie glaubt: Jetzt bin ich frei und jetzt wird alles großartig. So wie ich damals, als ich angefangen habe zu schreiben, mir überhaupt nicht klargemacht habe, dass ich natürlich einen Markt betrete. Ein Markt hat Gesetze, es gibt Ökonomien und Logiken. Es gibt kein Leben außerhalb dieser Struktur. Es gibt immer nur diese vorläufigen Befreiungsmanöver.
Ich würde so weit gehen zu sagen: Welche Frau sollte sich mit dem Patriarchat versöhnen können? Wie sollte das aussehen? Wir können nie versöhnlich in dieser Struktur leben. Wir können mit uns versöhnter sein oder großzügiger, liebevoller. Das ist eine krass wichtige Arbeit, und die gehört überhaupt nicht in die Selbstfindungs-Esoterik-Ecke, für FLINTA* sind es viel mehr Überlebenstechniken.
Aber Versöhnung, Ankommen, so wie das in einem klassischen Bildungsroman der Fall wäre – Wilhelm Meister findet seine Erfüllung und seinen Platz in der Welt –, das geht für eine FLINTA*-Figur gar nicht. Das kann immer nur ein vorläufiger Platz sein, und der muss dann wieder beackert, bearbeitet und erkämpft werden.“
Was du beschreibst, sind ja diese mächtigen Strukturen, die so schrecklich massiv sind. Blicken wir mal auf die Mutter-Tochter-Beziehung: Was hat die Protagonistin Ela von ihrer Mutter mitgenommen, und was versucht sie abzulegen? Wie ist diese Dynamik, und welche Rolle spielt Schuld dabei?
„Die Mutter hat noch viel weniger gelernt, Platz in der Welt einzunehmen als Ela. Sie hat sehr viel an sich verleugnet, was ihr wichtig war im Leben. Sie hat das Lesen aufgegeben, ihren Beruf. Sie hat sich aufgeopfert. Da sie als warnendes Beispiel vor ihrer Tochter steht, gibt es da schon Lerneffekte – leider, muss man sagen. Lernen am Negativ-Vorbild.
Dieses sich bis zuletzt für andere opfern, obwohl man selbst keine Ressourcen mehr hat, das hat Ela vorgelebt bekommen und das versucht sie abzulegen. Zum Beispiel zieht sie eine Grenze bei ihrer Freundin Leo. Als Ela krank wird, kann sie da noch auf das Kind aufpassen? Sie sagt: ,Nein, das kann ich nicht.’ Das ist ein Dilemma, aber sie geht nicht über die Grenze.
Ela hat von der Mutter vorgelebt bekommen, dass Liebe Selbstaufopferung bedeutet, dass sich zu verlieben heißt, als Subjekt unterzugehen. Das versucht Ela zu überwinden. Es gibt einen zarten Love Interest im Buch, und sie schafft für sich die Bedingung der Möglichkeit, sich überhaupt frei verlieben zu können, ohne diesen ganzen Apparat an schädlicher romantischer Projektion.
Und sie verlässt dieses elende Dreieck aus Retter-Täter-Opfer. Es gibt diese Weisheit, dass wenn man es schafft, keines davon sein zu müssen, dass das der Weg in die Freiheit bedeutet.“
Was aber eher eine Utopie ist.
„Absolut, es ist eine Utopie, und es ist wichtig, sie vor Augen zu haben. Da ist Ela nicht, noch nicht, aber diese Utopie wartet am Horizont.“
Es gibt ja diesen abwesenden beziehungsweise gewaltvoll kommunizierenden Vater. Das Muster kennen viele. Gibt es Hoffnung, da rauszukommen aus dieser ur-patriarchalen Struktur?
„So präsent der Vater in den Köpfen und Körpern ist, er ist zumindest physisch abwesend. Und es gibt eine Art Gegenmittel im Roman: die engen Verbindungen zwischen den weiblichen Figuren. Ich erzähle ja im Prinzip drei Generationen. Die Großmutter spielt auch eine Rolle, die Mutter, Leo, Henny. Die Mitglieder dieser kleinen Wahlfamilie sind bedingungslos füreinander da. Es ist teilweise schwierig, weil jede*r Einzelne sehr viel trägt. Ela denkt einmal im Buch: Es scheitert manchmal daran, dass wir uns einfach nicht halten können, obwohl wir uns halten wollen, aber wir haben keine Kraft.
Aber alle Figuren suchen Kraftquellen auf. Die Mutter befreit sich durch eine Pilgerreise, Leo wird Gewerkschafterin und macht Urlaub in der eigenen Stadt. Sie nimmt sich dieses Recht auf Pause. Und Henny wird von diesen beiden Freundinnen großgezogen – keine schlechten Rollenvorbilder, würde ich sagen. Ich habe versucht, in diesem kaputten patriarchalen System eine kleine Enklave zu bauen, wie so eine utopische Zelle.“
Und wenn es viele Zellen solcher Art gibt und die sich vernetzen …
„… dann haben wir vielleicht Hoffnung, ja. Wir sagen immer Struktur, aber die Struktur ist nicht von mir getrennt. Sie geht durch uns und durch mich hindurch, und ich kann sie bewegen. Es gibt diesen wahnsinnig schönen Halbsatz von Michel Foucault, er sagt: Ich werde regiert, und es geht um die ,Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden’. Das meinte ich mit den Lücken: Es geht darum, die Lücken auszumachen und sie zu dehnen, zu erweitern, zu besetzen und zu behaupten.“
An einer (Lieblings-)Stelle schreibst du „in indigoblauer Traurigkeit, was waren wir nur für eine seltsame Familie“. Glaubst du noch an das Konzept der Kleinfamilie?
„Ich habe nie daran geglaubt, recht früh schon nicht, und dann passiert es einem doch so im Leben. Obwohl ich immer versucht habe, Anbauten vorzunehmen an dieses klassische Konstrukt. Nein, die Kleinfamilie ist in sich nuklear. Sie ist geradezu dazu angelegt, zu implodieren. Es ist ein geschlossenes System, und das erzeugt immer Machtverhältnisse oder auch ein Machtvakuum, was genauso schlecht ist, weil dann Verantwortung nicht übernommen wird. Zu meiner Utopie gehört, dass wir diese Struktur irgendwann überwinden. Ich halte sie für nicht reformierbar.“
Ich war neulich bei einem Abend mit mehreren Freundinnen, die allesamt im Konstrukt der Kleinfamilie leben. Mein Gefühl war: Man muss nur bestimmte Knöpfe drücken in Form von Fragen, und dann brechen alle zusammen.
„Ja, das sind sehr mächtige Muster, die haben eine Schwerkraft. Die haben wir nicht nur in unseren Bildern, sondern in unseren Körpern. Der Körper hat ein Gedächtnis, und der weiblich sozialisierte Körper strebt, sobald er schwanger wird, offenbar fast wie automatisch der Kleinfamilie zu. Nicht alle, nicht immer, aber es ist eine mächtige Struktur.
Interessant wird es, wenn diese Struktur verlassen wird. Meiner Erfahrung nach ist das eine unglaubliche Kraft, die da freigesetzt wird, und dann entstehen neue Systeme und Wahlfamilien. Vielleicht geht es bei der folgenden Generation schneller, oder sie geraten erst gar nicht in diese Versuchung. Es ist ja tausendfach erzählt. Die Frage ist, wie kommen wir das raus.“
Aktuelle wissenschaftliche Analysen zeigen, dass von heterosexuellen Beziehungen und insbesondere der Ehe vor allem Männer profitieren, nicht die Frauen. Du schreibst im Buch: „Nach der Heirat zog meine Mutter mit meinem Vater in sein Heimatdorf. Dort ging sie buchstäblich in Konventionen unter.“ Das klingt wie das Verschwinden von ganzen Frauengenerationen.
„Oh mein Gott, ja. Das Bild vom Verschwinden hatte ich noch nicht so stark, ich kriege Gänsehaut. Ich fürchte, ja. All diese unsichtbaren Leben. Sie verschwinden in dieser gefräßigen Struktur.
Wie viel physische, emotionale Arbeit in diese Struktur fließt und einfach weg ist. Sie kommt ja noch nicht mal bei den Kindern an. Wenn diese Energie wenigstens bei den Kindern ankommen würde und sich nicht aufspalten müsste zwischen Kind, Mann, Hausarbeit, Erwerbsarbeit.“
Die zentralen Themen in deinem neuen Buch „Junge Frau mit Katze“ sind Frauengesundheit, Gender Health Gap, Medical Gaslighting. Wurden diese Themen im Zuge des Erzählens dominant, oder war dein Plan vor dem Schreiben, dass du darüber erzählen möchtest?
„Ich habe erstmal von mir aus erzählt, weil meinem eigenen Körper schon viele Geschichten und Dramen eingefallen sind. Die sind erzählenswert, und ich bin damit nicht alleine. Ich hatte schon länger den Wunsch, so eine weibliche Odyssee durchs Gesundheitssystem zu erzählen. Ich habe die Odyssee aus meinen individuellen Erfahrungen gebaut und dann gemerkt, es gibt wahnsinnig interessante Theorien dazu und Studien, die sind so auf den Punkt, dass man die Bücher gegen die Wand werfen will, weil es so ungerecht und ignorant zugeht.
Der Gender Health Gap stand ja bei der letzten Wahl in fast jedem Parteiprogramm. Es gibt also offensichtlich ein Bewusstsein dafür. Ich habe mich eingelesen, musste mich aber daran erinnern, dass die Geschichte im Jahr 2008 spielt.
Der Stand jetzt ist, dass ein Großteil der Frauen die Symptome für einen weiblichen Herzinfarkt kennt – 2008 war das noch nicht so. Oder die Schilddrüse, die so prominent im Buch ist, die in ihrer Relevanz damals auch noch komplett unterschätzt und unerzählt war. Es ist vieles passiert seither. Ela bewegt sich zu einem Zeitpunkt, da ist das alles noch viel weniger bekannt, erforscht, benannt. Deshalb ist sie auch so verloren. Die meisten Ärzt*innen heute würde denken: ,Ist doch klar, sie hat was mit der Schilddrüse.’ Das war damals nicht im Bewusstsein.“
Du beschreibst die Figur so, als fände sie die Mitte nicht. Entweder sie übertreibt und geht zu früh ins Krankenhaus, oder sie setzt sich einer Lebensgefahr aus. Was ist das bei ihr?
„Das ist, glaube ich, ein typischer Mechanismus bei einer Angststörung. Es gibt nur Verdrängung oder helle Panik. Dieses sachliche, sachorientierte Vorgehen, das Vertrauen in das eigene Körpergefühl ist brüchig geworden. Ela müsste erstens ansatzweise verstehen, was mit ihrem Körper los ist. Zweitens müsste sie Vertrauen haben, dass ihr zugehört wird. Das passiert bei den wenigsten Ärzt*innen sofort.
In einer Romanfassung saß sie in 14 Wartezimmern, eine Audienz absurder als die andere. Ela widerfährt eine Mischung aus nicht ernst genommen, Burnout-Diagnose, oder dem Rat, sie soll sich ausruhen. Darauf reagiert sie allergisch, weil sie sich nicht ausruhen kann. Sie muss arbeiten. Ausruhen ist der Todfeind.
Sie versucht zurückzufinden in eine sachliche Mitte, und das dauert lange, lange im Buch und geht nur mit Hilfe von außen.“
Welche Rolle spielt ihr Bruder dabei?
„Der Bruder ist der Gelassene, er verkörpert die Gelassenheit per excellence, ist sehr in seiner Mitte, nah an seinem Körper, in sich ruhend. Er nimmt sie ernst und kommt auch, wenn es ihr schlecht geht, und kümmert sich. Er hat Mitgefühl, aber er leidet nicht mit. Das ist wichtig, sonst ist man nicht mehr handlungsfähig. Er hat auch gute Ideen, wer konsultiert werden könnte.
Aber Ela ist in der Verweigerung, weil sie mit dem klassischen Bild von Medizin aufgewachsen ist. Alles Alternative steht unter Verdacht. Und es ist teuer. Sie muss sich überwinden, wenigstens einen Teil ihres Stipendiums dafür zu verwenden, eine Heilerin aufzusuchen, die nicht von der Kasse bezahlt wird. Das ist ihr total fremd, dass man das darf. Das ist nicht nur eine materielle, sondern auch eine mentale Hürde.
Dann gibt es diese Stimmen von außen. Die Mutter versucht zu helfen, die Freundin Leo. Mit vereinter Kraft gelangt sie dann auf einen Pfad, der zu einer Gesundung führt, einer Rekonvaleszenz. Für mich ist das in erster Linie eine Geschichte über Heilung – oder eher Gesundung. Healing Journey sagt man im Englischen.“
Eine vorläufige Heilung…
„Das ist im Englischen so schön, weil der Begriff den Prozess beinhaltet. Healing Journey. Wir können nie vollständig heilen, das ist dynamisch, dem Körper kann immer was passieren.“
Hast du für das Buch auch mit Patientinnen gesprochen und in der Recherche Dinge erfahren, die du nie für möglich gehalten hättest?
„Es sind in erster Linie tatsächlich meine eigenen Erfahrungen, das kann ich ehrlich sagen, die sind aber auch nicht unerheblich in der Anzahl.
Es gibt hier und da kleine Details aus dem Leben Anderer, mit denen ich gearbeitet habe, weil sie mich nicht losgelassen haben. Ich hatte überlegt, breiter zu recherchieren, aber dann wäre die Gewichtung gekippt. Das Körper- und Krankheitsthema ist ein mächtiger Strang im Buch, aber nicht das allein Bestimmende, auch weil Ela sich weigern würde, sich damit zu identifizieren. Sie will nicht krank sein. Sie würde wahrscheinlich nicht mal sagen, dass sie chronisch krank ist.“
Ihre Krankheiten sind nicht offen sichtbar. Aber sie ist chronisch krank.
„Genau. Man sieht nichts. Ihr Drama ist ein unsichtbares Drama, das immer wieder neu ausgefochten werden muss. Es ist interessant, weil diese Krankheiten in der Literarur eher selten dargestellt werden. Es gibt die dramatischen Geschichten – Krebs oder MS –, die wichtig sind. Aber dieses Leiden, das Ela hat, ist eines, die so viele Frauen haben, und das fliegt unter dem Radar, weil es nicht so laut, nicht so hinderlich ist, dass man nicht mehr funktioniert. Diese Körper und Frauen funktionieren ja alle. Ich glaube, deshalb wird all das auch nicht erzählt – oder für nicht erzählenswert oder dramatisch genug befunden –, weil es nicht unmittelbar Stöcke ins Getriebe wirft.“
Du hast in einem Interview gesagt, dass das Kind in „Lügen über meine Mutter“ weiß, dass es weiß, aber noch nicht weiß, was es weiß. Gilt das auch für dich im Schreibprozess? Dass du jetzt, nach dem Verfassen des Buches, weißt, was du weißt, im Vergleich zu vorher, wo du die Sprache dafür noch nicht hattest?
„Ja, in vielerlei Hinsicht würde ich das sagen. Ich kenne, wie viele Menschen, dieses große Glück, wenn ich endlich ein Wort für etwas finde, womit ich mich lange herumgeplagt habe. Oder wenn ich entdecke: Es ist ein allgemeingültigeres Phänomen, es betrifft nicht nur mich allein betrifft. Wir können gemeinsam darüber sprechen uns austauschen … das ist eine so ermächtigende Praxis.
Es ist ja auch gut erforscht, dass Frauen länger leben, weil sie über ihre Körper und Krankheiten sprechen und nicht nicht darüber sprechen. Das, was du vorhin mit der Gruppe von Frauen erzählt hast, die ihre Narben teilen – das wird vom Patriarchat gerne in diese Selbsthilfe-Ecke gestellt. Und wenn ein Wort abgeschafft gehört, dann bitte ,Selbsthilfe’. Es sind Überlebenstechniken.
Ich lasse nicht mehr zu, dass man das Frauen sagt oder, wenn ich es beobachte, interveniere ich. Sie betreiben keine Selbsthilfe, sie versuchen irgendwie, ihre Körper und Seelen vor dieser Struktur zu retten.“
Ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Dani.
Buchtipp: Daniela Dröscher: „Junge Frau mit Katze“, Kiepenheuer & Witsch Verlag, 24 Euro. Mehr erfahren.