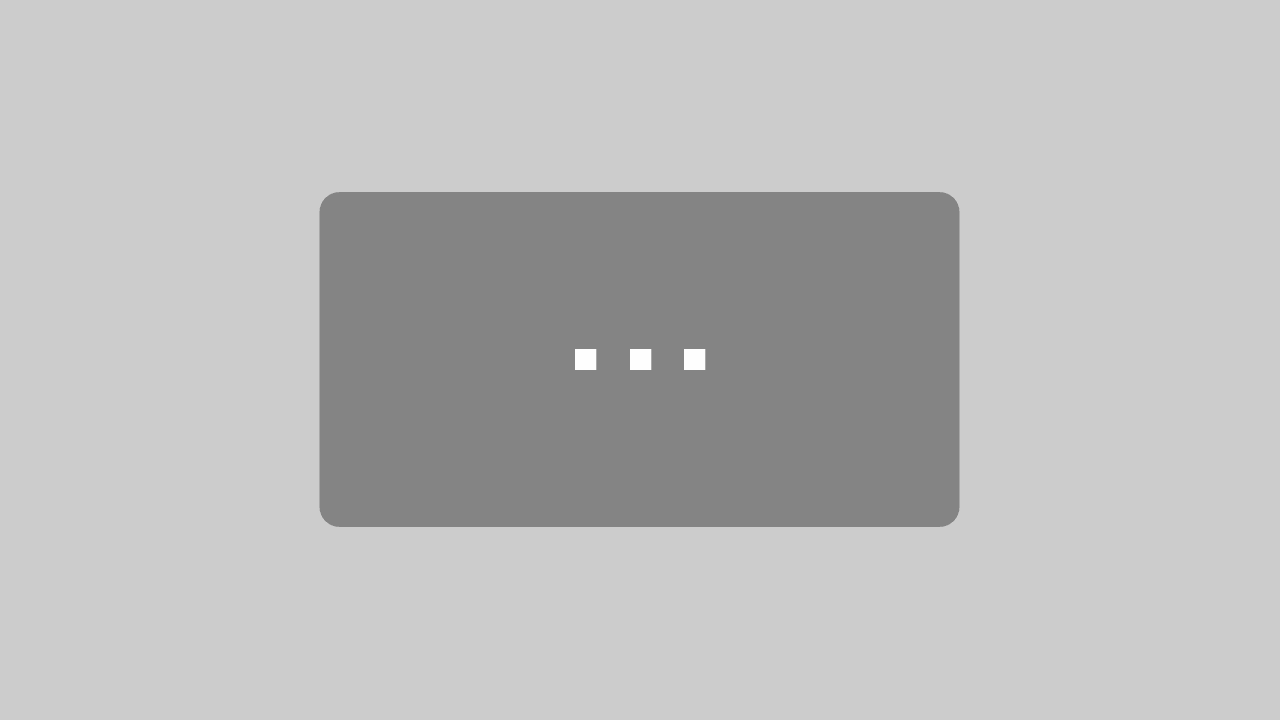Die Netflix-Serie „Dear White People“ will über Rassismus aufklären. Die Reaktionen darauf zeigen, dass das nötig ist.
Schwarze an amerikanischen Elite-Universitäten – eine Seltenheit
An den Elite-Universitäten, den so genannten Ivy-League-Colleges wie Harvard und Yale, sind schwarze Menschen eine verschwindend kleine Minderheit, während in der ökonomisch benachteiligten Gruppe der amerikanischen Gesellschaft die schwarze Bevölkerung überwiegt. Hier knüpft die Serie „Dear White People“ an, deren Dreh und Angelpunkt die gleichnamige Radioshow ist, die in dem fiktiven Ivy-League-College „Winchester“ spielt. Darin erklärt die Protagonistin Samantha White, gespielt von Logan Browning, wie sich Weiße gegenüber Schwarzen verhalten sollten, was okay ist und was nicht. Das N-Wort – jeder weiß was gemeint ist – sollte zum Beispiel auf gar keinen Fall von Weißen benutzt werden.
Dabei bewegt sich die Storyline der Serie vor allen Dingen um eine so genannte „Black-facing“-Party, die von einer einschlägigen, sprich konservativen, weißen männlichen Studentenverbindung organisiert wird. Der Aufhänger der Party sind also weiße Studierende, dich sich ihre Gesichter braun oder schwarz anmalen und sich ,wie Schwarze‘ kleiden – was auch immer das bedeuten soll. Obwohl die Party bereits in der ersten Folge gezeigt wird, erscheinen durch die Staffel hinweg immer wieder Rückblenden zu ihr. Denn sie sorgt gleich aus mehreren Gründen für Aufregung, nicht nur zwischen Weißen und Schwarzen, sondern auch innerhalb der Gruppen.
Während die etwas versnobte Coco (Antoinette Robertson) nicht glauben möchte, dass hinter der Party böse Absichten stecken und sie als einzige Schwarze die Party sogar mitfeiert, sieht Sam in dieser Party die umfassende Veranschaulichung der schwarzen Unterdrückung. Diese Diskrepanz führt zu unzähligen Diskussionen und erreicht ihren Höhepunkt schließlich in einer Protestdemo in der Uni gegen die Unterdrückung der Schwarzen.
Obwohl es zwischen diesen beiden weit auseinanderliegenden Ansichten viele Nuancen gibt, bedeutet die Positionierung zur Party den Bruch zwischen vielen Charakteren. Denn während der ebenfalls schwarze Sohn des Dekans Troy Fairbanks (Brandon P. Bell) zu lasche Konsequenzen für die Organisatoren der Party fordert, um den Vorstellungen seines Vater gerecht zu werden, zerreißt sich der für die Unizeitung schreibende Lionel Higgins (DeRon Horton) zwischen journalistischer Neutralität und persönlicher Meinung.
Gibt es umgekehrten Rassismus?
Obwohl „Dear White People“ Rassismus thematisiert, steht die Pointe an mancher Stelle im Vordergrund, denn die Serie ist dem Comedy-Genre zuzuordnen. In den USA reagierten viele Menschen dennoch schon auf den ersten Trailer zornig, was sich allein schon in den knapp 40.000 Dislikes im Vergleich zu 20.000 Likes bei Youtube manifestiert.
Besonders häufig wurde die Serie in Kommentaren beschuldigt wurde, „Rassismus gegen Weiße“ zu verbreiten und weiße Menschen damit ebenso zu degradieren, wie es ihnen Schwarze andersherum vorwerfen. Ein bekannter White-Power-Aktivist schrieb auf Twitter, aufgrund der Serie seinen Netflix-Account zu canceln. Der Grund dafür sei, dass die Serie „weißen Genozid propagiere“. Damit scheint er der Pflicht der White-Supremacy gerecht werden zu wollen. Denn geht man nach der Definition dieser Gruppe betrachten sich Weiße anderen „Rassen“ gegenüber nicht nur als grundsätzlich überlegen, sie müssen diese Ansicht auch anders Denkenden gegenüber verteidigen.

Quelle: Baked Alaska | Twitter
Leider kann dieser Post und erst recht nicht die gesamte Bewegung einfach ignoriert und als Trollattacke verharmlost werden. Der Ku-Klux-Klan oder die so genannten Alt-Right-Bewegung sind nicht nur intellektueller Unterschlupf, sie sind gefährlich.
Deutschenfeindlichkeit?
In Deutschland hingegen erfährt die Serie bislang vor allem positive Resonanz. Die FAZ lobt, dass die Serie „in alle Richtungen austeilt“. ZEIT Online gefällt besonders, dass „ein Gegenwartsphänomen vielstimmig und komplex aus unterschiedlichen schwarzen Perspektiven“ beleuchtet werde. Aber die Brücke zu Deutschland schlagen die Autoren nicht deutlich. Denn auch in Deutschland gab es bereits eine Debatte zu Rassismus gegen Deutsche. Noch vor der Flüchtlingswelle beklagte die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) 2010 die „Deutschenfeindlichkeit“ an Schulen. Angeblich wurden weiße Schüler aufgrund ihrer Herkunft gemobbt. Dass hier weder Statistiken noch Untersuchungen herangezogen wurden, wie der Grünen Politiker Sven Christian Kindler kritisierte und die taz weiter erörterte – geschenkt.
Selbst im Karneval darf man nicht alles
Leider hört es hier mit den Parallelen zu den USA und der Serie nicht auf. Auch das oben beschriebene Black-Facing ist in Deutschland nach wie vor ein Problem, das immer wieder verharmlost wird. Der „Verstehen Sie Spaß“ Moderator Cuido Cantz ließ sich für einen Sketch schwarz anmalen, die Lippen voller und die Nase breiter modellieren um „authentisch schwarz“ herüber zu kommen. Eigentlich hätte bereits hier einer der Verantwortlichen bemerken müssen, wie unpassend diese ganze Inszenierung war – es fiel niemandem auf. Die Gefühle schwarzer Menschen wurden lieber ignoriert und damit dann auch die Bitte der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), die sich in einem offenen Brief an die Redaktion des SWRs wandte. Darin hat die Organisation gebeten den Sketch nicht zu senden, da „Bilder von als dümmlich dargestellten Afrikanern“ reproduziert würden. Die Message kam anscheinend nicht an, denn der Clip wurde gesendet und ist immer noch auf Youtube zu finden.
Und selbst die LINKEN haben das Problem des Black-Facings scheinbar nicht verstanden. Zumindest bewies dies die Linken-Politikerin Jeannine Röster, als sie in diesem Jahr auf einer Partys als schwarz angemalte „Ureinwohnerin“ zu finden war. Es passe ja so schön zum Thema „Dschungel“ der Karnevalsparty, war dazu ihre eher schlechte Entschuldigung. Denn was für die Karnevalisten Spaß ist, spiegelt die häufig karikaturhafte und etwas minderbemittelte Darstellung, die Versklavung und Herabwürdigung von Schwarzen wieder.
Genau hier liegt das Problem, denn selbst wenn die einzige Intention der Verkleidung Spaß ist, hört dieser für die Betroffenen auf, sobald ihre Gefühle verletzt werden. Dass der Spaß bei solch einer Darstellung recht schnell endet, sollte jedem einleuchten. Denn wer sich schon an Begriffen wie „deutsche Kartoffel“ stört, wie Frau Schröder, sollte verstehen, wie erniedrigend der stetige Vergleich mit Urmenschen ist.
Zensur oder Kampf gegen Rassismus
Auch in deutschen Kinderbuchfassungen ist Rassismus noch häufig zu finden. In Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Büchern war noch in den Auflagen bis 2007 zu lesen, dass Pippis Papa ein „N*könig“ sei. Auch wenn die meisten Pippi kennen werden, hier noch mal zur Erinnerung: Weder Pippi noch ihr Vater sind schwarz. In anderen Worten war er ein Kolonialist, der die Einheimischen unterdrückte.
Astrid Lindgren lebte zu einer anderen Zeit und ist bekannt für ihren Einsatz für Minderheiten, für den sie den Right Livelihood Award erhielt. Trotzdem müssen ihre Werke und besonders ihre nicht mehr zeitgemäßen Personenbeschreibungen wie das N-Wort oder „Zigeuner“ nicht weiter verwendet werden.
Auch „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler wurde in einer Jubiläums-Neuauflage auf Wunsch vieler Eltern, aber auch ausdrücklich auf den des Autors, geändert. Hierbei wurden die „N*lein“ beim Karneval im Wald zu „Messerwerfern“ umgeändert. Eine merkwürdige Umwandlung könnte man meinen. Laut der Tageszeitung „Die Welt“ berufe sich der Autor bei der Änderung nicht nur darauf, dass das N-Wort heute ausschließlich in rassistischen Kontexten gebräuchlich wäre, sondern auch auf seine 1998 aufgestellte Maxime: „Der Autor muss sich darüber im Klaren sein, welche sprachlichen Formen er beispielsweise einem Sechs- oder Siebenjährigen zumuten kann.“ Diese sprachlichen Formen sollten die Sechs- oder Siebenjährigen am besten auch ohne weiteres selbstständig verstehen.
Leider übersehen nicht nur „besorgte Bürger“ das Noble dieser Änderung, sondern auch Menschen wie der ansonsten sehr geschätzte Literaturkritiker Denis Scheck. Dieser enttarnte seine vorgestrigen Ansichten zur antirassistischen Sprachentwicklung in seiner ARD-Sendung „Druckfrisch“ nicht nur mit einer generellen Kritik an der Kinderbuchdebatte, sondern setzte mit einem schwarz angemalten Haupt und den weiß behandschuhten Händen der ganzen Szenerie noch die Krone auf. Spiegel Online bringt die Geschmacklosigkeit auf den Punkt „Sein schwarzes Gesicht ist sozusagen, die visuelle Repräsentation dessen, was in der Kinderbuch Debatte Land auf, Land ab gefordert worden ist: das Festhalten an Begriffen, deren rassistischer Ursprung unbestritten ist.“
Worte formen unser Weltbild
Die Autorin Sharon Dodua Otto, die seit Jahren in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv ist, greift die Maxime Preußlers auf und kritisiert in der taz, dass Begriffe in Kinderbüchern nicht weiter erläutert würden. Kinder bekämen so den Eindruck, dass diese Begriffe ohne weitere Probleme im Alltag benutzt werden dürften.
„Bei Rassismus geht es nicht um die Intention, sondern um Wirkung. Er schafft ein System, in dem Ungerechtigkeiten und Gewalt ausgeübt und verharmlost werden. Rassismus ist auch schädlich für weiße Personen. Sie sind weniger bereit, empathisch zu sein.“
Wer sich also gegen die Änderung dieser Begriffe in Kinderbüchern sträubt, diese sogar als Zensur bezeichnet, setzt sich nicht nur für den Erhalt eines Kulturguts in seiner ursprünglichen Form ein, sondern auch für einen rassistischen Sprachgebrauch. Denn Sprache formt unser Weltbild und wollen wir wirklich unseren Kindern beibringen, dass manche Menschen weniger wert sind als andere? Und wenn uns in diesen Zeiten die Abgrenzung von Trumps Amerika wichtig erscheint, sollten wir uns dann nicht wirklich im Verhalten von eben diesen unterscheiden?
Eben aus diesen Gründen lohnt es sich auch für deutsche Zuschauer einen Blick in „Dear White People“ zu riskieren. Wir können so erfahren, wie scheinbar kleine Gesten, Worte oder auch nur Blicke einen Unterschied für Menschen machen können, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Vielleicht könnte uns die Serie auch einen empathischeren Blick auf die Debatten geben, die wir in unserem Land führen. Es könnte uns dabei helfen, zu verstehen, dass unsere Freiheiten dort aufhören, wo die Gefühle anderer verletzt werden.
Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von der Serie machen: