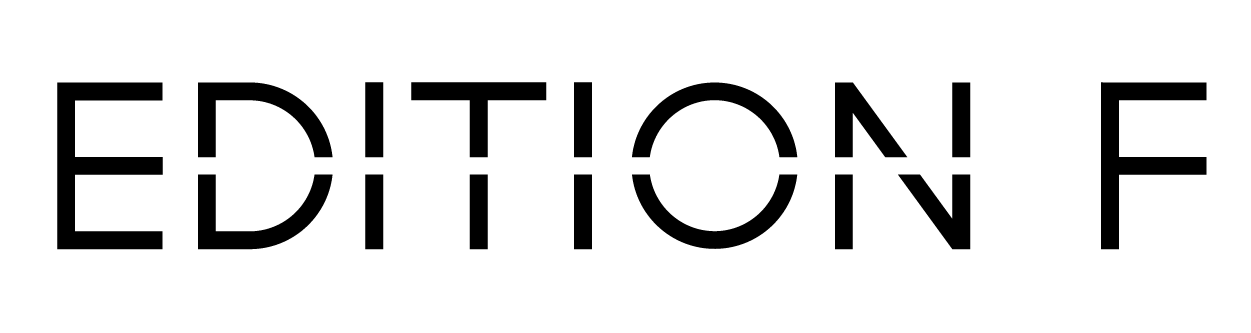Der Bundesrat hat dem Gewalthilfegesetz am 14. Februar 2025 zugestimmt. Das Gesetz soll den Zugang zu Frauenhäusern und Beratungsstellen verbessern und langfristig die Finanzierung von Schutzangeboten sichern. Aber es hat auch Lücken.
Geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt ist nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem. Allein im Jahr 2023 wurden in Deutschland 360 Frauen und Mädchen durch ihre (Ex-)Partner getötet (von 938 versuchten Femiziden) – fast jeden Tag ein Femizid. Das Gewalthilfegesetz ist ein entscheidender Schritt, um die Unterstützung für Betroffene auszubauen und den Schutz vor Gewalt zu stärken.
Bundesweiter Anspruch auf Hilfe
Mit dem neuen Gesetz erhalten gewaltbetroffene Frauen künftig einen bundesweit geltenden, kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das bedeutet, dass sie unabhängig von ihrem Wohnort Zugang zu Frauenhäusern oder Beratungsstellen bekommen. Der Bund wird sich mit 2,6 Milliarden Euro bis 2036 an den Kosten beteiligen, um den Ausbau der Schutzangebote zu unterstützen.
Zentrale Maßnahmen des Gesetzes:
- Mehr Frauenhausplätze und Beratungsangebote
- Kostenfreier Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe
- Finanzielle Beteiligung des Bundes an Frauenhäusern und Beratungsstellen
- Vereinheitlichung von Standards in Schutz- und Hilfseinrichtungen
- Förderung von Präventionsmaßnahmen und Täterarbeit
Frauenrechtsorganisationen begrüßen das Gesetz als längst überfälligen Schritt zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, die Deutschland verpflichtet, umfassende Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu ergreifen.
Die Istanbul-Konvention
Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie wurde am 11. Mai 2011 in Istanbul von 13 Staaten unterzeichnet, daher der Name „Istanbul-Konvention“.
Hauptziele der Konvention sind:
• Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen
• Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen
• Diskriminierung von Frauen zu verhindern
• Die Rechte von Frauen zu stärken
Die Konvention definiert Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung und erkennt sie als Ausdruck eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses an. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten zu umfassenden Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Schutz der Betroffenen, Strafverfolgung und einer koordinierten Politik.
Die Istanbul-Konvention trat am 1. August 2014 international in Kraft, nachdem sie von zehn Ländern ratifiziert wurde. In Deutschland ist sie seit dem 1. Februar 2018 geltendes Recht.
Gewaltschutz für alle? – Kritik am Ausschluss von trans, inter und nicht-binären Personen
Während das Gesetz für viele Gewaltbetroffene ein Fortschritt ist, wird es auch kritisiert. Trans, inter und nicht-binäre Personen wurden aus dem Schutzbereich ausgeschlossen. Ursprünglich sollte das Gesetz explizit für alle Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt gelten, doch auf Druck der Union wurden trans, inter und nicht-binäre Personen aus dem Gesetzestext entfernt.
Der Bundesverband Trans* kritisiert, dass die CDU durch diese Entscheidung Gewaltopfer gegeneinander ausspielt: „Die Union hat den Schutz von trans*, inter* und nicht-binären Personen verhindert und gleichzeitig den Schutz von cis Frauen als Druckmittel genutzt.“ – Zwar können Frauenhäuser weiterhin selbst entscheiden, ob sie trans* Frauen aufnehmen, doch die Gesetzesformulierung überlässt diese Entscheidung nun den einzelnen Einrichtungen.
Im Interview gegenüber EDITION F sagte die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Paula Panke e.V., der drei barrierearme Schutzwohnungen für von Gewalt betroffene Personen anbietet, Nadja Bungard: „Mit der Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes erkennen die Gesetzgeber*innen ein stückweit an, dass wir es mit einem strukturellen gesellschaftlichen Problem zu tun haben und dass hier dringender Handlungsbedarf besteht (…) Leider hat es Lücken: TIN* Personen sind ausgenommen. Sie sind, ähnlich wie Personen mit Behinderung, stärker von Gewalt betroffen und haben zu wenig Schutz.“
Prekäre Situation geflüchteter und von Gewalt betroffener Frauen und Kinder
Der aktuelle Gesetzentwurf ignoriert darüber hinaus die bestehende Diskriminierung insbesondere geflüchteter und über den Familiennachzug eingewanderter Frauen beim Zugang zu Schutzräumen. Andrea Kothen, Referentin von PRO ASYL, fordert daher: „Die Ungleichbehandlung von gewaltbetroffenen Frauen muss dringend korrigiert werden. Gerade geflüchtete Frauen und Kinder in Asylverfahren leben oft in besonders prekären Situationen und brauchen dringend einen besseren Zugang zu Schutz vor Gewalt. Das ergibt sich auch aus der Istanbul Konvention, die den Staat verpflichtet, ausnahmslos alle Frauen vor Gewalt zu schützen. Wer in einem Gewalthilfegesetz versäumt, die Hürden für geflüchtete Frauen zu Schutz anzugehen, akzeptiert den Zustand ihrer erhöhten Gefährdung.“
In einem gemeinsamen Statement bezeichnen auch PRO ASYL, DaMigra und die Zentrale Informationsstelle Autonome Frauenhäuser (ZIF) das Gewalthilfegesetz als wichtigen Meilenstein in der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Sie fordern aber ganz klar Nachbesserung: Das Gesetz müsse allen Frauen, inter, trans, nicht-binären Personen und Menschen mit Behinderung ein gewaltfreies und sicheres Leben ermöglichen.
Angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks und steigender Zahlen trans*feindlicher Gewalt fordern Menschenrechtsorganisationen eine nachträgliche Korrektur des Gesetzes, um wirklich alle Gewaltbetroffenen zu schützen.
Ein Fortschritt mit offenen Fragen
Das Gewalthilfegesetz schafft eine rechtliche Grundlage für mehr Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer Gewalt – doch es wirft auch neue Herausforderungen auf. Während der flächendeckende Ausbau von Frauenhäusern und Beratungsstellen ein wichtiger Schritt ist, bleibt die Frage offen, ob der Schutz von Gewaltopfern in Deutschland wirklich für alle Betroffenen gesichert ist.
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ berät von Gewalt betroffene Frauen unter der Rufnummer 116 016 und online zu allen Formen von Gewalt – rund um die Uhr und kostenfrei. Die Beratung erfolgt anonym, vertraulich, barrierefrei und in 18 Fremdsprachen. Auf Wunsch vermitteln die Beraterinnen an eine Unterstützungseinrichtung vor Ort. Auch Menschen aus dem sozialem Umfeld Betroffener und Fachkräfte können das Beratungsangebot in Anspruch nehmen.