Dr. Anatol Stefanowitsch ist Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und setzt sich regelmäßig mit politisch korrekter Sprache auseinander. Wir haben ihn zum Interview getroffen.
Eine Frage der Moral
Der Sprachwissenschaftler Dr. Anatol Stefanowitsch beschäftigt sich in seinem Buch „Eine Frage der Moral: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen (Duden-Streitschrift)“ mit politisch korrekter und gendergerechter Sprache. Im Interview spricht er über die Effekte diskriminierender Sprache, warum Frauen sich mit dem generischen Maskulinum nicht mitgemeint fühlen und erklärt, wie wir mit seiner goldenen Regel für den Sprachgebrauch, Sprache für uns alle fairer machen können.
Sie haben im Januar gemeinsam mit einer Jury den Anglizismus des Jahres gewählt: das Wort Gendersternchen. Können Sie erklären, wie es zu dieser Entscheidung kam?
„Wir können seit einigen Jahren beobachten, dass das Wort ,Gender‘ im allgemeinen Sprachgebrauch an Häufigkeit zunimmt, weil die verschiedenen Themen, die damit zusammenhängen in der Gesellschaft präsenter geworden sind. Eigentlich hätten wir gerne das Verb ,gendern‘ zum Anglizismus des Jahres gewählt, aber das ist ausgerechnet im Jahr 2018 wieder seltener geworden. Um das Wort trotzdem zu würdigen, haben wir uns für das Wort Gendersternchen entschieden. Das Wort Gendersternchen ist 2015 aus dem Nichts aufgetaucht und hat 2018 einen riesigen Häufigkeitssprung gemacht.“
Das Thema geschlechtergerechte Sprache erhitzt die Gemüter. Es gibt viele Menschen, die sich gegen das Gendern im allgemeinen Sprachgebrauch stellen und die damit argumentieren, dass das generische Maskulinum ausreichen würde, da Frauen ja immer mitgemeint seien.
„Wir wissen aus 20 Jahren Forschung, dass das generische Maskulinum als Maskulinum interpretiert wird und nicht generisch. Um es generisch zu interpretieren, müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein, und selbst dann bleibt sehr häufig eine Doppeldeutigkeit übrig. Das bedeutet, dass Frauen beim traditionellen, generischen Maskulinum nie wissen, ob sie eigentlich mitgemeint sind. Das erzeugt eine ständige, erhöhte Anforderung an die Aufmerksamkeit von Frauen. Und es führt dazu, dass Frauen sich tatsächlich sehr häufig unbewusst nicht mitgemeint fühlen, obwohl sie es vielleicht sind. Es gibt eine Studie meiner Kollegin, Bettina Hannover, die gezeigt hat, dass Mädchen sich Berufe weniger zutrauen, wenn die Berufsbezeichnungen im generischen Maskulinum präsentiert werden. Obwohl sie wissen, dass sie theoretisch mitgemeint sind. Ein Individuum kann darauf pochen, das generische Maskulinum weiter zu verwenden, aber gesellschaftlich relevante Akteur*innen können sich nicht so verhalten. Das ist ein Scheitern von sprachlicher Inklusion.“
Bei der Debatte um geschlechtergerechte und politisch korrekte Sprache wird oft der Vorwurf geäußert, es gäbe erst einmal wichtigere Baustellen. Gleichzeitig gibt es diesen berühmten Spruch: Sprache schafft Realitäten. Inwiefern glauben Sie, dass der Sprachgebrauch auch ein erster Schritt sein kann, um gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten?
„Der sprachliche Schritt ist vergleichsweise einfach und kostengünstig umzusetzen. Die Frage, ob Sprache Realitäten schafft, ist aber eine sehr komplizierte. Ich habe das Gefühl, dass viele Aktivist*innen, die in dem Bereich tätig sind, sich das ein bisschen zu einfach vorstellen. Genauso wie Kritiker*innen glauben, dass, wenn wir es zulassen, dass sich die Sprache verändert, sie automatisch in ihrem Denken beeinflusst werden. So funktioniert das natürlich nicht. Es würde sowohl gute als auch schlechte Dinge stark vereinfachen, wenn man mit Sprache so stark manipulieren könnte. Der Effekt, den die Sprache auf das Denken hat, ist klein und eher kumulativ. Nicht jedes Mal, wenn das generische Maskulinum verwendet wird, wird automatisch das Patriarchat zementiert. Wenn das aber den ganzen Tag, regelmäßig passiert, dann verfestigt es eine bestimmte Denkweise, bei der Frauen im besten Fall mitgedacht sind. Frauen müssen aber nicht mitgedacht, sondern gleichwertig gedacht werden.“
Und bei Menschen mit nicht-binären Identitäten?
„Da gilt dasselbe. Mit sprachlichen Mitteln ist es hier aber noch weniger getan als bei Frauen. Der Kampf um das Mitdenken von Frauen und der Kampf um das Mitdenken von Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten dürfen zwar nicht voneinander getrennt werden, wir dürfen aber nicht so tun, als ob die zu jedem Zeitpunkt mit den gleichen Mitteln und in der gleichen Geschwindigkeit vorangetrieben werden können. Es gibt viele Leute, die nicht glauben, dass es andere geschlechtliche Identitäten gibt, und solange die Leute nicht überzeugt sind, werden wir das Gendersternchen zwar benutzen können, um ein Bewusstsein zu schaffen, aber wir werden es nicht nutzen können, um spontan Mitdenken zu erzeugen.
Bei Frauen ist das anders. Alle sind sich einig, dass es Frauen gibt. Wenn ich binär gendere, indem ich zum Beispiel einfach eine Doppelformel verwende, dann werden Frauen automatisch mitgedacht. Das ist in der Psychologie nachgewiesen worden. Das Mitdenken von Frauen ist also eigentlich eine sehr leichte Aufgabe. Wir müssen die vorhandenen sprachlichen Mittel nur systematisch anwenden. Nicht-binäre Geschlechtsidentitäten werden dagegen nicht einfach mitgedacht, indem ich ein Sternchen oder ein anderes Symbol in ein Wort reinschreibe. Da ist ein gesellschaftlicher Diskussionsprozess nötig, um sie überhaupt erst mal anzuerkennen.“
Eine Vermutung, die Sie in Ihrem Buch äußern, ist, dass Kritiker*innen politisch korrekter Sprache glauben, „dass durch diskriminierende Sprache kein tatsächlicher Schaden entstehe.” Können Sie das genauer erklären?
„Aus der psychologischen Forschung wissen wir, dass die ständige Überrepräsentation von Männern und dem generischen Maskulinum dazu führt, dass wir die Überrepräsentation in unsere Wahrnehmung mit einberechnen. Die sogenannten Privilegien, die man als Mitglied der Kategorie Männer hat, sehen wir deshalb gar nicht, weil wir die mental schon ausgleichen. Einen ähnlichen Effekt gibt es bei diskriminierender Sprache. Die einzelne Diskriminierung, das eine Mal, wo ich mit einem rassistischen, sexistischen, ableistischen Wort bezeichnet werde, wird mich in meinem Selbstverständnis nicht unbedingt angreifen. Wenn das aber ständig vorkommt, wenn es kumulativ über den Tag verteilt in allen möglichen Situationen auftaucht, vielleicht an unerwarteten Stellen, dann kann das psychologische- bis hin zu körperlichen Effekten haben. Aus US-Studien wissen wir, wer regelmäßig solcher Sprache ausgesetzt ist, zieht sich oftmals aus öffentlichen Diskursen zurück, leidet eher an psychischen Problemen und hat mehr Selbstzweifel.
Jede*r, die*der selber regelmäßig Diskriminierung erlebt, weiß aus Erfahrung, dass das Schaden anrichtet. Die Leute, die sagen, sie glauben das nicht, sind meist weiße Menschen, oft sind es Männer. Mal sind es auch weiße Frauen, die die Misogynie, die sie jeden Tag erleben, halb internalisiert, halb abgeblockt haben, sodass sie sie zumindest nicht wahrnehmen. Die Leute, die das nie erleben, oder die nicht verstehen, wie man durch Sprache getroffen werden kann, müssten eigentlich einen Perspektivwechsel vollziehen. Interessanterweise sind sie es, die ganz empört sind, wenn man die Geschichte einmal umdreht. Weiße Männer zum Beispiel. Wenn ich ,weißer Mann‘ sage, dann ist das erst mal einfach nur eine Beschreibung. Trotzdem finden sie es unverschämt, wenn man sie als Weiße auf ihre Hautfarbe oder ihr Geschlecht aufmerksam macht. Da merken sie plötzlich, wie es sich anfühlt durch einen Begriff von einem Individuum auf das Mitglied einer Kategorie reduziert zu werden.“
Sie sprechen den Perspektivwechsel an. Die goldene Regel, die Sie auch in „Eine Frage der Moral“ zitieren. Im Buch hat sich die für mich auch als Aufruf zur Empathie gelesen.
„Es geht in gewisser Weise um Respekt. Respekt bedeutet, dass ich die andere Person als gleichwertig anerkenne. Daran scheitert dieser Perspektivwechsel sehr schnell, nämlich, wenn ich glaube, dass ich den für mich alleine vollziehen kann. Wenn ich glaube, ich kann mich als weißer, heterosexueller Mann hinsetzen und mich hineinversetzen in Homosexuelle, in Schwarze Menschen, in Frauen oder behinderte Menschen. Und wenn ich dann beschließe, dass mir bestimmte Wörter in ihrer Situation egal wären. Das Bewusstsein, dass mir das alles gar nicht passieren kann, kann ich aber aus der Gleichung nicht herausnehmen.
Der Perspektivwechsel kann ein erster Schritt sein, um zu erkennen, dass ich mich mit einer bestimmten Gruppe bisher überhaupt nicht beschäftigt habe. Es ist ein guter Ansporn sich zu fragen, warum ich eigentlich niemanden aus dieser diskriminierten Gruppe kenne. Die Antwort darauf wird ein erster Hinweis auf bestimmte strukturelle Diskriminierung sein. Der entscheidende Schritt beim Perspektivwechsel ist dann zu schauen, wie die betroffene Gruppe zum Gebrauch bestimmter Wörter steht.“
Sie selbst sagen, dass eine Institutionalisierung vom Gendersternchen nicht der richtige Weg wäre?
„Aus zwei Gründen. Zum einen wird das Gendersternchen, und man sieht das schon bei Behörden in Berlin, relativ gedankenlos benutzt. Die Leute freuen sich, dass es ein Patentrezept gibt und sie über geschlechtergerechte, geschlechtsneutrale, geschlechterinklusive Formulierungen gar nicht mehr nachdenken müssen. Das Gendersternchen wird einfach automatisiert verwendet. Es beendet eine Diskussion, die eigentlich geführt werden müsste.
Das zweite Problem ist, dass ich nichts mehr über die Person weiß, die das gerade verwendet. Ich weiß nur, dass es der Person vorgeschrieben wurde. Das, was eigentlich erzeugt werden soll, nämlich, dass durch das Gendersternchen ganz explizit Menschen mit nicht- binären Geschlechtsidentitäten mitangesprochen werden sollen, das erfolgt meist nicht.
Anders als die Genderlücke, die eine lange Geschichte hat, taucht das Gendersternchen relativ plötzlich im Sprachgebrauch auf. Es ist vermutlich deshalb so beliebt, weil es kaum auffällt. Man kann es ohne großen Aufwand einfach überlesen und das ist die Gefahr. Damit solche Formen funktionieren können, müssen sie stören und so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es im Deutschen ein Problem gibt: die Abwesenheit von geschlechtsneutralen Formen. Ich will mich gerne eines Besseren belehren lassen, wenn das Sternchen sich durchsetzt und die Leute wirklich zum Nachdenken anregt. Ich glaube aber nicht so recht daran. Es ist nicht der richtige Weg, Behörden zu zwingen, das obligatorisch zu verwenden, weil es Diskussionen im Keim erstickt. Solange die nicht stattfinden, wird dieses Gendersternchen aber auch nicht die gewünschte Bedeutung bekommen.“
Sie schreiben in Ihrem Buch: „Im Wortschatz des Deutschen (und anderer Sprachen) gibt es (…) ein drastisches Ungleichgewicht bezüglich des abwertenden Wortschatzes zur Bezeichnung diskriminierter Gruppen (sogenannter Minderheiten) auf der einen Seite und nicht-diskriminierter Gruppen (der Mehrheit) auf der anderen.“ Ist Sprache auch Mittel, um bestimmte Machtstrukturen aufrecht zu erhalten?
„Ich denke schon, dass, wenn ich Leute regelmäßig dazu anhalte, Frauen und Männer mental gleich zu repräsentieren, dass das über die Zeit auch etwas mit deren Nachdenken über diese Kategorien machen wird. Solange ich das nicht tue, wird es auf jeden Fall sehr schwer, materiellen Wandel herzustellen. Solange ich traditionelle Sprachmuster, ob es das generische Maskulinum ist oder verschiedene Formen rassistischer, ableistischer Sprache weiterverwende, stütze ich das bereits existierende System.
Es ist schwer, außerhalb dieses Systems zu denken. Alles andere wirkt irgendwie komisch, weil es nicht unserem üblichen Sprachgebrauch entspricht. Die Diskussionen, die wir um die Verwendung von Doppelformeln oder anderen sprachlichen Muster haben, die nicht-binäre Geschlechtsidentitäten einschließen oder rassistische Sprache vermeiden, führen nicht unbedingt dazu, dass ich anders über bestimmte Gruppen nachdenke. Sie sind aber auf jeden Fall Vorbedingung dafür. Auf individueller Ebene öffnen sie überhaupt erst das Denken für andere Arten der Repräsentation. Auf gesellschaftlicher Ebene, würde ich den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken sowieso etwas anders fassen. Da geht es nicht darum, was in meinem Gehirn gerade passiert und wie ich das im Labor experimentell nachweise, sondern es geht um die gesellschaftlichen Prozesse, die zwischen Menschen stattfinden, die keinen direkten Zugang zu den Gedanken des jeweils anderen haben. Sprache ist die einzige Möglichkeit, sich zu verständigen. Sie erlaubt es die eigenen Gedanken über sprachliche Strukturen zu synchronisieren und eine gemeinsame Zielstellung zu verfolgen. Wenn Menschen ein Werkzeug haben, in dem bestimmte Ungleichheiten schon strukturell in den Wortschatz eingebaut sind, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Strukturen auch ins gemeinsame Nachdenken mit einfließen. Das gemeinsame Nachdenken über Dinge ist durch diese sprachliche Asymmetrie stark beeinträchtigt.“
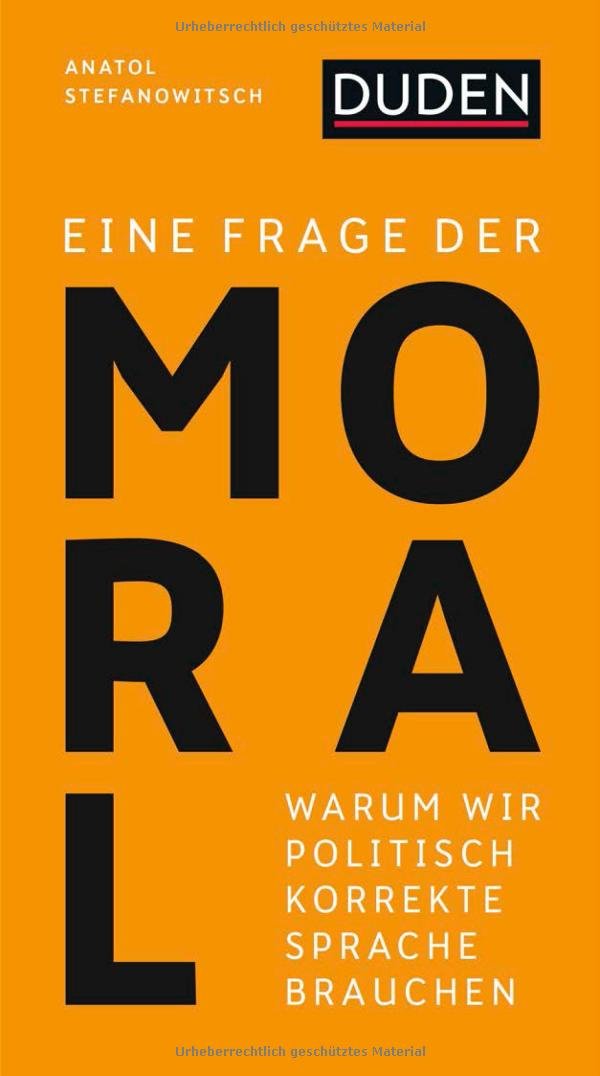
Anatol Stefanowitsch, Eine Frage der Moral: Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen (Duden-Streitschrift), DUDEN, 64 Seiten, 8 Euro.
Das Buch ist natürlich auch bei lokalen Buchhändler*innen eures Vertrauens zu finden. Support your local Book-Dealer!
Mehr bei EDITION F
Eigentlich ziemlich leicht – ein Beginner’s Guide für faire Sprache. Weiterlesen
Marlies Krämer will kein „Kunde“ sein – und ist auch sonst Deutschlands hartnäckigste Stimme für Frauenrechte. Weiterlesen
Ein wirklich guter Tipp, wie man mit Rassisten umgehen sollte. Weiterlesen


