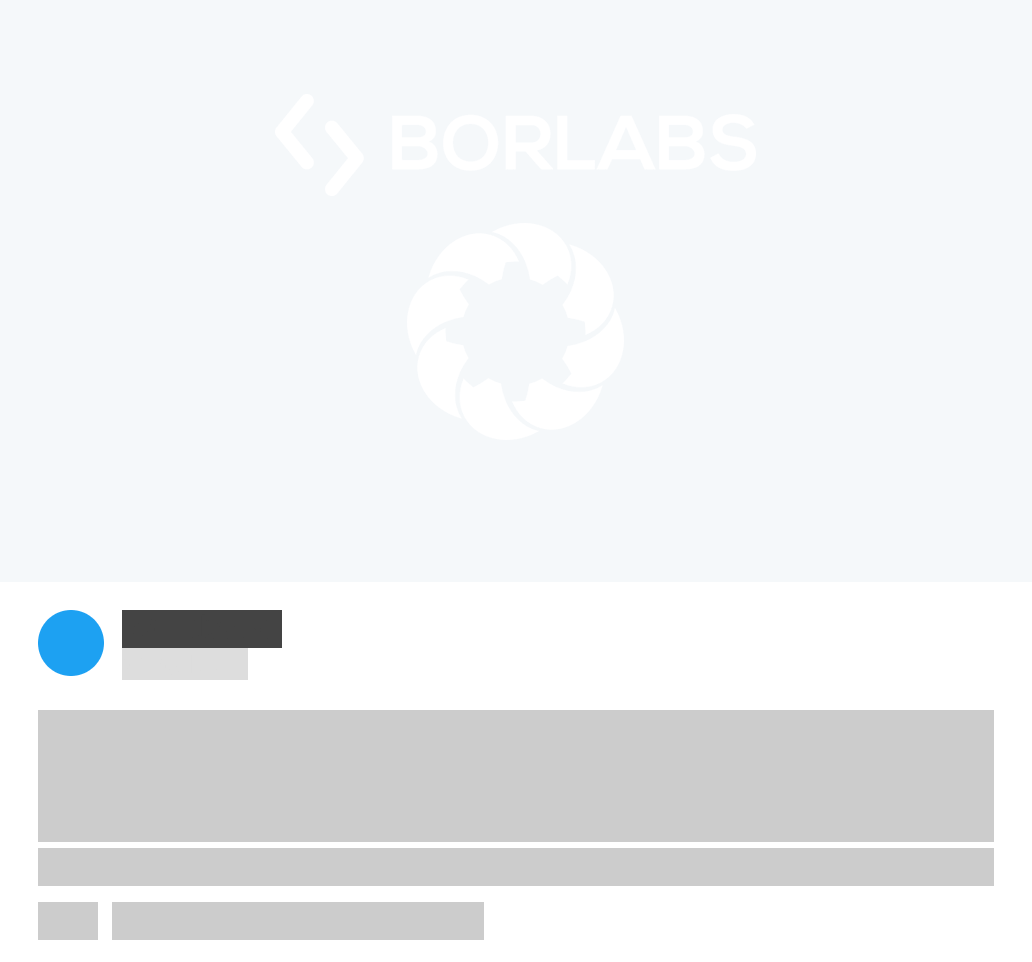Ein Gremium aus 24 Experten und zwei Expertinnen hat empfohlen, Kitas und Grundschulen erst nach den Sommerferien wieder zu öffnen. Was bedeutet das für berufstätige Eltern? Unsere Autorin hat gerechnet. Ergebnis: Ein Tag braucht 29 Stunden.
In einer 19-seitigen Stellungnahme geben 26 Forscher*innen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Handlungsempfehlungen, wie unser Leben mit Corona weitergehen soll. Die Kitas und Grundschulen sollen laut „Leopoldina” bis nach den Sommerferien für den Großteil der Kinder geschlossen bleiben, während Cafés und Restaurants öffnen dürfen. Als Mutter fühle ich mich – mal wieder – alleine gelassen mit meinem persönlichen „Hobby“: Kinder.
Wie soll das alles gehen? Müssen Eltern jetzt reihenweise – vermutlich meist die Mütter – ihre Jobs kündigen oder sich noch vier Monate lang in den Burn-Out arbeiten? Und was genau ist dann im August anders? Wer garantiert uns, dass es gesamtgesellschaftlich dann vertretbar ist, dass alle Kinder wieder in ihre Gruppen und Klassen zurück können? Und was, wenn nicht?
Finanzielle Unterstützung? Fehlanzeige
In dem Papier des Gremiums, bestehend aus 24 Männern und zwei Frauen, gibt es einen kleinen Satz, der da lautet: „Dies setzt voraus, dass berufstätige Eltern weiterhin durch eine sehr flexible Handhabung von Arbeitszeiten und -orten sowie finanziell unterstützt werden.”
Das klingt fast beruhigend – allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sich das Expertengremium bewusst ist über das Ausmaß des Betreuungsproblems und damit auch über das Ausmaß an notwendiger Unterstützung. Die Empfehlungen zur schrittweisen Öffnung von Schulen und Kitas werden nämlich nur unter bildungspolitischen Gesichtspunkten argumentiert.
Die wesentlichen Funktionen der Schule sind laut Experten-Gremium: „a) die auf das Lernen bezogene Strukturierung des Alltags, b) der das Lernen unterstützende und die gesellschaftliche Teilhabe einübende soziale Austausch mit Gleichaltrigen und Lehrkräften, c) die professionelle Rückmeldung auf Lernfortschritte.” Folgerichtig lautet die Empfehlung, immer diejenigen zuerst wieder in die Bildungseinrichtungen zu schicken, die vor einem Wechsel stehen: Die Kindergartenkinder, die dieses Jahr eingeschult werden, die Grundschüler*innen, die auf eine weiterführende Schule gehen werden, diejenigen, die mit einem Abschluss von der Schule gehen sollen. Dabei wird kein Unterschied zwischen Berufsschule oder Kindergarten gemacht. Allen Lernenden soll ermöglicht werden, weiter zu kommen. Das ist ein schlüssiges Konzept; allerdings eines, das nicht berücksichtigt, dass die meisten Entscheidungen zur Einschulung oder zur weiterführenden Schule schon vor Ostern durch waren.
Bildungsungerechtigkeit
Als Argument für dieses Vorgehen wird betont, dass es um Bildungsgerechtigkeit ginge und man damit besonders die Schüler*innen unterstützen möchte, die aus sogenannten bildungsfernen Familien kämen. Nicht bedacht wird hingegen, dass nun Kleinkinder in der intensivsten Zeit des Spracherwerbs monatelang allein auf ihre Herkunftsfamilien angewiesen sind. Das Erlernen der deutschen Sprache ist allerdings Grundvoraussetzung für Bildungsgerechtigkeit.
Die vierte wesentliche Funktion von Bildungseinrichtungen für Kinder wurde völlig vergessen: Die altersgemäße Betreuung.
In der Bundesrepublik gehen etwa 700.000 Kleinkinder von 0-3 Jahren in eine für sie geeignete Bildungseinrichtung und dort werden immer maximal fünf Kinder von einer Fachkraft betreut. Bei den 3-6-Jährigen sind es zwei Millionen Kinder, von denen jeweils zehn Kinder von einer Fachkraft betreut werden. In der Grundschule sind es 2,8 Millionen Schüler*innen in Klassengrößen von rund 20 Kindern. Die 4.-Klässler*innen sollen laut Leopoldina zwar demnächst wieder zur Schule gehen, aber erst wenn der Bund genügend Mund-Nasen-Schutzmasken für die Kinder hat und klar ist, wie man die Klassen teilt. Durch die Logistik des Schulwegs und die kurze Zeit des Unterrichts, macht das vermutlich keinen Unterschied zum aktuellen Aufwand von Eltern.
Wenn wir jetzt einfach mal im Regelbetrieb annehmen, dass all diese Kinder sechs Stunden pro Tag professionell betreut werden, leisten Fachkräfte circa 14,4 Millionen Kinderbetreuungsstunden die Woche – die sie möglichst pädagogisch wertvoll füllen.
Mindestlohn für betreuende Eltern
Wenn wir weiter davon ausgehen, dass diese 5,5 Millionen Kinder jetzt im Schnitt 1:2 betreut werden, also immer zwei Geschwister zwischen 0-11 Jahren auf ein Elternteil, dann explodiert die Zahl der Kinderbetreuungsstunden auf 82,5 Millionen Stunden pro Woche. Das ist fast das Sechsfache an Betreuungsstunden, die in dieser Altersgruppe von irgendjemandem geleistet werden müssen. Wenn man da Mindestlohn für den betreuenden Elternteil ansetzen würde …
Und ja. Natürlich kann man die Wäsche falten, während ein Kind spielt und das andere mithilft, aber dafür muss jetzt jeden Mittag für alle gekocht werden und das Aufräumen wird auch nicht weniger, wenn permanent alle zu Hause sind. Zudem waren die meisten Familien vorher auch schon sehr effizient organisiert. Woher sollen also all diese Stunden jetzt auf einmal kommen? Der Tag hat auch für Eltern in Corona-Zeiten nur 24 Stunden.
Noch eine Rechnung:
Ein Elternpaar hat pro Tag 48 Stunden zur Verfügung.
16 Stunden Schlaf
14 Stunden Kinderbetreuung
16 Stunden Lohnarbeit
5,5 Stunden Hausarbeit
1,5 Stunden Körperpflege
Das sind schon fünf Stunden mehr, als ein Tag hat. Noch nicht inbegriffen: Nachrichten zu Corona lesen, neue Kindersandalen kaufen, mit Freund*in telefonieren, die Winterklamotten wegräumen, joggen gehen oder einfach in Ruhe aufs Klo. Und wer macht eigentlich die Steuererklärung bis zum 31. Juli?
Wenn man nur noch zwei Mal pro Woche duscht, die Spülmaschine einräumt, während man einen Corona-Podcast hört oder Twitter liest, während sich die Kinder kurz zehn Minuten selbst beschäftigen, kann man natürlich Zeit sparen. Aber das machen wir ja alle eh schon.
Eltern-Reha? Von wegen!
Ich kenne ein Paar, das eine Nachtschicht zum Arbeiten eingebaut hat, weil dann alle vier Kinder schlafen. Oder Paare, bei denen eine*r um 20 Uhr ins Bett geht und um drei Uhr wieder aufsteht, um ungestört arbeiten zu können und eine*r arbeitet bis zwei Uhr nachts und schläft dann etwas länger.
Und ja, das geht vielleicht auch mal ein paar Wochen. Mit Verbiegen und Raubbau am eigenen Körper. Aber mindestens fünf Monate? Und danach ist ja nicht Eltern-Reha angesagt, sondern alles geht weiter.
Und das geht sowieso alles nur, wenn beide im Homeoffice sind und nicht beide Arbeitgeber*innen meinen, es gäbe eine Kernarbeitszeit von neun bis 15 Uhr oder Meetings, die irgendwann am Tag angesetzt sind. Was ist, wenn die Geschäfte alle wieder öffnen und die Verkäufer*innen dort wieder ihrer Arbeit nachgehen? Wo bleiben ihre Kinder? Bisher dürfen ja nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen in die Notbetreuung. Wenn jetzt aber auch Eltern mit nicht-systemrelevanten und nicht-homeofficetauglichen Berufen wieder arbeiten sollen? Werden die dann alle gekündigt?
An Alleinerziehende denkt dieses Szenario gar nicht. Sie können derzeit noch nicht mal einkaufen gehen, wenn das Kind nicht alleine zu Hause bleiben kann.
Care-Arbeit ist Arbeit
In der öffentlichen Wahrnehmung muss sich einiges ändern. Wir müssen auch private Care-Arbeit als Arbeitsstunden denken und mit einkalkulieren, auch wenn sie bisher nicht bezahlt und deswegen auch nicht erfasst wurde.
Man kann Kinderbetreuung nicht reduzieren. Kinder sind so lange wach, wie sie wach sind und müssen in dieser Zeit betreut sein. Auch Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen und rudimentäre Körperpflege müssen einfach passieren.
Im aktuellen Szenario kann die einzige Lösung sein, Lohnarbeitsstunden zu reduzieren – auch gegen den Willen von Arbeitgeber*innen. Der Staat sollte einen Lohausgleich zahlen, quasi ein Corona-Notelterngeld. Und es wird sich, solange Väter nicht im selben Maße reduzieren, wieder negativ auf die Erwerbsbiografien von Müttern auswirken – bis hin zur Rente.
Alternative: Man gibt halt doch der deutlich effizienteren Kinderbetreuung durch Bildungseinrichtungen den Vorrang vor anderen Lockerungsmaßnamen – so wie Dänemark das jetzt wohl vorhat. Deren einzige Lockerungsmaßnahme besteht darin, alle Angebote für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit wieder in Betrieb zu nehmen.
Kinder als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Vielleicht könnte man auch im ersten Schritt alle Bildungseinrichtungen mit weniger als 25 Menschen wieder öffnen. Egal ob Berufsschule, Tagesmutter oder Dorfschule.
Kinder groß zu ziehen sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Und so wie wir die Aufgabe, die Risikogruppen zu schützen, gemeinsam lösen, müssen wir auch das Problem der Kinderbetreuung öffentlich und gemeinsam lösen. Es darf nicht ein stilles Privatproblem von Eltern mit kleinen Kindern bleiben.
Anmerkung der Redaktion: Für Sorgeberechtigte, die wegen der Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht arbeiten können, gibt es einen Entschädigungsanspruch. Voraussetzung dafür ist, dass Sorgeberechtigte einen Verdienstausfall erleiden, der allein auf dem Umstand beruht, dass sie infolge der Schließung der Kita oder Schule ihre betreuungsbedürftigen Kinder selbst betreuen und ihrer Erwerbstätigkeit deswegen nicht nachgehen können. Informationen dazu findet ihr auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.