Die österreichische Soziologin Laura Wiesböck hat ein Buch über Selbst- und Fremdwahrnehmung in unserer Gesellschaft geschrieben. Ein Interview.
„Es gibt Diskussionsrunden über Feminismus, bei denen keine einzige Frau anwesend ist”
Wie fällen wir eigentlich Urteile über andere Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Soziologin Laura Wiesböck in ihrem Buch: „In besserer Gesellschaft. Der selbstgerechte Blick auf die Anderen” aus acht verschiedenen Perspektiven. Unter Schwerpunkten wie „Arbeit”, „Geschlecht“ oder „Einwanderung” zeigt sie auf, wie abwertend wir oft auf bestimmte Teile unserer Gesellschaft blicken, ohne den Hintergrund und die sozialen Konstruktionen dahinter in den Blick zu nehmen. Das führt dazu, dass wir, sagt Laura Wiesböck, zum Beispiel nicht die Arbeitslosigkeit bekämpfen, sondern Arbeitslose.
Das Buch analysiert diese Abwertungsprozesse und macht deutlich, warum es wichtig ist, dass unsere Diskurse vielfältiger und inklusiver werden. Wir haben mit der Autorin über den selbstgerechten eigenen Blick, die Absurdität des Mantras „Do what you love” und verhinderte Solidarisierungsprozesse gesprochen.
Der Untertitel Ihres Buches lautet: „der selbstgerechte Blick auf die Anderen” – Was genau meinen Sie mit diesem Blick?
„Ich würde mich nicht an dem Begriff ,selbstgerecht’ festnageln wollen. Es geht darum, dass man auf andere Personen gerne herabschaut bzw. sich anderen Personengruppen gegenüber nicht nur abgrenzt, sondern auch erhebt, um sich ein positives Selbstbild zu erschaffen. Man könnte auch sagen: der abwertende Blick’ oder ,der selbsterhöhende’ Blick. Etwas, das in allen Gesellschaftsschichten, in allen Milieus, unabhängig vom Bildungsstand, stattfindet.”
Und wenn Abgrenzung zur Abwertung wird, wird es problematisch.
„Weil es dann dazu kommen kann, dass man anderen Personengruppen gewisse Rechte, die soziale Absicherung, ein würdevolles Leben oder Empathie verwehrt. Das können wir aktuell im Bereich Arbeitslosigkeit beobachten. Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen werden abgewertet: Sie seien faul, schmutzig oder würden es sich in der ,sozialen Hängematte‘ bequem machen. Ein Beispiel dafür sind ,Scripted Reality’-Formate, die Arbeitslose bewusst als übergewichtige, unhygienische, faule Menschen darstellen. Das sind Abwertungen, die reale Konsequenzen für die betroffenen Personen haben können, zum Beispiel auf sozialpolitischer Ebene. Bekämpft wird heute nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosen. Auch im Bereich Flucht und Migration können wir ähnliches beobachten.”
Werten denn nur „stärkere” Gruppen „schwächere” ab?
„Nein, das geht in alle Richtungen. Das Interessante ist, dass abwertende Zuschreibungen auch von Betroffenen selbst übernommen werden. Abwertungen können eine starke Wirkungskraft haben und Solidarisierungsprozesse hemmen. Das ist aus demokratiepolitischer Sicht problematisch. Es gibt zum Beispiel Arbeitslose, die das Image der Sozialschmarotzer*innen verankert haben und damit nicht identifiziert werden wollen und sich deshalb von denjenigen innerhalb ihrer Gruppe abgrenzen, die vermeintlich faul sind. Ähnliches gibt es auch bei Migration zu beobachten. Migrant*innen, die rechtspopulistische Parteien wählen, um sich von jenen abzugrenzen, die sich scheinbar nicht integrieren wollen, um sich dadurch zu den ,Integrierten’ zu machen.”
„Die Frage aber ist: Wer kann sich das eigentlich leisten, für wen ist es möglich, seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen?”
In ihrem Kapitel über die Arbeitswelt dekonstruieren Sie die Formel „Do what you love”. Was hat diese eigentlich mit einem selbstgerechten Blick auf die Anderen zu tun?
„Prinzipiell kann man beobachten, dass es in bestimmten Milieus eine Hierarchisierung von Jobs gibt. Man macht entweder etwas Interessantes, das ist meistens etwas Kreatives, etwas mit dem man sich selbst verwirklicht, oder man macht einen nicht so interessanten Job. Damit wird meistens ein regulärer Brotjob verbunden, der ausgeübt wird, um seine Miete bezahlen zu können. Der wird aber nicht so hoch angesehen. Die Frage aber ist: Wer kann sich das eigentlich leisten, für wen ist es möglich, seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen?”
Ja, wer kann das?
„Für finanziell abgesicherte Personen ist das natürlich einfacher als für Personen, die diese Sicherheit nicht haben. Diese eigene privilegierte Position wird von diesen Menschen oft nicht gesehen und thematisiert. Personen, die nicht aus diesen privilegierten Umständen kommen, sind sich der Hierarchisierung aber häufig sehr stark bewusst. Und trotzdem wird ihnen zum Beispiel durch ,Inspirational Quotes’ auf Instagram suggeriert, wenn sie es nicht schaffen, selbst dafür verantwortlich zu sein. Es wird also ein individueller Fokus gesetzt. Es gibt aber auch zahlreiche strukturelle Faktoren für Erfolg, das fängt allein dabei an, welchen Habitus man hat, wie man auftritt, ob man es gewohnt ist, sich in einem bestimmten Umfeld zu bewegen. Zum erfolgreichen Subjekt wird man, wenn man kommerziell erfolgreich ist. Das kann zu einem großen Druck für Menschen werden. Bis hin zu Depressionen. Es gibt soziologische Ansätze, die zeigen, dass es heute mehr Depressionserkrankungen gibt, weil ein stärkerer Druck auf den Individuen liegt.”
Wie äußert sich dieser Druck zum Beispiel?
„Heute gibt es enorm viele Möglichkeiten, tatsächlich und scheinbar. Es wird vermittelt, dass das Individuum selbst dafür verantwortlich ist, dass es erfolgreich und glücklich ist. Egal ob in einer Beziehung, im Beruf oder am Wohnungsmarkt. Der individuelle Fokus zeigt sich auch in der Sprache, zum Beispiel wenn es im Job oder der Liebe nicht klappt: ,I made a poor choice’. Man könnte auch sagen, dass sich Dinge anders entwickelt haben oder man Pech hatte. Dieser Fokus auf das Individuum und die Ausblendung von strukturellen Faktoren gilt es also kritisch zu betrachten.”
Genau dieses „Alles ist möglich”-Mantra kritisieren Sie in Ihrem Buch und sagen: „Gleichheit ist ein Mythos”. Warum? Und wie kann es sich ändern?
„Aus soziologischer Perspektive ist es wichtig zu sehen, dass sich Klassenkämpfe nicht nur auf rein ökonomischer Ebene vollziehen, sondern auch auf einer symbolischen. Die zeigt sich dadurch, dass gewisse Praktiken oder Produkte als höherwertig angesehen werden. Beispiele wären: Musikgeschmack, Essensgewohnheiten oder Kleidungsstile. Im Bereich Konsum und Nachhaltigkeit können wir hier neue Formen der Abgrenzung beobachten, eine Art gefühlte moralische Überlegenheit. Auch unbewusst.
Einerseits würde ich deshalb sagen, dass man versuchen könnte selbstgerechte Blicke auf andere durch selbstkritische Blicke zu ersetzen. Was ich auch wichtig fände: dass man sich nicht als wahrheitsbesitzende, sondern als wahrheitssuchende Person erkennt. Wenn das jede*r machen würde, hätten wir viel gewonnen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, sich mit Personen, die außerhalb der eigenen Interessensgruppe liegen, zu solidarisieren. Davon sind wir weit entfernt. Ob das jetzt zum Beispiel Arbeiter*innen aus Osteuropa sind oder Trans-Personen – durch Solidarität würde ein stärkeres Gefühl der Gleichwertigkeit aufkommen.”
Das heißt, eine Möglichkeit dieses Ungleichgewicht aufzubrechen wäre es auch, die Diskurse diverser zu gestalten?
„Ja, und die Personen am Diskurs teilhaben zu lassen. Oft spricht man ja nur über die Personengruppen, aber nicht mit ihnen. Es gibt Diskussionsrunden über Feminismus, bei denen keine einzige Frau anwesend ist. Das gleiche gilt für unterschiedliche Themen wie Islam, Migration oder Arbeitslosigkeit.”
„Die Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, auszublenden, schafft Sicherheit.”
Sie gehen in ihrem Buch auch auf die „Gerechtigkeitshypothese” ein, vereinfacht gesagt, der Glaube, dass Menschen im Leben das bekommen, was sie verdienen. Wie macht sich das heute bemerkbar?
„Im Vergleich zu den 1970er Jahren leben wir in einer deutlich komplexer scheinenden und tatsächlich komplexeren Welt. Wir leben in transnational agierenden Nationalstaaten, in einer globalisierten Welt. Zentrale Unsicherheiten im Bereich Wohlfahrtsstaat, Familie und Arbeitsmarkt haben zugenommen: prekäre Beschäftigungen, Teilzeitarbeit, Befristungen steigen an. Die Absicherungsfunktion von Erwerbsarbeit hat abgenommen. Und wir sind mit mehr Informationen konfrontiert, die aus allen möglichen Kanälen fluten. All das zusammengenommen verstärkt das Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion. Wenn man sich jetzt die Gerechtigkeitshypothese ansieht, ist auch das eine Art der Komplexitätsreduktion wie auch der Versuch die eigenen Ängste einzudämmen, weil man denkt, dass einem selbst gewisse Dinge nicht passieren werden, weil man sich ja ,richtig’ verhält. Die Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, auszublenden, schafft Sicherheit. Auch Feindbilder und Verschwörungstheorien sind Formen dieser Komplexitätsreduktion.”
„Ich kann und sollte verstehen, wie es zu rassistischen Haltungen kommt, aber ich sollte kein Verständnis haben für rassistische Aussagen oder Handlungen.”
Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Analyse?
„Ich komme aus einer wissenschaftlichen Perspektive, mein Anspruch ist es Gesellschaftskritik zu üben und bestimmte gesellschaftliche Phänomene aufzuzeigen. Was dann jede*r einzelne damit macht, würde ich mir nicht anmaßen, vorzuschreiben. Das Ziel mündiger Bürger*innen sollte es aber sein, zu verstehen. Dass man zu dem Punkt kommt, zu versuchen, zu verstehen, warum jemand handelt wie er*sie handelt, ohne gleich in ,gut’ und ,schlecht’ zu kategorisieren. Das wird häufig damit verwechselt, Verständnis zu haben. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung: Ich kann und sollte verstehen, wie es zu rassistischen Haltungen kommt, aber ich sollte kein Verständnis haben für rassistische Aussagen oder Handlungen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Im Bildungsbürgertum gibt es oft die Idee, dass man der*die Hüter*in der Wahrheit sei, weil man nur die seriösen Medien lese und durch den eigenen Verstand zum richtigen Urteil kommt. Aber das trifft so nicht zu. Erst einmal suchen sich alle Menschen, die Medien, die einem entsprechen. Das nennt man konfirmatorische Informationssuche. Dadurch verstärkt sich die eigene Haltung. Zudem basiert eine bestimmte Meinung oder eine Haltung nicht automatisch auf Fakten. Wenn ich zum Beispiel lese: ,Menschen mit Migrationshintergrund sind vermehrt Bezieher*innen von Sozialleistungen’, dann ist das noch keine Meinung. Manche denken sich: ,Ja, ihre Bildungsabschlüsse werden nicht anerkannt und sie werden strukturell diskriminiert.’ Andere wiederum denken sich: ,Ja, die sind faul.” Ein Faktum per se ist nicht für die Haltung oder Meinung entscheidend.”
Soll man, Ihrer Meinung nach, also mit Rechten reden?
„Ich kann das nicht allgemein beantworten. Das kommt auf die Situation an und ob die Person prinzipiell bereitwillig ist zu reden. Ich würde kein generelles Plädoyer dafür oder dagegen halten. Ich würde auch nicht sagen, dass jede Person, die eine fremdenfeindliche Aussage trifft per se rechts ist. Das thematisiere ich auch in meinem Buch. Diese vorschnelle Labelzuschreibung finde ich problematisch, weil sie alle Aussagen unter dem Label subsumiert und damit einen konstruktiven Dialog verhindert. In jedem Fall gibt es aber auch Fälle, in denen ein Gespräch keinen Sinn macht.
Und an wen richtet sich ihr Buch?
„Es ist ein Sachbuch, das an eine breite Leser*innenschaft gerichtet ist. Ich sehe es als wichtige Aufgabe der Wissenschaft, insbesondere der Sozialwissenschaft, die Forschung an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Im deutschsprachigen Raum wird man leicht in die ,Populärwissenschaftliche Ecke’ gestellt, wenn man zugängliche Bücher schreibt. Ich bin da aber der englischsprachigen Tradition verbunden, wo das Gegenteil verpönt ist. Wenn man sich als Wissenschafter*in in den USA zu kompliziert ausdrückt, wird man nicht ernstgenommen, weil es bedeutet, dass man nicht verstanden hat, worum es geht. Das Prinzip, an das ich mich deshalb halte: Erst wenn man der Oma oder einem*einer Achtjährigen erklären kann, worum es geht, hat man eine Sachlage wirklich verstanden. Mir war es wichtig, mich an eine Öffentlichkeit ohne Vorwissen richten zu können. Was nicht heißt, dass das Buch nicht auch für Wissenschaftler*innen interessant sein kann.”
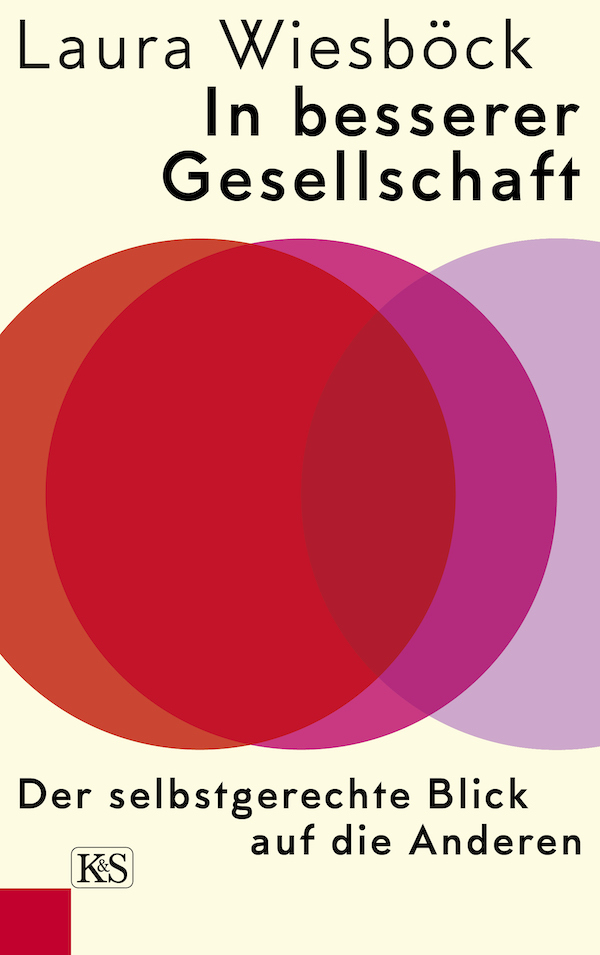
Laura Wiesböck: „In besserer Gesellschaft: Der selbstgerechte Blick auf die Anderen”, Kremayr & Scheriau, 192 Seiten, September 2018, 22 Euro.
Mehr bei EDITION F
Die Welt wird besser? Unterhaltet euch mal mit Menschen, die wirklich von Diskriminierung betroffen sind. Weiterlesen
Feierabend? Wie ständige Erreichbarkeit uns krank und unglücklich macht. Weiterlesen
Dilek Gürsoy: „Die meisten Menschen haben Stress, weil sie lieber alles alleine machen wollen.“ Weiterlesen


