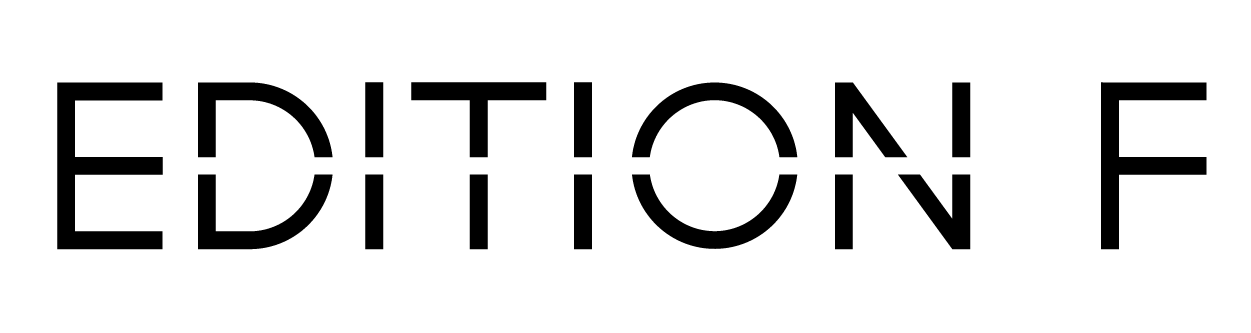Was passiert, wenn hunderttausend Mütter laut werden? Wenn sie am Muttertag keine Blumen wollen, sondern politische Veränderung? Ein Text über die Kampagne „Hundertausend Mütter“, eine kraftvolle Demonstration, die Care-Arbeit sichtbar macht, über Erschöpfung, Wut und die Forderung nach echter Gleichstellung.
„Komm weiter nach vorne!“, ruft meine siebenjährige Tochter und greift meine Hand. Wir rennen vorbei an dem weißen Kleinbus, aus dem die Musik kommt. Ganz nach vorne, dorthin, wo sechs Frauen ein Transparent tragen und schreien: „Wir sind Mütter, wir sind laut!“ „Survivor“ von Destiny’s Child begleitet den Chor. Auf dem Transparent steht rot auf rosa: „100 000 Mütter vor dem Brandenburger Tor!“ Wir demonstrieren gemeinsam. Einen Tag vor dem Muttertag.
Ich filme den Zug von vorne, erkenne von hier aus kein Ende der Menschenmenge. Familien, Kinder, FLINTA sind gekommen – und alle eint der Kampf für mehr Sichtbarkeit von Sorgearbeit und denen, die sie leisten, für Gleichberechtigung, für ein gerechtes Gesundheitssystem und für dieses Wort, das bisher für sehr viele Menschen nichts als Gerüst ist: Vereinbarkeit.
„Es ist nicht machbar“
Allein in der letzten Woche – in der „Muttertagswoche“ – habe ich im privaten Raum drei Gespräche mit Müttern geführt, die mir gegenüber saßen und vor allem eines sagten: Ich kann nicht mehr. Ihre Gestik und Mimik drückten Erschöpfung aus, die sie in unserem Gespräch offen zeigten. Und danach weitermachten. Funktionierten. Weil es erwartet wird und weil selten jemand danach fragt, wie das alles überhaupt möglich ist. Ich höre diese Sätze: „Es ist nicht machbar.“ – „Das schlechte Gewissen ist immer da.“ – „Er ist aggressiv, aber ich finde keine bezahlbare Wohnung.“ – „Ich bin krank, aber es gibt keine Hilfe, die Kinder brauchen mich.“
All ihre Gedanken, Sorgen, Sätze spiegeln sich in den Transparenten, die die Personen heute vom Monbijouplatz über die Friedrichstraße, Unter den Linden, bis zum Platz der Republik tragen. Sie spiegeln sich in der Wut, die die Sprechchöre lauter werden lässt. Sie spiegeln sich in der Kundgebung, vor der sich alle versammeln, die in ihrem Elternwerden und Elternsein unter den festzementierten patriarchalen Strukturen leiden. Strukturen, die von der Politik bislang nicht oder zu wenig aufgebrochen wurden.
„Ohne Mütter, ohne Hände
Ohne Gesellschaft, die wir tragen
Gäbe es dich nicht
Da, wo du bist.“
– Ela Fischer
Und so richtet sich die Poetin, Künstlerin, Musikerin und Vierfachmutter Ela Fischer gleich zu Beginn der Kundgebung an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz: „Ohne Mütter, ohne Hände / ohne Gesellschaft, die wir tragen / gäbe es dich nicht – da, wo du bist. / Wir Frauen, wir Mütter und all die, die versorgen,/ sind der Kitt, der Anstand und die Erkenntnis von morgen. / Wir tragen und halten und sind Expert*innen für alle Sorgen./ Ich will keine Blumen / Ich will Sicherheit und Respekt.“ Und sie schließt ab mit zwei Zeilen, die vom Publikum übernommen und in Richtung Bundestag wiederholt werden: „Wir wollen Zukunft, wir wollen Würde / Ohne Umweg und ohne Hürde.“
Geschichte des Muttertags
Wir demonstrieren hier einen Tag vor dem Muttertag. Der Muttertag, wie wir ihn heute kennen, ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Die entscheidenden Weichen wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch die amerikanische Frauenbewegung gelegt. Ann Maria Reeves Jarvis gründete 1865 die Bewegung „Mothers Friendships Day“, um Mütter zu vernetzen und soziale Missstände zu bekämpfen. Die eigentliche Begründerin des Muttertags ist aber ihre Tochter Anna Marie Jarvis: „Ich wollte, dass alle Mütter noch zu Lebzeiten geehrt werden.“ Am 12. Mai 1907 organisierte sie in Grafton, West Virginia, einen Gedenkgottesdienst, bei dem sie 500 weiße Nelken – die Lieblingsblumen ihrer Mutter – an andere Mütter verteilte.
Anna Jarvis’ Engagement führte dazu, dass der Muttertag schnell in vielen US-Bundesstaaten gefeiert wurde. 1914 erklärte Präsident Woodrow Wilson den zweiten Sonntag im Mai offiziell zum nationalen Ehrentag für Mütter. „Der Tag sollte helfen, die Rechte von Müttern und Frauen zu stärken“, betont Jarvis’ ursprüngliche Intention. Doch schon bald wurde der Feiertag zunehmend von Blumenhändlern und der Geschenkeindustrie vereinnahmt, was Jarvis zutiefst bedauerte: „Ich bereue, diesen Tag ins Leben gerufen zu haben“, äußerte sie später und kämpfte erfolglos gegen die Kommerzialisierung an.
„Der Tag sollte helfen, die Rechte von Müttern und Frauen zu stärken.“
– Anna Marie Jarvis, Begründerin des Muttertags
Der Ursprung des Muttertags liegt in der Sehnsucht nach Wertschätzung, Frieden und sozialem Zusammenhalt – und in einer Tochter, die das Andenken an ihre Mutter für alle sichtbar machen wollte. Und genau dafür gehen an diesem 10. Mai, einen Tag vor dem Muttertag, sehr viele Menschen, die jeden Tag unsichtbare Sorgearbeit leisten, auf die Straße, um am Ende im Namen von weit über hunderttausend Müttern, die an diesem Tag nicht vor Ort sein können, politische Forderungen zu übergeben. Forderungen für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft, die gewährleisten, dass Sorgearbeit leistende Menschen endlich in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Entscheidungen rücken:
Politische Forderungen der Hunderttausend Mütter
Uneingeschränkte Gleichstellung und Gleichberechtigung und die konsequente Einbeziehung von Müttern in sämtliche gesellschaftsrelevante Entscheidungen
Gleichstellung darf nicht an der Mutterschaft enden. Mütter und andere Care-Verantwortliche müssen auf allen Ebenen an gesellschaftlich relevanten Entscheidungen beteiligt werden – in der Politik, in Unternehmen, in Gremien. Damit das gelingt, braucht es vor allem eins: den Abbau struktureller Barrieren, die ihre Teilhabe behindern oder gar verhindern. Ein zentraler Schritt ist die konsequente Umsetzung der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW.
Wir brauchen einen ressortübergreifenden, nationalen Aktionsplan, der konkrete Gleichstellungsziele formuliert – messbar, nachvollziehbar, verbindlich. Politische Gremien müssen per Gesetz paritätisch besetzt sein. Familiäre Verpflichtungen dürfen kein Hinderungsgrund mehr für politisches Engagement sein – Sitzungszeiten, Formate und Vertretungsregelungen müssen familienfreundlich gestaltet werden.
Damit Gesetze künftig nicht mehr an den Lebensrealitäten von Frauen vorbeigehen, braucht es ein verpflichtendes Gender Impact Assessment. Gender Budgeting soll sicherstellen, dass finanzielle Mittel gerecht verteilt werden. Flexible Arbeitszeiten, betriebliche Kinderbetreuung, transparente Lohnstrukturen und gezielte Frauenförderung sind keine Sonderwünsche – sie sind der Schlüssel zu echter Gleichstellung. Und sie setzen ein wichtiges Zeichen für die Aufwertung von Care-Arbeit, auch im beruflichen Kontext.
Vielfalt von Müttern fördern, sichtbar machen und nutzen
Mütter sind nicht eine homogene Gruppe – sie sind so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Ihre Bedürfnisse, Erfahrungen und Lebensrealitäten unterscheiden sich je nach Herkunft, Einkommen, Bildung, Alter, Behinderung oder sexueller Identität. Und genau diese Vielfalt muss sichtbar werden. Sie muss nicht nur anerkannt, sondern in allen gesellschaftlichen Prozessen aktiv mitgedacht werden.
Das beginnt mit der konsequenten Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und reicht bis hin zu gezieltem Schutz vor Diskriminierung – ob rassistisch, sexistisch oder ableistisch. Besonders Care-Verantwortliche mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, BIPoC, LGBTQIA+-Personen oder mehrfach diskriminierte Gruppen brauchen niedrigschwellige, barrierefreie Unterstützungsangebote.
Bildungseinrichtungen müssen offen und sensibel für unterschiedliche Familienmodelle sein – und endlich anerkennen, dass Care-Arbeit kein „Frauenthema“, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist.
Gerechte Verteilung und Anerkennung von unbezahlter Care-Arbeit
Ohne unbezahlte Sorgearbeit funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Sie hält das soziale Gefüge zusammen – wird aber zu oft als selbstverständlich hingenommen und meist von Frauen übernommen. Es ist Zeit, diese Arbeit endlich gerecht zu verteilen und sichtbar zu machen. Dafür braucht es den Abbau patriarchaler Strukturen und mehr Unterstützung für partnerschaftliche Familienmodelle – etwa durch ein Elterngeldsystem mit festen, nicht übertragbaren Partnermonaten.
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege darf kein individuelles Problem sein, sondern muss strukturell gelöst werden: mit flexiblen Arbeitszeiten, ausreichender Kinderbetreuung und gezielten Unterstützungsangeboten. Wer Care-Arbeit leistet, darf im Alter nicht in Armut geraten – gerade Mütter brauchen finanzielle Absicherung. Das Ehegattensplitting, das überholte Rollenbilder zementiert, gehört abgeschafft. Stattdessen braucht es hochwertige, kostenlose und flächendeckende Bildungs- und Betreuungsangebote – als Basis für gerechte Chancen und echte Wahlfreiheit.
Der Gender Care Gap bezeichnet den Fakt, dass Frauen pro Tag durchschnittlich 79 Minuten mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Die Betreuung von Kindern und Angehörigen, die Planung der Familienaktivitäten und der Haushalt führen zu einem hohen Mental Load und bringen große finanzielle Nachteile mit sich. 50 Prozent der Frauen und nur etwa 13 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit – einer der Hauptfaktoren für einen Gender Pay Gap von 16 Prozent.
Dadurch haben viele Mütter nicht nur unmittelbar ein geringeres verfügbares Einkommen, sondern auch langfristig negative finanzielle Aussichten durch eine oft beträchtliche Rentenlücke. Die Bank Raisin zeigte in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf, welche Rücklagen Frauen und Männer im Alter von 40, 50 und 60 Jahren idealerweise aufgebaut haben sollten, um ihren Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Demnach sollte eine 40-jährige Frau mit durchschnittlichem Einkommen etwa 185.000 Euro angespart haben, während bei einem gleichaltrigen Mann rund 150.000 Euro ausreichen. „Es ist ein Dilemma, wenn man mit weniger verfügbarem Einkommen gleichzeitig für das Alter sparen soll“ erklärt Katharina Lüth von Raisin.
Ein diskriminierungsfreies und geschlechtersensibles Gesundheitssystem
Gesundheit darf keine Frage von Geschlecht oder sozialer Rolle sein. Ein gerechtes Gesundheitssystem muss die Bedarfe von Müttern und anderen Care-Arbeitenden frühzeitig erkennen, ernst nehmen und gezielt ausgleichen. Schon während der Schwangerschaft braucht es sensibel gestaltete Angebote. Dazu gehören eine bessere geburtshilfliche Versorgung, diskriminierungsfreie Zugänge zu Gesundheitsdiensten und traumasensible Strukturen.
Care-Arbeit bedeutet häufig eine doppelte Belastung – körperlich wie mental. Deshalb brauchen wir gezielte Entlastungssysteme, flächendeckende Mutter-Kind-Angebote in Kliniken und gut erreichbare Beratungsstellen, die Patient*innenrechte stärken. Mit einem nationalen Gesundheitsziel „Müttergesundheit“ ließen sich Bedürfnisse besser erfassen, Bedarfe gezielter erforschen und Angebote systematisch verbessern.
Schutz vor Gewalt und Diskriminierung
Gewalt gegen Frauen – ob physisch, psychisch oder ökonomisch – ist kein Randthema und keine Privatsache. Sie ist strukturelle Realität für viele Mütter und muss endlich konsequent bekämpft werden. Dafür braucht es sichere Zufluchtsorte, flächendeckende Prävention, gut ausgestattete Beratungsstellen und eine konsequente Strafverfolgung geschlechtsspezifischer Gewalt.
Auch psychische Gewalt und finanzielle Abhängigkeit müssen als Formen von Gewalt ernst genommen werden. Betroffene Frauen brauchen Zugang zu rechtlicher und psychologischer Unterstützung – schnell, niederschwellig und ohne Hürden. Prävention muss früh ansetzen: durch Aufklärung, Bildung und Sensibilisierung. Nur so lassen sich Gewaltkreisläufe durchbrechen.
Stärkung feministischer Zivilgesellschaft
Feministische Bewegungen sind das Rückgrat demokratischer Gesellschaften. Ihre Arbeit ist kein Bonus, sondern Grundvoraussetzung für sozialen Wandel. Doch genau diese Arbeit wird immer wieder infrage gestellt – finanziell, politisch, ideologisch.
Deshalb braucht es eine nachhaltige und verlässliche Förderung von Initiativen, die sich für Frauen- und Mütterrechte einsetzen. Ein Demokratiefördergesetz muss zivilgesellschaftliches Engagement strukturell absichern und antifeministischen Angriffen klar entgegentreten. Denn eine gerechte Gesellschaft braucht feministische Stimmen – laut, unabhängig und langfristig.
Die Forderungen im Detail kannst du hier bei „Hunderttausend Mütter“ nachlesen.