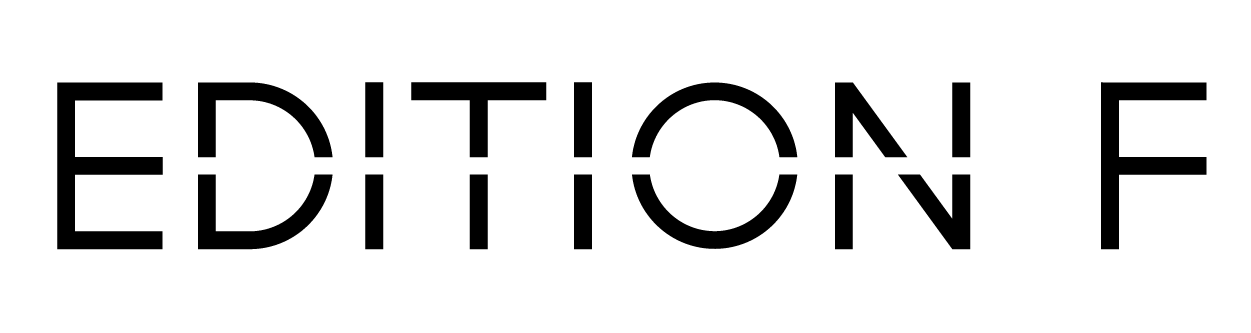In Folge 57 unseres Podcasts „Echt & Unzensiert“ spricht Journalistin und Autorin Anne Dittmann über ihr neues Buch „Jungs von heute, Männer von morgen: Was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen“.
Anne erklärt, warum es wichtig ist, Jungen anders zu erziehen. Sie spricht über das Konzept der „Caring Masculinity“, problematische Rollenbilder und den Ursprung traditioneller Männlichkeitsnormen. Außerdem geht es darum, warum Jungs oft Schwierigkeiten haben, Krisen zu bewältigen, und welche Gefahren hinter der Erziehung zum „starken Helden“ lauern.
Anne gibt praktische Tipps für Eltern, wie sie emotionale Stärke fördern können, und räumt mit Mythen wie „Jungs sind von Natur aus wilder“ auf. Auch die Faszination für Alpha-Männer wie Andrew Tate und deren Einfluss auf junge Männer wird thematisiert. Reinhören lohnt sich!
Die ganze Podcastfolge hörst du über einen Klick ins Titelbild oder eingebettet unten im Artikel und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Anne Dittmann liest du hier.
Liebe Anne, welche typisch männlichen Zuschreibungen empfindest du als besonders problematisch?
„Es gibt einen Fragebogen, der elf zentrale Merkmale misst – den sogenannten CMNI (Conformity to Masculine Norms Inventory). Der wurde bereits vor über 20 Jahren von Psycholog*innen entwickelt und gilt heute als recht zuverlässiges Instrument zur Erfassung männlicher Rollenvorstellungen. Natürlich variieren die Ausprägungen je nach Milieu oder Region. Manche Eigenschaften wie Dominanz sind recht universell. Andere – wie Risikobereitschaft oder der Wille zu gewinnen – erinnern eher an ein Managerprofil.
Die elf Eigenschaften, die in diesem Fragebogen erfasst werden, sind:
• Gewinnen wollen
• Emotionale Kontrolle
• Risikobereitschaft
• Gewalt
• Dominanz
• Playboy-Verhalten
• Selbstständigkeit
• Vorrang der Arbeit
• Macht über Frauen
• Geringschätzung von Homosexuellen
• Streben nach Status
Welche davon am problematischsten ist, lässt sich pauschal kaum sagen – das hängt stark vom Kontext ab. Doch es gibt etwa eine große australische Studie mit rund 20.000 befragten Männern, die gezeigt hat: Männer, die besonders stark auf Selbstständigkeit pochen, haben ein signifikant höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken.
Letztlich kann man sagen: Jede dieser Eigenschaften kann problematisch werden – vor allem, wenn sie überhöht wird oder andere Lebensbereiche dominiert. Wer seine Emotionen stark kontrolliert oder immer gewinnen muss, bekommt früher oder später Schwierigkeiten – im Innen wie im Außen.“
Woher kommen diese traditionell-männlichen Normen überhaupt? Sind das Ansichten, die seit Jahrhunderten stumpf weitergegeben wurden?
„Die australische Erziehungswissenschaftlerin R. W. Connell zeigt in ihrem Buch ‚Der gemachte Mann‘ zum Beispiel sehr anschaulich auf, wie sich Vorstellungen von Männlichkeit im Laufe der Geschichte verändert haben. Connell spricht in diesem Zusammenhang von ‚hegemonialer Männlichkeit‘ – also jener Form von Männlichkeit, die gesellschaftlich am meisten Anerkennung bringt, am erfolgreichsten ist und den höchsten Status verleiht.
Diese hegemoniale Männlichkeit hat sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt. Im Mittelalter waren es vielleicht Ritter, später einmal sogar Mönche, die als Ideal galten – enthaltsam, diszipliniert. Heute ist es der Geschäftsmann, der seit etwa 200 Jahren – mit Aufkommen des Kapitalismus und Kolonialismus – dieses Leitbild prägt. Er steht an der Spitze der männlichen Hierarchie, symbolisiert wirtschaftliche Macht, Kontrolle und Status.
Man kann sich dieses Ideal wie ein Schönheitsideal vorstellen: Wir wachsen damit auf, sehen in Medien, welche Männer abgebildet werden – und speichern das unbewusst ab.“
Welchen Einfluss hat dieses Leitbild auf Jungen?
„Studien zeigen, dass Grundschulkinder bereits ziemlich genau wissen, wer es später ‚schaffen‘ wird – und wer nicht. Kinder aus Akademikerfamilien erkennen früh, dass sie die nötigen Codes kennen: wie man spricht, wie man sich verhält, was von einem erwartet wird. Sie verstehen: Wenn ich mich so verhalte, werde ich später dafür belohnt.
Kinder aus anderen sozialen Milieus merken hingegen oft früh, dass ihr Verhalten, ihre Sprache, ihre Ausdrucksweise nicht mit dem übereinstimmt, was Schule oder Gesellschaft von ihnen erwartet. Das führt zu Frustration. Statt sich weiter anzupassen, gehen manche in den Widerstand – suchen andere Rollen, in denen sie trotzdem Selbstwirksamkeit, Selbstwert und Anerkennung erleben können. Auch wenn diese Rollen sie nicht auf einen klassischen Karriereweg führen, geben sie ihnen das Gefühl, gesehen zu werden.“
Forschungen haben ergeben, dass schon kleine Jungs Stress- oder Krisenzeiten schlechter bewältigen als Mädchen. Was genau bedeutet in diesem Zusammenhang ‚schlechter‘? Wie sieht männlicher Bewältigung denn oft aus?
„Leider erleben viele Jungen schon früh, dass sie ‚selbstständig‘ sein sollen. Selbstständigkeit ist eine tief verankerte Männlichkeitsnorm. Nach Hilfe zu fragen, wird ihnen nicht beigebracht – was absurd ist, denn wir alle nehmen als Erwachsene ständig Hilfe in Anspruch: Wir beantragen etwas beim Amt, zahlen in die Krankenkasse ein, rufen Freund*innen an. Kein Mensch lebt komplett unabhängig – das ist eine Illusion.
Jungen hingegen lernen früh, sich abzukoppeln. Sie sollen ‚unverbunden‘ sein, nicht auf andere angewiesen. Studien zeigen: Jungen sind tatsächlich weniger resilient als Mädchen – gerade in Krisenzeiten. Denn sie bleiben öfter allein. Sie haben seltener enge Bezugspersonen, zu denen sie sagen können: ‚Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht weiter.‘
Auch das Thema Freundschaft spielt eine Rolle: Viele Jungen lernen nicht, sich emotional mitzuteilen – selbst nicht bei engen Freunden. Das Eingeständnis, nicht weiterzuwissen, wird als persönliches Scheitern empfunden. In der männlichen Norm gilt: Ein Mann ist eine Führungsperson. Ein Held, der weiß, was zu tun ist. Wenn du das nicht kannst – dann bist du, in diesem Denkmuster, kein ‚richtiger Mann‘ mehr.
Und genau das ist das Problem. Wenn wir unsere Söhne im Sinne traditioneller Männlichkeitsnormen erziehen, dann führen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unglücklicheres, ungesünderes und oft auch kürzeres Leben.“
Viele Jungs entwickeln auch eine sogenannte „Pseudo-Resilienz“ – was hat es damit auf sich?
„Ja, das fand ich auch total spannend. Der US-amerikanische Psychologe William Pollack hat dazu geforscht – unter anderem in seinem Projekt ‚Listening to Boys’ Voices‘. In jahrzehntelanger Forschungsarbeit hat er herausgefunden, dass viele Jungen eine Art ‚Pseudo-Resilienz‘ entwickeln. Wenn ein Junge etwa sagt: „Juckt mich nicht“ oder „Ist mir egal“, dann nehmen wir das oft für bare Münze. Wir denken: Ah, der ist hart im Nehmen, das prallt an ihm ab wie an Teflon. Aber in Wahrheit sieht es oft ganz anders aus.
Pollack sagt: Im Inneren sind diese Jungen sehr wohl verletzt – sie dürfen es nur nicht zeigen. Sie haben früh gelernt, dass sie ihre Verletzlichkeit nicht äußern dürfen. Sätze wie ‚Das tut mir weh‘ oder ‚Ich bin traurig‘ werden ihnen regelrecht aberzogen. Stattdessen flüchten sie in Abwehrhaltungen wie ‚Dein Problem‘ oder ‚Interessiert mich nicht‘. Das wirkt nach außen stark, ist aber oft ein Schutzmechanismus.
Ein weiteres großes Problem: Depressionen bei Jungen werden häufig nicht erkannt – weil sie sich anders äußern als bei Mädchen. Während Mädchen ihre Gefühle oft benennen können, zeigen Jungen ihre innere Not eher durch Rückzug oder plötzliche Aggression.
Pollack sagt, wir müssen lernen, diese Zeichen anders zu lesen: Kommt ein Junge nach Hause, knallt die Tür, zieht sich zurück, spricht kaum noch, wird schnell wütend – dann sind das Warnzeichen, die wir ernst nehmen sollten.“
Wie sollten Eltern mit ihren Söhnen umgehen?
„Wir müssen Jungen zuhören. Sensibel und präsent. Wenn ein Junge sagt, dass ihn etwas traurig macht oder dass er sich schämt, sollten wir nicht mit Sätzen wie ‚Ach komm, du bist doch stark‘ oder ‚Das steckst du schon weg‘ reagieren. Sondern einfach da sein, zuhören und ihm Raum geben.
Wir können auch eigene Erfahrungen teilen: ‚Das kenne ich, als ich in deinem Alter war, hatte ich auch mal so ein Gefühl.‘ Oder ganz schlicht fragen: ‚Wie fühlst du dich damit? Seit wann ist das so? Was würde dir jetzt helfen? Willst du eine Umarmung?‘
Es geht darum, nicht gleich mit Lösungen zu kommen – was übrigens auch eine sehr männliche Bewältigungsstrategie ist: sofort handeln, reparieren, lösen. Dabei hilft oft schon das reine Dasein, das Zuhören, das Verstehen. Gerade das baut Vertrauen auf. Und Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass unsere Söhne sich überhaupt öffnen.
Wenn ein Junge spürt, dass niemand zuhört – oder schlimmer noch: dass er beschämt wird – dann wird er sich nur noch weiter verschließen. Aber wenn wir uns offen zeigen, präsent sind und ernsthaftes Interesse zeigen, dann entsteht eine Verbindung. Und dann wissen unsere Söhne: Ich darf so sein, wie ich bin – und ich darf mich zeigen, wenn es mir schlecht geht.“
Viele Eltern fragen sich: ‚Kann ich als Mutter oder Vater überhaupt gegen den starken Einfluss von Freundeskreis, Kita und Schule ankommen?‘ – Wie siehst du das?
„Eins ist klar: Unsere Kinder bringen Einflüsse von außen mit nach Hause. Im Kita-Alter kommen dann Aussagen wie: ‚Rosa ist für Mädchen, der Rest ist für Jungs.‘ Das ist okay. Denn genau hier beginnt unsere Aufgabe als Eltern: ins Gespräch gehen.
Wir können dann nachfragen: „Und wie ist das mit Himbeereis – darfst du das dann noch essen?“ oder „Findest du das eigentlich gerecht?“ So entstehen Denkanstöße. Ich hatte solche Gespräche mit meinem Sohn, als er klein war. Nach dem zweiten Gespräch sagte er schon: „Eigentlich ist das wirklich Quatsch. Das macht gar keinen Sinn – und gerecht ist es auch nicht.“ Er konnte sich schnell davon lösen.
Auch beim Thema Gefühle ist es so: Natürlich weinen viele Jungs auf dem Schulhof nicht hemmungslos, wenn sie sich das Knie aufschlagen. Sie unterdrücken es – aus Scham, aus Gruppendynamik. Aber das ist nicht schlimm. Entscheidend ist, dass wir zu Hause einen Raum schaffen, in dem sie all das ausdrücken dürfen, was sie zuvor unterdrückt haben.
Es geht darum, dass sie spüren: Hier darf ich sein, wie ich bin. Hier darf ich alles fühlen. Hier kann ich über Dinge sprechen, die mich bewegen. Wenn wir ihnen diese Räume bieten – über Jahre hinweg – dann verinnerlichen sie: So fühlt sich Sicherheit an. So fühlt sich Geborgenheit an. So fühlt es sich an, ein vollständiger Mensch zu sein. Und später werden sie sich auch Menschen suchen, bei denen sie diese Art von Nähe weiterleben können.
Also: Eltern müssen nicht gegen Kita, Schule oder Freundeskreis ‚ankämpfen‘, sondern dürfen bei sich bleiben. Wenn sie ihren Kindern verlässliche, liebevolle Erfahrungsräume bieten – über viele Jahre hinweg –, dann haben sie schon enorm viel geleistet.“
Oft heißt es: „Jungen fehlt es an männlichen Vorbildern.“ Wie stehst du dazu?
„Ja, es stimmt: Jungen fehlen häufig Vorbilder – aber nicht zwangsläufig männliche. Ich empfinde diesen gebetsmühlenartig wiederholten Ruf nach männlichen Vorbildern oft als zu eindimensional. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren auf einer Veranstaltung zum Thema ‚Wie können wir Jungen zu Feministen erziehen?‘ Am Ende fragte eine Mutter, was man denn konkret tun könne – und von der Bühne kam sofort: ‚Wir müssen die Männer mit ins Boot holen, die Jungen brauchen männliche Vorbilder.‘ Das hat mich ehrlich gesagt frustriert. Ich dachte nur: Wirklich? Schon wieder das?
Ich will nicht ständig dem Vater meines Sohnes im Nacken sitzen und ihm zuflüstern, wie er erziehen soll. Ich fühle mich dann wie eine Mutter aus den 1950ern, die sagt: ‚Jetzt sag deinen Sohn doch mal, dass du ihn lieb hast. Gib ihm doch mal einen Kuss.‘ Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in dieser Abhängigkeit leben. Wir sind getrennt, wir haben unterschiedliche Erziehungsstile – und das ist in Ordnung. Natürlich stimmen wir uns ab, aber ich will meine Rolle nicht abhängig davon machen, ob ein Mann an meiner Seite steht oder nicht.
Ich empfinde mich ganz klar selbst als Vorbild – und mein Sohn sieht das genauso. Er hat das auch explizit gesagt: ‚Mama, du bist mein Vorbild.‘ Das hat mich bestärkt – und gleichzeitig irritiert, weil es so sehr im Widerspruch zu dem steht, was Wissenschaft und Medien oft behaupten.“
Hast du herausfinden können, woher die Vorstellung stammt, dass Jungen unbedingt männliche Vorbilder brauchen?
„Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin auf Sigmund Freud gestoßen. Er entwickelte mit dem Ödipus-Komplex das erste psychoanalytische Modell zur Männlichkeitsentwicklung: Demnach wird ein Junge ‚richtig‘ männlich, wenn er die Konkurrenz zum Vater aufgibt und sich mit ihm identifiziert. Nur so – laut Freud – könne männliche Identität entstehen. Das heißt übersetzt: Jungen brauchen Väter, um Männer zu werden.
Doch viele Wissenschaftler*innen sehen das heute ganz anders. Der Arzt Alfred Adler etwa argumentierte, dass Jungen ihre männliche Identität nicht aus psychologischer Notwendigkeit heraus suchen, sondern aus einer gesellschaftlich-kulturellen Logik: Sie beobachten früh, dass Frauen weniger Macht haben – und lehnen das Weibliche ab, um ernst genommen zu werden. Mädchen wiederum lernen, dass sie ‚weiblich‘ zu sein haben – und werden bei Wut oft als zickig abgestempelt, während Jungen als durchsetzungsstark gelten.“
Manche Mütter tendieren dazu, sich irgendwann selbst von ihren Söhnen abzuwenden, oder?
„Richtig. Die Psychoanalytikerin Nancy Chodorow hat beobachtet, dass viele Mütter sich unbewusst von ihren Söhnen abwenden, wenn diese etwa sieben, acht oder neun Jahre alt sind – also in der Phase, in der sie als ‚richtige Jungs‘ heranwachsen sollen. Plötzlich heißt es: ‚Geh doch mal zum Papa, hilf ihm in der Garage. Du musst hier nicht mit uns in der Küche stehen.‘ Oder: ‚Du bist doch schon groß – ein Gute-Nacht-Kuss muss doch nicht mehr sein.‘
Hinter all dem steht oft die Angst, der Sohn könnte ein ‚Muttersöhnchen‘ werden – also zu weiblich wirken. Damit wird dem Jungen unbewusst signalisiert: ‚Bitte orientiere dich nicht an mir – ich bin eine Frau. Du sollst ein Mann werden.‘
Das ist ein tiefgreifender Bruch. Eine emotionale Trennung, die nicht selten eine frühe Kränkung und Wut hinterlässt. Besonders sichtbar wird das zum Beispiel, wenn ein kleiner Junge ein Geschwisterchen bekommt. Studien zeigen: Wird er zum großen Bruder, darf er meist nicht mit dem Baby kuscheln oder helfen – aus Angst, er könnte zu wild sein. Mädchen hingegen werden oft direkt mit einbezogen: ‚Du wirst mal eine tolle große Schwester – hilf doch schon mal mit.‘ Da zeigt sich ganz klar, wie Fürsorge und Nähe geschlechtsbezogen zugeteilt werden.
All das führt dazu, dass Jungen sich oft gegen ihren Willen von ihrer wichtigsten Bezugsperson – ihrer Mutter – abnabeln müssen. Und das hinterlässt Spuren. Deshalb sage ich ganz klar: Mütter können sehr wohl Vorbilder für ihre Söhne sein.
Ich habe das auch einen Psychologen gefragt: „Wer kann denn alles ein Vorbild sein?“ Seine Antwort war: ‚Es kommt nicht aufs Geschlecht an. Es kommt auch nicht darauf an, ob du das Kind geboren hast. Eine Oma kann genauso ein Vorbild sein wie ein Vater oder eine Lehrerin. Entscheidend ist, ob du dich als Identifikationsfigur anbietest – und ob du das selbst auch spürst.‘ Und genau das ist der Punkt: Wir müssen uns selbst als Vorbilder sehen – unabhängig vom Geschlecht.“
Du willst mehr über das Thema erfahren?
Noch mehr Impulse gibt Anne Dittmann in Folge 57 unseres Podcasts „Echt & Unzensiert“. Dort spricht sie unter anderem auch über die toxische Alpha-Mann-Bewegung rund um Andrew Tate – ihre Einschätzung dazu hörst du ab Minute 41:14. Reinhören lohnt sich!
Neue Folgen von „Echt & Unzensiert“ gibt es alle zwei Wochen immer freitags auf editionf.com oder bei Spotify, Apple Podcasts & Co!
Bei „Echt & Unzensiert“ beleuchtet Host Tino Amaral gemeinsam mit Expert*innen und Betroffenen vermeintliche Tabuthemen, macht auf Missstände aufmerksam und gibt Denkanstöße, die deinen Blick auf die Welt für immer verändern werden. Auch einige Promis haben bei ihm schon private Einblicke gegeben und wichtige Erkenntnisse geteilt. Welches Thema würdest du gerne mal hören? Lass es uns bei Instagram wissen!
Weitere spannende Themen bei „Echt & Unzensiert“:
„Wie soll man so gesund werden?“ – Ein Bericht aus der Psychiatrie
Kann man People Pleasern vertrauen? – Psychologin Stefanie Stahl im Interview
Wenn Aktivismus krank macht: Krankenschwester Franziska Böhler im Interview