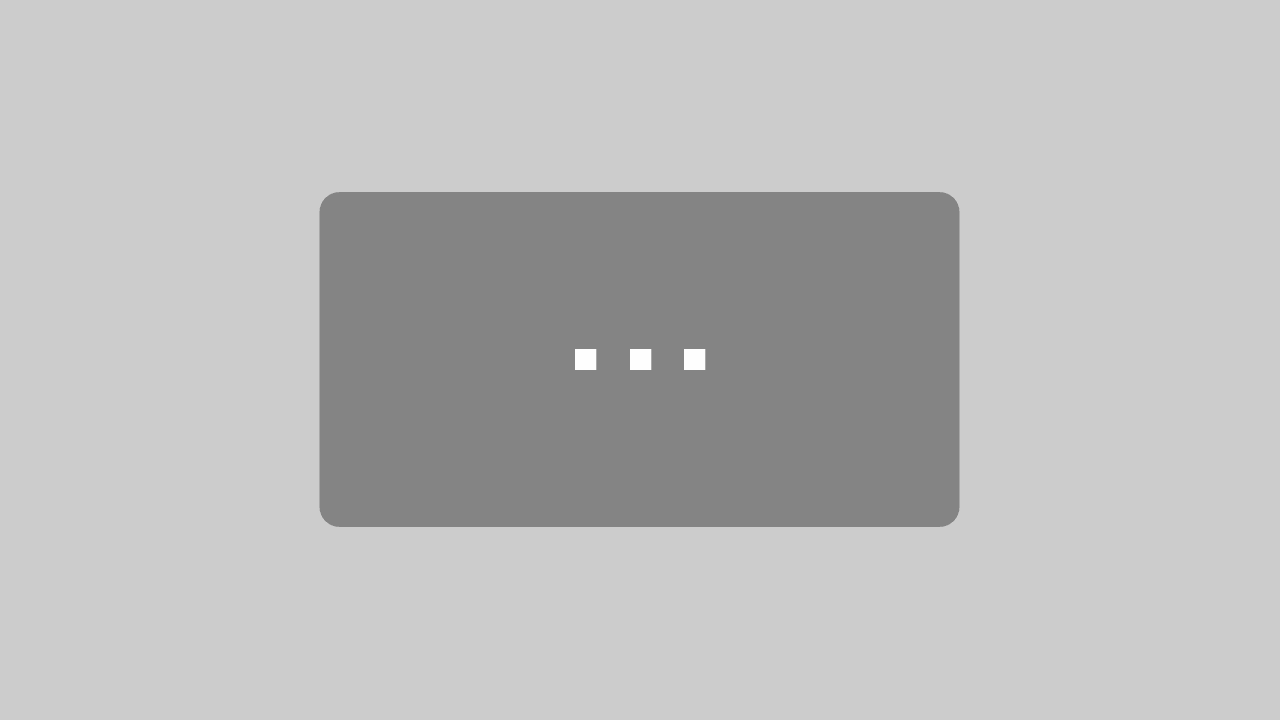Die iranisch-französische Autorin und Regisseurin Marjane Satrapi wurde mit der Verfilmung ihrer Comics weltbekannt. Nun hat sie die Geschichte der wohl berühmtesten Wissenschaftlerin, Marie Curie, für die Kinoleinwand inszeniert. Ein Interview.
Marie Curie war die erste Frau, die an der renommierten Pariser Universität Sorbonne unterrichtete, die erste Frau, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, und sie ist bis heute die einzige Person, der diese Ehre sogar in zwei verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zuteil wurde. Ihre Entdeckungen und Forschungen haben bis heute unweigerliche Auswirkungen auf unseren Alltag, die nun auch in den neuen Kinofilm über das Lebenswerk der weltbekannten Wissenschaftlerin und Visionärin einfließen. Die Handlung von „Marie Curie – Elemente des Lebens“ orientiert sich an den Meilensteinen ihres Lebens und thematisiert dabei sehr aktuelle Themen wie Leidenschaft, Emanzipation, Sexismus und Xenophobie.
Der Film basiert auf dem Roman „Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout“ der Autorin Lauren Redniss. Regie führte die iranisch-französische Comiczeichnerin Marjane Satrapi, die sich nach der weltweit gefeierten Verfilmung ihrer eigenen Bücher „Persepolis“ (Oscar-Nominierung) und „Huhn mit Pflaumen“ nun erstmals dem Werk einer Kollegin widmet. Die Regisseurin porträtiert Marie Curie im Film als unbeirrbare Persönlichkeit, die sich weder durch gesellschaftliche Konventionen noch durch Diskriminierung von ihren Zielen abhalten lässt. Im Interview sprechen wir mit Marjane Satrapi über kompromisslose Frauen, die #Metoo-Bewegung, den Kampf für Frauenrechte im Iran, den erstarkenden Nationalismus in Europa – und die vielen Parallelen zwischen Marie Curie und ihr.
Wann haben Sie begonnen, sich für Marie Curie zu interessieren?
„Ich bin mit der Geschichte von Madame Curie aufgewachsen. Das Ziel meiner Mutter war, mich zu einer unabhängigen Frau zu erziehen, sie sorgte dafür, dass Marie Curie und Simone de Beauvoir zu meinen Vorbildern wurden. Offensichtlich bin ich weder Philosophin noch Wissenschaftlerin geworden, doch ich wurde eine unabhängige Frau. Marie Curie nahm immer eine wichtige Rolle in meinem Leben ein. Sie kommt sogar in ,Persepolis‘ vor.“
War das die Motivation, Regie bei „Marie Curie – Elemente des Lebens“ zu führen?
„Die größte Motivation war das großartige Skript. Es wurden bereits sehr viele Filme über Marie Curie gedreht – da stellt man sich natürlich die Frage, warum es einen weiteren braucht.“
Warum denn – aus Ihrer Sicht?
„Ich war begeistert von diesem neuen Ansatz, ihre Geschichte zu erzählen. Im Film blickt man aus einer noch nie da gewesenen Perspektive auf Marie Curie, ihr Leben und ihr Wirken. Ich liebe diese Figur. Ich liebe es, dass sie eine Frau ist, die keine Kompromisse eingeht, dass sie so fokussiert ihre Ziele verfolgt. Genialität ist ein Attribut, das Frauen selten zugeschrieben wird. Und wir neigen dazu, genialen Männern alles zu vergeben.“
Woran machen Sie das fest?
„Wir sagen Dinge wie ,Hach ja, Pablo Picasso war ein Arschloch zu Frauen, aber er war ein Genie‘. Und ja, beides ist wahr, aber ihm vergeben wir. Wir vergessen den Arschloch-Part und erinnern uns nur an sein Genie. Bei Frauen scheint das schwieriger, sie sollen immer mild, unterhaltsam, liebenswert und süß sein. Aber wissen Sie was, ich bin eine Frau, ich kenne viele Frauen und weiß deshalb, dass nicht alle Frauen mild, süß und angenehm sind.“
Marie Curie bezeichnet sich im Film als egoistisch. Ich denke, dass es ihr gutes Recht ist, eine Egoistin zu sein. Ohne diese Eigenschaft hätte sie es möglicherweise nicht so weit gebracht.
„Absolut. Wählt man den gleichen Weg, den alle anderen auch gehen, wird man nicht zu einer Madame Curie. Man wird zu meiner Tante, meiner Cousine, zu irgendjemandem halt. Wer Großes erreichen will, muss konzentriert sein, fokussiert auf die eigene Sache. Und das nimmt selbstverständlich alle Zeit in Anspruch, die man im Leben zur Verfügung hat.“
Worauf lag Ihre Priorität bei der Inszenierung von Marie Curie?
„Das Allerwichtigste für mich war, dass wir die Rolle mit einer Person besetzen, die es schafft, ihr geniales Wesen abzubilden. Eine Person, die smart rüberkommt. Intelligenz zeigt sich meiner Meinung nach in Form eines bestimmten Leuchtens in den Augen. Als ich dann Rosamund Pike traf, war ich sehr beeindruckt von ihr – sie wirkte so gewitzt auf mich. Sie hat eine Energie, eine Kraft in ihren Augen – ich wusste sofort, dass sie die richtige Person ist, um Madame Curie zu spielen.“

Im Film werden immer wieder Ausblicke in eine nukleare Zukunft gezeigt: Versuchsanlagen in den USA, Hiroshima, Tschernobyl, aber auch medizinische Behandlungen in Form von Radiologie und Bestrahlung.
„Man kann nicht über die Entdeckung von Radioaktivität sprechen, ohne dabei an die Auswirkungen zu denken, die diese auf unsere Welt hatte. Marie und Pierre Curie waren wahrscheinlich zwei der anständigsten Menschen auf diesem Planeten. Als sie dieses neue Element, Radium, entdeckten, hätten sie ein Patent anmelden und sämtliche Rechte für die Verwendung für sich beanspruchen können. Die beiden waren jedoch der Auffassung, dass es sich um ein Element der Natur handelt und deshalb allen Menschen gleichermaßen gehört. Einer ihrer ersten Gedanken war, dass man damit Krebs behandeln kann. Eine Krankheit, die man seit der Antike fürchtete und für die man bis ins 20. Jahrhundert kein Heilmittel kannte.“
Es blieb jedoch nicht bei der ehrenhaften Nutzung dieser Entdeckung.
„Elf Jahre nach dem Tod von Marie Curie fielen die ersten zwei Atombomben auf Japan, deren Detonationsmechanismus auf Polonium beruhte – dem Element, das sie und ihr Mann entdeckt hatten. Aber sind daran wirklich Marie und Pierre Curie schuld? Natürlich nicht! Sie haben das Element bloß entdeckt. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist doch: Was macht die Menschheit mit solchen Entdeckungen? Genau diese Denkanstöße machen den Film für mich so interessant, er eröffnet verschiedene Perspektiven auf Marie Curie und den Einfluss ihrer Arbeit auf unsere Welt.“
Der Film schlägt eine Brücke zwischen der Forschungsarbeit der Curies und dem, was die Menschheit später aus diesen Entdeckungen gemacht hat.
„Genau. Immer wieder stellen Menschen in Frage, warum die Wissenschaft stets nach mehr strebt. Ich bin der Meinung, dass Forschung das ist, was uns von Tieren unterscheidet. Statt uns vor Dingen zu fürchten, die wir nicht kennen, versuchen wir zu verstehen, wie die Welt um uns herum funktioniert. Dieser Drang nach Weiterentwicklung hat den Menschen dahin gebracht, wo er heute ist. Anstatt die Dinge einfach zu akzeptieren, versuchen wir, an den Kern zu gelangen und etwas daraus zu machen. Statt einfach zu sagen, Wissenschaft bringt Schlechtes hervor, sollten die Menschen verstehen, dass sie nicht schlecht, sondern faktenorientiert ist. Die Frage nach der Ethik sollte man nicht dort stellen, wo etwas erforscht wird, sondern bei der Art und Weise, wie die Menschheit neue Erkenntnisse und Entdeckungen nutzt.“
Was haben Sie mit Marie Curie gemeinsam?
„Nicht allzu viel, würde ich sagen. Diese Frau war schließlich ein Genie und ich, nun ja, bin keins (lacht). Ich bin auch nicht so fokussiert und zielstrebig wie sie. Dennoch haben wir ein paar Dinge gemeinsam. Wir sind aus den gleichen Gründen von unseren Heimatländern nach Frankreich emigriert. Sie hatte in Polen nicht die Möglichkeit, Wissenschaft zu studieren und ich konnte im Iran kein freies Leben führen. Also kamen wir nach Paris, um uns den Dingen zu widmen, die uns in unserer Heimat verwehrt wurden. Interessant ist auch, dass wir beide bereits Französisch sprachen, bevor wir nach Frankreich kamen.
Eine weitere Sache, die uns verbindet, ist natürlich, dass wir Frauen sind, weibliche Ausländerinnen, was bedeutete, dass wir doppelt so hart arbeiten mussten, um es zu etwas zu bringen. Und doch haben wir das beide nie zu einem Thema gemacht. Ich habe mich selbst nie bewusst als ausländische Frau wahrgenommen, ich verstehe mich als einen von vielen Menschen, die etwas erreichen wollen. Ich glaube auch, dass mich andere für diese Sichtweise akzeptierten. Und ich habe mich nie dafür entschuldigt, hier zu sein, sondern mir den Raum ganz selbstverständlich genommen.“

Wie Marie Curie arbeiten auch Sie in einer männderdominierten Industrie.
„Ja, auch das haben wir gemein. Marie Curie wird heute von Feminist*innen gefeiert, aber sie war selbst nie Teil einer feministischen Bewegung. Sie hat Bestrebungen zur Gleichberechtigung natürlich unterstützt, aber sich so verhalten, als hätte sie bereits die gleichen Rechte wie Männer. Sie war besser als die meisten Männer in ihrem Feld – das wusste sie. Möglicherweise hatte sie deshalb nie das Bedürfnis, Teil feministischer Bewegungen zu sein.“
Entspricht diese Herangehensweise auch Ihnen?
„Obwohl ich oft in einem von Männern dominierten Feld gearbeitet habe, hatte ich nie den Eindruck, dass das für mich ein Problem darstellt. Was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich viele Dinge nicht realisiert, gewisse Aussagen und Handlungen gar nicht als sexistisch wahrgenommen habe. Erst mit der #Metoo-Bewegung wurde mir bewusst, dass man gewisse Dinge nicht zu mir gesagt hat, weil man mich als Person doof fand, sondern weil ich eine Frau bin. Eine Sache, die mir irgendwann bewusst wurde, war, dass man Frauen nie die richtig großen Budgets für Filme gab und gibt, weil man ihnen nicht zutraut, gut mit Geld umzugehen. Damit liegen diese Personen natürlich total falsch. Frauen gehen in der Regel viel verantwortungsvoller mit Geld um als Männer.
Generell war ich meist umgeben von netten Männern, was sicher ein Grund dafür ist, weshalb ich einige Zeit gebraucht habe, die Reaktionen rund um #Metoo zu verstehen. Wenn Männer nicht nett zu mir waren, wusste ich mich stets zu verteidigen. Besonders schwierig wird es für Frauen ja dann, wenn sie keine Möglichkeit sehen oder haben, sich zu wehren. Bewegungen wie #Metoo sind extrem wichtig, weil es nicht reicht, dass manche von uns die Möglichkeit haben, sich zur Wehr zu setzen – wir müssen erreichen, dass es gar nicht erst nötig ist, sich zu verteidigen. Wir dürfen Ungleichbehandlung und Sexismus keinen Raum mehr geben.“
Haben Sie den Eindruck, dass #Metoo den Blick auf Frauen verändert hat?
„Wir können 5000 Jahre Machokultur nicht in fünf Jahren loswerden. Das braucht seine Zeit. Wir dürfen uns jedoch nicht davon abhalten lassen, unser Ding durchzuziehen. Ich muss niemandem etwas beweisen, ich mache einen guten Job und damit hat es sich. Es gibt so viele Theorien über Frauen und Männer, Aussagen wie ,Frauen kommen von der Venus, Männer vom Mars‘. Das ist so überholt – auch wissenschaftlich gesehen. Wir müssen aufhören, Dinge zu sagen wie ,das ist typisch weiblich oder männlich‘. Unsere Gehirne funktionieren schließlich auf die gleiche Art und Weise. Ich bin auch kein Fan von Wettbewerben nur für Frauen. Ich nehme nicht gern an Frauenfilm oder -literaturfestivals teil, das fühlt sich für mich an, als würden wir erneut Gräben zwischen den Geschlechtern ziehen.
Diese Segregation ist lächerlich, das wirkt, als würden wir sagen ,Schaut her, diese beschränkten Wesen können ebenfalls Filme machen, also organisieren wir ein spezielles Festival für sie‘. Was soll das sein, ein Festival nur für Frauen oder Männer. Sind denn etwa alle Männer gleich? Wohl kaum. Ich möchte als Regisseurin geschätzt werden, nicht als weibliche Regisseurin. Männlich, weiblich, intersex, queer, transgender – ist doch total egal. Die einzige Frage, die wir stellen sollten, ist: Bin ich ein*e gute*r Regisseur*in? Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich Brüste habe oder nicht. Das geht niemanden etwas an.“
Apropos Frauenrechte: Vergangenen Herbst hatte ich Gelegenheit, Behnaz Shafiei zu interviewen, die als erste professionelle Motorradfahrerin Irans gilt. Sie hat mir von ihren Bestrebungen erzählt, iranische Frauen zu vernetzen und zu empowern. Seitdem gab es einige Protestbewegungen im Iran – wie erleben Sie diese als im Exil lebende Iranerin?
„Es ist großartig, dass es solche Bestrebungen gibt. Jedoch müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass wir von einem Land sprechen, in dem Frauen laut Gesetz halb so viel wert sind wie Männer und nur halb so viele Rechte haben. Unter solchen Umständen für Frauenrechte zu kämpfen, ist etwas ganz anders als in der westlichen Welt, wo zumindest laut Gesetz alle Menschen gleich sind. Im Iran ist diese Grundlage nicht gegeben. Als Reaktion auf diese Abwertung der Frau studieren im Iran doppelt so viele Frauen wie Männer. Wenn man dir nämlich sagt, du seist halb so viel wert wie ein Mann, studierst du doppelt so hart, um deinen Wert zu beweisen. Infolgedessen gibt es im Iran sehr viele weibliche Ingenieurinnen, Ärztinnen et cetera.
Diese Frauen sind viel besser ausgebildet als ihre Väter, Brüder und Partner, und ich glaube, dass das langfristig eine kulturelle Veränderung anstoßen wird. Eine Kultur, in der alle Menschen – unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Sexualität, Herkunft, Religion – gleich viel wert sind. Und eine solche Kultur wiederum bildet die Grundlage für die Entstehung einer Demokratie. In Europa gilt das als selbstverständlich, im Iran musst du sehr mutig sein, um dich für Veränderungen einzusetzen. Zu wissen, dass so viele iranische Frauen für ihre Rechte kämpfen, macht mich glücklich.“
Neben den iranischen Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, wer inspiriert Sie?
„Das mag überraschend klingen, aber ich liebe Angela Merkel. Ich bewundere sie wirklich sehr und bin überzeugt, dass sie die großartigste europäische Anführerin ist, die wir in den vergangenen 35 Jahren gesehen haben. Es macht mich sehr traurig, dass sie ihr Amt bald ablegen wird. Diese Frau repräsentiert für mich Demut und Stärke zugleich. Abgesehen davon verehre ich Virginia Woolf, sie war eine großartige Schriftstellerin.“
In Ihrer beruflichen Laufbahn erzählten Sie häufig Geschichten von inspirierenden Frauen: zu Beginn Ihre eigene Geschichte in Form ihrer Graphic Novel, dann im Film und nun die Geschichte von Marie Curie. Wessen Geschichte widmen Sie sich als nächstes?
„Ich arbeite aktuell an einer Serie von Gemälden, für die ich nur Frauen male. Der Titel der Ausstellung ist ,Femme ou rien‘, was so viel bedeutet wie Frau oder nichts. Diese Werke werden im Herbst in einer Pariser Galerie gezeigt. Was ich danach mache, entscheide ich, falls ich im kommenden Jahr noch lebe (lacht). Ich plane nie weit in die Zukunft hinein, sondern lebe von Tag zu Tag. Mal schauen, wo mich das Leben hinführt. Ich hätte bis vor kurzem auch nicht gedacht, dass ich je einen Film über Madame Curie machen würde und siehe da.“
Was haben Sie während Ihrer Arbeit am Film über Marie Curie gelernt?
„Ich wusste kaum etwas über ihre Beziehungen – weder über die zu Pierre Curie, noch über die spätere Beziehung mit Paul Langevin und das ganze Drama, das sich daraus entsponnen hat. All der Hass, dieser Rassismus, den Marie Curie abbekommen hat, als die Affäre mit Paul Langevin öffentlich wurde. Aber klar, das Ganze spielte sich wenige Jahre vor dem ersten Weltkrieg ab – zu einer Zeit, in der die Menschen sehr nationalistisch eingestellt waren, was sich in dieser Situation dann eben deutlich gezeigt hat. Nationalismus ist für mich ein Synonym für Krieg. Man kann patriotisch eingestellt sein, sein Land lieben, aber extremer Nationalismus hatte immer das Schlimmste vom Schlimmen zur Folge.“
Wie blicken Sie dementsprechend auf das aktuelle politische Geschehen?
„Heute, wo der Nationalismus wieder erstarkt, können wir nicht mehr sagen, dass wir es nicht besser wissen. In den Dreißigern, als die Nazis die Macht übernahmen, konnte man von mir aus noch sagen, dass einem nicht bewusst war, was daraus werden wird. Heute wissen die Menschen, wohin uns das führen wird und dennoch wählen sie die extreme Rechte. In Europa gewinnen die rechten Parteien gerade so viel Land – und ja, vielleicht werden sie nie an die Macht kommen, doch dieser Hass vergiftet unsere Gesellschaft.
Für mich ist das gerade das akuteste Thema, mit dem wir uns in Europa befassen müssen. Warum gerät in Vergessenheit, dass die Geschichte der Menschheit sich aus Krieg, mehr Krieg, nochmal Krieg und kurzzeitigem Frieden zusammensetzt? Noch haben wir ein vereinigtes Europa ohne Krieg. Das ist ein Erfolg. Niemand hier muss mit 18 Jahren im Krieg sterben, nur weil dumme Leute andere Menschen hassen. Das ist eine Errungenschaft. Wir sollten unser Bestes geben, dass das so bleibt.“
Übrigens: Zum Filmstart am 16. Juli diskutierten Dr. Jutta Allmendinger, Maike Röttger, Prof. Kathrin Valerius und Barbara Streidl darüber, warum es gerade heute Vorbilder wie Marie Curie in der Wissenschaft braucht. Hier könnt ihr die Panel-Diskussion nachschauen.