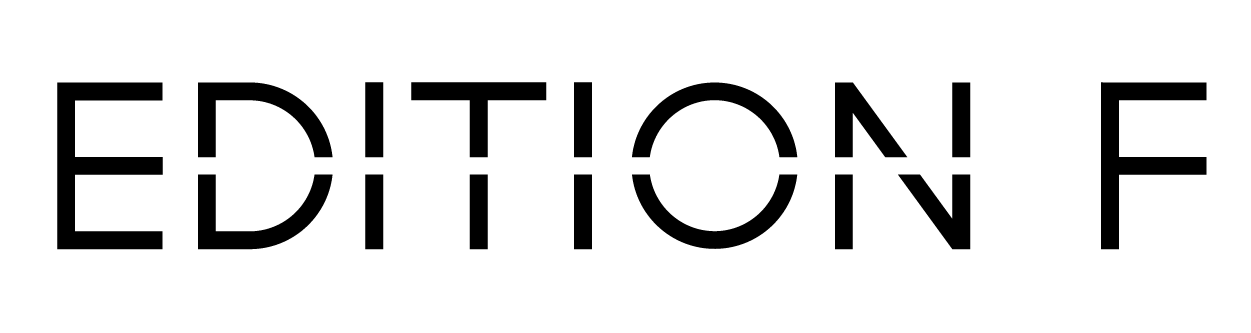Nicht-binäre Geschlechter und queere Lebensrealitäten sind sichtbarer denn je. Doch die deutsche Sprache bietet kaum einfache Lösungen, um diese Diversität abzubilden. Neue Begriffe entstehen, doch nicht alle fördern die erhoffte Inklusion. Ein Guide für queerbewusste und inklusive Sprache.
Der Feminismus ist über den Begriff „Frauenbewegung“ hinausgewachsen und erkennt heute deutlich mehr Facetten von Geschlecht und Diskriminierung an. Es gibt viele Menschen, die nicht entweder Mann oder Frau sind, und im intersektionalen Feminismus wird das mitgedacht. Unter dem Patriarchat leiden nicht nur Frauen (und Männer), sondern auch und vor allem alle, die aus dem Konstrukt der geduldeten Männlichkeit und Weiblichkeit herausfallen. Doch leider fehlen uns dafür gute Lösungen, diese Personen sprachlich abzubilden.
Frauen mit oder ohne Sternchen
Meiner Meinung nach ist der traurigste Versuch, ein Sternchen hinter das Wort Frauen* (seltener auch Männer) zu setzen. Gemeint sind damit Frauen und… naja, wer eigentlich genau? Es ist nicht ganz klar, wer oder was sich hinter diesem Sternchen verbirgt, da sich niemand die Mühe gemacht hat, das zu verdeutlichen. „So und so viele Frauen sind betroffen von…“ heißt es in verschiedensten Kontexten, in denen über unterschiedliche Gruppen von Menschen gesprochen wird. Das stört mich vor allem deswegen, weil egal zu sein scheint, über wen (außer Frauen) man eigentlich gerade spricht, gleichzeitig soll es aber so aussehen, als würde man alle Menschen mitdenken.
Dabei ist es auch ok, manchmal nicht alle mitzudenken. Gerade wenn es um Statistiken geht. In einer Studie wird beispielsweise das Geschlecht der Person vorher abgefragt. Wenn dort Frauen steht, dann handelt es sich meist ausschließlich um Frauen und es ist sogar wichtig, das so zu erwähnen. Wir sind nämlich (leider) noch nicht an dem Punkt, an dem andere mitgedacht werden – gerade im Rahmen von Studien, und das sollte auch sichtbar sein.
In anderen Kontexten hingegen wäre es so leicht, eine Alternative zum Wort „Frau“ zu finden. So könnte man von „Menstruierenden“ oder „Schwangeren“ sprechen. Bei diesen Wörtern sind ganz sicher alle Betroffenen erwähnt, weil sie nicht auf ihr Geschlecht heruntergebrochen werden. Zumindest wäre es ein erster Schritt, nicht ausschließlich, sondern von „größtenteils“ oder „vor allem“ Frauen zu sprechen. Bestimmt könnte man auch in einigen Situation einfach von „Menschen“ reden – denn für die meisten von uns spielt das Geschlecht im Kopf oft eine größere Rolle, als es das in der Realität tatsächlich tut.
Gerade wenn man es nicht besser weiß oder pointiert formulieren möchte, sollte man vielleicht lieber bei dem bleiben, was man kennt, anstatt etwas nachzuplappern, ohne genau zu wissen, was es bedeutet oder ob es hier überhaupt passt. Vielleicht richtet es sogar mehr Schaden an, Begriffe falsch zu benutzen, statt sie gar nicht zu benutzen.
Die deutsche Sprache macht es kompliziert. Ich finde, es ist wichtig, zuzugeben, dass das Gendersternchen nicht perfekt oder einfach ist. Aber: Es ist das Beste, was wir haben. Weder das generische Maskulinum noch eine Nennung der weiblichen und männlichen Form bilden nicht-binäre Menschen ab. Da uns bei den meisten Nomen eine geschlechtsneutrale Form fehlt, müssen wir selbst eine schaffen. Beim Altbekannten zu bleiben, ist keine Lösung, also versuchen wir, Lösungen zu finden – auch wenn es manchmal schwer ist, sich darauf einzulassen.
Dann eben „weiblich gelesen“
„Weiblich/männlich gelesen“ ist inklusiver als Frauen* und Männer. Oder? Naja, schon irgendwie, zumindest gibt es Momente, in denen der Begriff passt. Meiner Meinung nach wird die Formulierung aber viel häufiger genutzt, als es sein tatsächlicher Anwendungsbereich hergibt. Hinzu kommt noch ein sehr großes Problem: Sie schreibt Menschen etwas zu. Wenn ich eine nicht-binäre Person „weiblich gelesen“ nenne, weil ich „weiblich“ denke, wenn ich sie sehe, dann ist das zwar irgendwie korrekt, kann aber auch sehr verletzend sein und stellt meine persönliche Wahrnehmung als Tatsache hin. Selbst wenn die meisten Menschen eine bestimmte Person als männlich wahrnehmen würden, müssen wir diese Person dann wirklich als männlich gelesen betiteln? Damit pressen wir einen Menschen in unser voreingenommenes Verständnis von Geschlecht und reduzieren die Person darauf. Ist es so viel weniger verletzend, eine Person, die nicht männlich ist, männlich gelesen, statt einen Mann zu nennen? Das kleinere Übel ist immer noch … übel.
Ich finde, an dieser Stelle braucht es ein paar Beispiele, um das Problem zu verdeutlichen. „Weiblich gelesene Menschen erfahren häufig sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit“, ist ein häufig benutzter Kontext für die Formulierung. Viele Menschen werden durch fremde Menschen sexuell belästigt, weil diese sie als weiblich sehen – auch wenn sie keine Frauen sind. Der Kontext passt zum Begriff und dementsprechend haben wir hier ein positives Beispiel.
Andere Menschen werden auch sexuell belästigt, aber die Motivation dahinter und die Ausgangslage sind unterschiedlich genug, dass wir hier unterscheiden können.
Ein Negativ-Beispiel ist „Weiblich gelesene Personen erfahren Benachteiligung im Job“, denn hier ist die Diskriminierung schon deutlich vielschichtiger. Beispielsweise erfahren auch trans Personen im Job Diskriminierung durch ihr Geschlecht – egal wie sie gelesen werden. Es ergibt in diesem Kontext meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, herauszustellen, dass Betroffene „weiblich gelesen“ werden, da deutlich mehr Faktoren eine Rolle spielen. Nicht nur das, es werden auch andere Betroffene ausgeblendet.
„Es geht am Ende nicht darum, wie wir sprechen, sondern vor allem darum, wie wir denken.“
FLINTA* wird vor allem verwendet, um Räume zu schaffen, in denen Menschen geschützt existieren können. Zunächst gab es Frauenräume, dann Frauen- und Lesbenräume und mittlerweile sind es FLINTA-Räume. Häufig wird diese Form in Bezug auf FLINTA-Veranstaltungen oder zum Beispiel FLINTA-only Toiletten genutzt. Das Problem ist nur häufig, dass die Absicht der Inklusion, die der Begriff schaffen möchte, in der Praxis noch nicht so gut funktioniert. Auf einer FLINTA-only Veranstaltung sind unter anderen per Definition willkommen: trans Frauen, die noch nicht geoutet sind und (noch) nicht transitionieren oder trans Männer, die nicht von cis Männern zu unterscheiden sind. Aber fühlen sich diese Menschen wirklich willkommen und wohl auf so einer Veranstaltung?
Manchmal wird der Begriff FLINTA* auch erklärt als „alle außer cis Männer“, was explizit inter* cis Männer ausschließt. Teilweise wird der Begriff von Menschen verwendet, bei denen man sich sehr sicher sein kann, dass diese nicht wissen, was er bedeutet und die eigentlich nur Frauen meinen. Nicht selten sehe ich die Formulierung „Frauen und FLINTA“ – da weiß ich nicht mehr, ob ich lachen oder weinen sollte.
Der Begriff FLINTA hat zwei große Probleme:
1. Niemand kann „kontrollieren“, ob jemand FLINTA* ist oder nicht und das führt zu impliziter oder expliziter Ausgrenzung, wenn zum Beispiel an Eingängen „kontrolliert“ wird. FLINTA* ist ein inklusiver Begriff – Leute dadurch auszugrenzen geht vollkommen am Ziel vorbei.
2. Der Begriff schafft keine volle Inklusion dadurch, dass einige Menschen entweder nicht mitgedacht werden oder sich nicht angesprochen fühlen. Hier wird sich noch zeigen, ob der Begriff tatsächlich alle Betroffenen abbildet oder ob unsere Sprache sich noch weiterentwickeln muss.
Über die Sprache hinaus
Dennoch ist der Begriff FLINTA inklusiv und ein cleverer Ansatz, um viele Menschen, die durch patriarchale Unterdrückung ähnliche Erfahrungen machen, in einem Wort zu nennen. Der Rest muss in den Köpfen und in der Anwendung passieren und es muss weiterhin der Kontext bedacht werden. Denn FLINTA* wird nicht mehr nur noch im Kontext von Räumen und Ähnlichem verwendet, sondern auch oft als eine Gruppenbezeichnung. Auch hier sehe ich das Problem, dass der Begriff inflationär missbraucht wird. Es reicht nicht, eine ehemalige Frauenveranstaltung zu nehmen und sie stattdessen FLINTA*-Veranstaltung zu nennen. Sprache ist wichtig für Inklusion, aber sie ist nur ein Schritt von vielen. Gibt es geschlechtsneutrale Toiletten? Gibt es einen Plan im Umgang mit Diskriminierung? Fühlen sich auch alle FLINTA* potenziell wohl? Das sind die wichtigen Fragen, die gestellt werden müssen. Bevor man von FLINTA* spricht, egal ob für eine Veranstaltung oder in einem anderen Kontext, sollte man zumindest einmal in sich gehen und sich fragen: Wirklich alle FLINTA*?
Letztendlich wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen genauer hinterfragen, was für Begriffe wir benutzen und warum. Das Thema inklusive Sprache polarisiert in Deutschland mindestens genauso stark wie das Thema Autos, dabei gibt es doch eigentlich gar nicht so viel zu diskutieren. Sprache entwickelt sich schon immer auf eine sehr natürliche Weise. Alte Ausdrücke und Grammatik verschwinden und Neues wird geschaffen – großenteils dadurch, dass wir einfach nur sprechen. Man kann Menschen oft nur schwer davon überzeugen, ihre Sprache zu verändern, doch man kann seine eigene Sprache anpassen und sie damit bewusst oder unbewusst weitergeben. Natürlich funktioniert das nicht ausschließlich so, sonst wäre dieser Text überflüssig.
Es geht am Ende nicht darum, wie wir sprechen, sondern vor allem darum, wie wir denken. Wer sich mit geschlechtlicher Vielfalt auseinandersetzt, wird automatisch sensibler in der Sprache. Natürlich ist das Sprechen oft komplizierter als das Denken – aber es lohnt sich, sich die Mühe zu machen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder andere zu belehren, sondern darum, Menschen in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und anzuerkennen. Sprache ist ein Werkzeug, um diese Realität sichtbar zu machen – und das kann für viele einen großen Unterschied bedeuten.
Begriffe einfach erklärt:
[FLINTA] Das Akronym steht für: Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen, also Menschen, die in einer patriarchalen, heteronormativen Gesellschaft aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert werden. Obwohl „Lesbe“ keine Geschlechtsidentität ist, wird der Begriff aufgezählt, um die feministischen Errungenschaften lesbischer Frauen sichtbar zu machen. „Lesbisch“ wird zwar in erster Linie als sexuelle Orientierung und nicht als Geschlecht betrachtet, allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Manche verstehen sich beispielsweise als nicht-binär und lesbisch, andere sagen, dass das Leben als Frau stark durch die Beziehung zu Männern geprägt wird und sich Lesbisch-Sein deshalb für sie wie etwas anderes als Frau-Sein anfühlt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sexuelle Orientierung und Geschlecht einen Bezug zueinander haben können.
[inter, intergeschlechtlich] Intergeschlechtliche/inter Personen haben Merkmale beider binären Geschlechter (Mann und Frau), was sowohl durch sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Muskelmasse als auch durch primäre Geschlechtsmerkmale wie die Geschlechtsorgane zum Ausdruck kommen kann. Inter* kann sich aber auch auf die Geschlechtsidentität einer Person beziehen, die Bezeichnung wird als Überbegriff genutzt, der alle intergeschlechtlichen Realitäten einschließen soll.
[nicht-binär] Als nicht-binär bezeichnen sich Menschen, die sich außerhalb der binären Geschlechterordnung von „männlich“ und „weiblich“ verorten, möglicherweise abseits von männlich und weiblich, teilweise oder gleichzeitig männlich und weiblich oder auch ganz abseits von jeglichem Konzept von Geschlecht.
[cis/trans] Das lateinische Präfix „cis-“ kann mit „diesseits“ übersetzt werden. Es ist das Antonym von „trans-“, das so viel heißt wie „über“. Als trans bezeichnen sich Menschen, deren Geschlechtsidentität – im Gegensatz zu cis Menschen – nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. „Cis“ wird genutzt, um dem Begriff „trans“ etwas gegenüberstellen zu können und damit zu vermeiden, dass heteronormativ lebende, cisgeschlechtliche Menschen als „Normalfall“ konstruiert werden. Sowohl cis als auch trans werden als Adjektiv benutzt, korrekt wäre also: trans Frau und nicht Transfrau.
[agender/ageschlechtlich] Menschen, die agender/ageschlechtlich sind, haben kein Geschlecht oder fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig.
Diese und weitere Begriffserklärungen findest du in unserem Glossar.