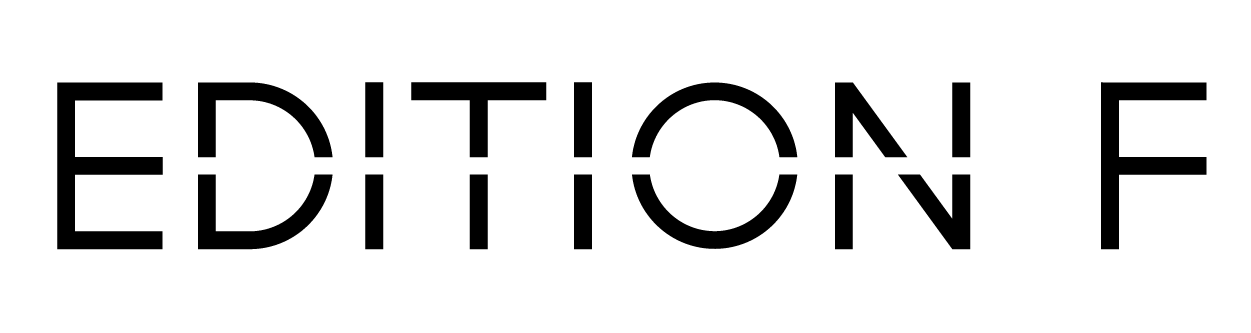Abnehmspritzen spalten die Debatte um Körper und Gesundheit. Die Körperaktivistin Melodie Michelberger spricht im Interview über Schlankheitsdruck, Feminismus und die neue Abnehm-Ära. Warum Kritik an Ozempic und Co. kein Bodyshaming ist – und wieso wir in der Debatte um weibliche Schönheitsideale auch den Rechtsruck im Auge behalten müssen.
In den vergangenen Monaten konnten wir auf Social Media verfolgen, wie Influencer*innen und prominente Menschen in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren haben. Nicht durch Sport oder spezielle Diäten, sondern mithilfe von Ozempic und ähnlichen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Du setzt dich als Körperaktivistin seit langer Zeit für Body Positivity und Körperakzeptanz ein. Was macht diese alte, neue Sucht nach schlanken Körpern mit dir?
„Ich kann nicht glauben, wie schnell das jetzt ging. Wir sprechen hier von maximal zwei Jahren, also 2023 bis heute. Auch Frauen aus der Body Positivity-Bewegung, zu denen ich aufgeschaut habe, sind auf einmal schlank. Was mich enorm daran stört, ist, dass sie nicht transparent mit der Spritze umgehen. Dass sie nicht von der inneren und äußeren Belastung sprechen, dick zu sein und dünn sein zu wollen oder zu müssen, sondern es als Wellness-Initiative verpacken. Ganz so, als hätten sie jetzt mehr Sport gemacht und Self Care betrieben und dadurch so schnell abgenommen. Das triggert mich extrem.“
Welche Rolle spielen Soziale Medien dabei?
„Als ich gerade damit angefangen habe, mit meinem Körper Freundschaft zu schließen, war ich oft auf Instagram und habe meine Gedanken dazu geteilt. Ich fing bewusst an, über Mechanismen nachzudenken, die mir das Gefühl gaben, dünn sein zu müssen. Dass es für mich, Melodie, gar keine andere Möglichkeit geben kann, als dünn zu sein und in eine gewisse Kleidergröße zu passen. Zu dieser Zeit gab es viele Instagrammer*innen, die mir auf diesem Weg geholfen und ähnliche Erfahrungen gemacht haben. All das fängt gerade an zu bröckeln, weil nicht nur prominente Menschen, sondern auch Frauen, die sich für die Repräsentation unterschiedlicher Körper starkgemacht haben, plötzlich dünn sind. Dass sie es als „Wellness-Initiative“ verkaufen, macht etwas mit mir. Weil es mir schon wieder das Gefühl gibt, dass ich diese Spritze auch nehmen sollte. Ich habe darüber auch schon zwei-, dreimal nachgedacht.
Ich stehe nicht jeden Tag vor dem Spiegel und denke: ‚Geiler Körper!‘. Ich habe mich mit meinem Körper angefreundet, die Gefühle der Essstörung sind immer noch da, weil ich Jahrzehnte davon betroffen war. Das geht nicht auf einmal weg. Vor Kurzem habe ich von diesem Gefühl in einer Instagram-Story gesprochen und während meiner gesamten Zeit auf dieser Plattform, wir sprechen hier von zwölf Jahren, noch nie so viele Nachrichten erhalten. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich „nur“ darüber gesprochen habe, wie schwierig ich es finde, momentan auf Instagram durchzuscrollen. Überall taucht das Thema ‚dünn sein‘ wieder auf.
Menschen, denen ich schon lange folge, teilen auf einmal ihre Fitness-Routinen. Nicht nur einmal, sondern täglich. Sie fotografieren ihr Essen, sie zeigen sich auf dem Laufband – all das sind kleine Puzzleteile, die am Ende das große Bild ergeben: Die konstante Beschäftigung mit der Verkleinerung des eigenen Körpers. Wenn bekannte Influencer*innen, die sowieso schon sehr dünn sind, in ihren Storys verbreiten, dass sie ‚wieder mehr Fett verbrennen wollen‘, dann trifft mich das. Und ganz ehrlich: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass meine Unsicherheiten in so kurzer Zeit wieder hervorkommen.“
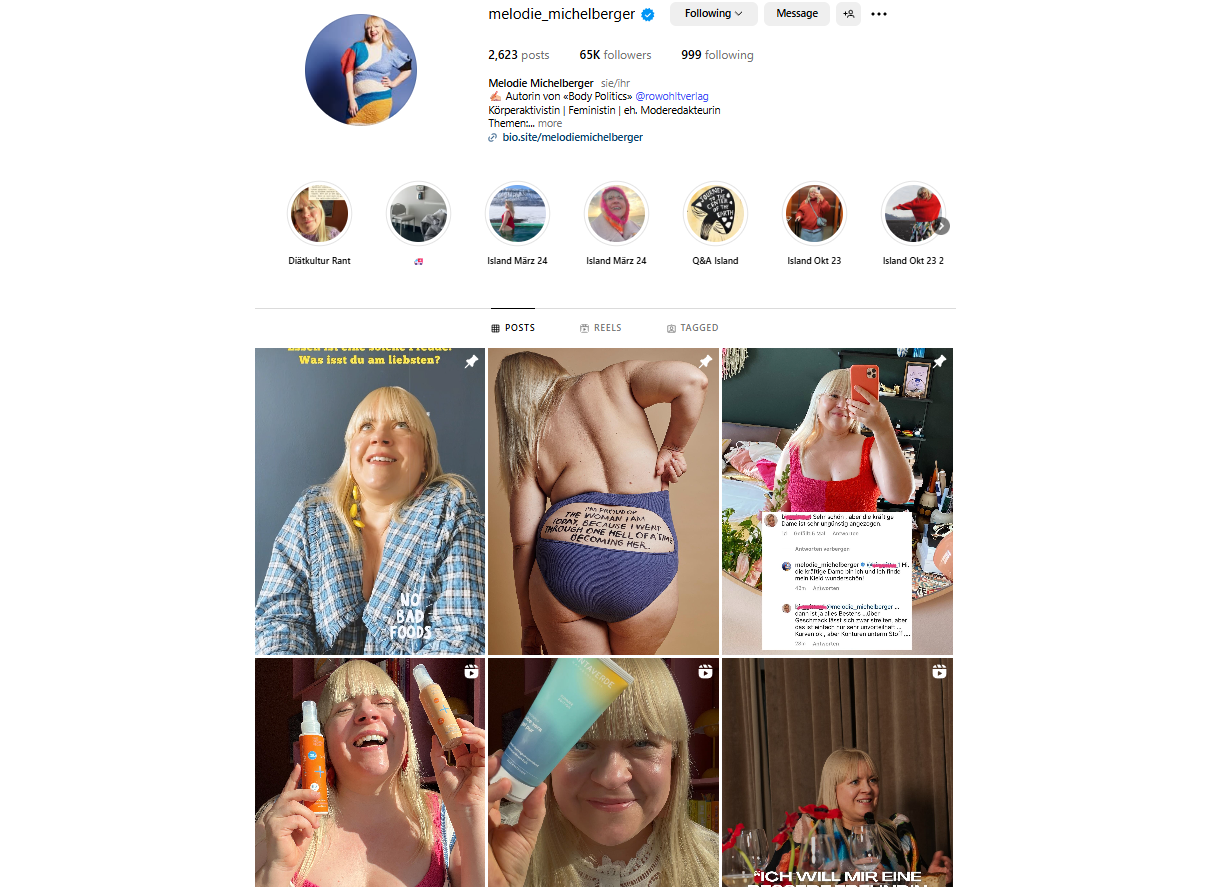
Wie gehst du damit um, wenn deine Follower*innen dir schreiben, wie sehr sie das allgegenwärtige Abnehmen unter Druck setzt?
„Mich macht das sehr betroffen. Viele teilen meine Gedanken und Gefühle und erzählen mir, dass sie nicht mehr stark sein und zu sich sagen können: ‚Das hat nichts mit mir zu tun, mein Körper ist ein guter Körper.‘ Sie denken, dass sie auch mit Spritzen oder mit Hungern anfangen oder irgendetwas kaufen müssten, damit sie dünn werden. Am Ende geht es immer ums Kaufen, man muss immer etwas konsumieren oder leisten in dieser Welt. Es erschreckt mich so sehr, dass die Fortschritte, die wir durch Body Positivity in den letzten Jahren erreichen konnten, durch ein Medikament, das eigentlich für Diabetiker*innen entwickelt wurde, hinfällig sind. Wenn du mich das vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich niemals geglaubt, dass das Thema aus der Öffentlichkeit so schnell verschwinden könnte.“
Es haben sich rund um das Thema Ozempic-Nutzung schnell zwei Lager gebildet: Das eine schützt die Abnehmspritze unter dem Dach der körperlichen Selbstbestimmung, vor allem bei Frauen. Das andere sieht es als feministische Pflicht, Kritik am neu entflammten Trend des Dünnseins zu üben. Wie stehst du dazu: ist Kritik an Ozempic und Co. und deren Nutzung antifeministisch?
„Diese Spitzen sind für viele hochgewichtige Menschen, die sehr stark unter ihrem Körpergewicht leiden, und Diabetiker*innen ein Segen. Auf der anderen Seite erhöhen diese Medikamente wie Ozempic und Wegovy den Druck des Abnehmens auf uns alle exorbitant, dementsprechend auch auf mich. Denn ich habe seit meinem siebten Lebensjahr das Gefühl, zu dick zu sein. Das Ideal dünn zu sein, das lange Zeit für viele Menschen unerreichbar war, wird plötzlich in greifbare Nähe gerückt, da es mithilfe von Spritzen ‚so einfach‘ ist. Was das ganze Thema auch sehr klassistisch macht: Bekomme ich es verschrieben oder habe ich ausreichend Geld, um es mir zu leisten? Wir reden da von mehreren Hundert Euro im Monat für Spritzen, die man, um das Gewicht zu halten, eigentlich ein Leben lang nehmen muss. Du kannst nicht einfach zehn Kilo abnehmen und Ozempic absetzen. Es ist nur scheinbar ein Quick-Fix, eine schnelle Methode.
Ich glaube nicht daran, dass wir Individuen kritisieren sollten. Unsere Kritik muss sich an das System dahinter richten. Wenn es nur um Ästhetik geht, nicht um Menschen, die es wirklich brauchen, müssen wir vor allem als Feminist*innen Kritik üben. Warum sollen wir denn alle immer dünn sein? Es geht doch nicht um Gesundheit – wir sollen dünn sein, um schwach zu sein. Dass das genau jetzt passiert, dass wir jetzt genau diesem Ideal entsprechen sollen, passiert zeitlich zu einer wieder aufflammenden Radikalität, die wir in den USA, in Großbritannien, bei uns und in vielen anderen Ländern der Welt sehen.“
Dein Buch heißt „Body Politics“. Es gibt kaum ein anderes Thema, das so politisch aufgeladen ist wie der Körper einer Frau. In der jüngeren Geschichte gibt es immer wieder zeitliche Überschneidungen zwischen dem Ideal der dünnen, bescheidenen Frau und faschistischen, rechtskonservativen Strömungen. Siehst du Aktivist*innen in der Verantwortung, Aufklärungsarbeit zum Körperbild einer Frau und populistischen Strömungen zu leisten?
„Absolut, das kann man alles nicht getrennt voneinander betrachten. Die Diätkultur ist mit patriarchalen und kapitalistischen Strukturen verwoben. Und diese Systeme werden immer darum kämpfen, den weiblichen und weiblich gelesene Körper zu kontrollieren. Ich finde das in den Bildern, die auf Social Media vor allem im Trad Wife-Kontext gezeigt werden, ersichtlich: Wirklich erfolgreiche Influencer*innen haben alle ein jugendliches Aussehen, sind fast alle weiß, alle sehr dünn und viele blond. Es zeigt, dass der dünne Körper das einfachste Mittel ist, um Produkte an Personen – in diesem Fall an die Frau – zu bringen. Das hat sich leider auch durch Body Positivity nicht verändert. Rückblickend wirkt unser Aktivismus wie ein kurzes Spektakel.
„Es ist eine Form von Gewalt, uns konstant das Gefühl zu geben, dass wir nicht richtig sind. ”
Zwischen 2018 und 2022 war es erlaubt, auch Körper zu vermarkten, die gerade noch ästhetisch genug sind, um für Follower*innen konsumierbar zu sein. Auch ich habe davon profitiert, weil ich zwar dick bin, aber immer noch vorzeigbar war. Trotzdem wird im Kapitalismus immer der dünne Körper als Blaupause genommen, um alles – von der Bratpfanne, über Autos bis hin zu Beauty-Produkten – zu verkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und momentan, so empfinde ich das, kommt dieses machtvolle, über Jahrhunderte aufgebaute System mit Gewalt auf uns zu. Denn es ist eine Form von Gewalt, uns konstant das Gefühl zu geben, dass wir nicht richtig sind. Das Allerschlimmste ist ja, dass wir selbst dann, wenn wir die Abnehmspritze nehmen, immer noch nicht richtig sind. Aktuell ist es der Pilates-Body, gestern war es der Bubble-Po. Ein trainierter Körper, mit glatter Haut und rundem Busen – das sind alles so unerreichbare Forderungen, die uns Frauen die Kraft nehmen sollen.“
Ein patriarchales Ablenkungsmanöver? Manchmal denke ich, dass sich das Narrativ des Körperaktivismus dem neuen Rechtsruck anpassen sollte: Wenn wir gegen den Paragraf 218 auf die Straße gehen, dann bitte auch gegen gewaltvolle Schönheitsideale. Kannst du dich damit identifizieren?
„Ich wünsche mir schon seit langer Zeit, dass wir mehr auf die Kacke hauen. Ich glaube jedoch nicht, dass das die alleinige Aufgabe der Aktivist*innen ist. Wir machen das schon ewig. Die Body Positivity-Bewegung kommt aus der Fat Acceptance-Community die, wie auch die Frauenbewegung der 60er- und 70er-Jahre, schon damals darüber gesprochen, worüber wir heute reden. Das muss man sich mal vorstellen, das ist kein Geheimwissen, die Informationen sind da draußen. Das Problem ist, dass wir alle so tief in dem System stecken, dass es für viele Menschen schwer ist, das große Ganze zu sehen. Auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, ist dieser Skinny-Trend ein ganz eindeutiger Gewinn für das Patriarchat und den Kapitalismus. Abnehmen getarnt als Wellness, der Frauen wieder einlullt. Durch Body Positivity wurde dieser Druck kurzzeitig weniger, es war aber nur eine Pause.“
Wer ist jetzt in der Verantwortung, diese Zusammenhänge für alle ersichtlich und verständlich zu machen?
„Leider muss ich sagen, dass die wenigsten Journalist*innen das wahre Problem erkannt haben und absolut keine Ahnung vom Körperaktivismus hatten. Body Positivity, Schönheitsideale und der Wunsch, dünn zu sein, wurde von vielen Medien und leider auch meinen Kolleg*innen in der Verlagsbranche immer als ‚Frauenproblem‘ abgetan. Anstatt der Frage auf den Grund zu gehen, woher es kommt, dass bestimmte Körper als weniger wünschenswert gesehen, als hässlich und ungesund betrachtet werden, fragte man mich immer wieder: ‚Frau Michelberger, wieso fühlen sich die Frauen denn so unwohl?‘, ‚Frau Michelberger, wie viele Diäten haben Sie schon gemacht?‘
„Das Patriarchat verkauft die weibliche Unterwerfung sehr gekonnt als Wellness und spricht neuerdings auch Frauen wie mich mit Ende 40 über das Phänomen ‚Perimenopause‘ an.”
Wenn große Medienhäuser sich die Mühe gemacht hätten, der Ursache auf den Grund zu gehen, wieso schlanke, junge und sportliche Körper erstrebenswert sind, wären wir heute wahrscheinlich schon weiter. Ich habe während des Body Positivity-Booms nur ein Interview mit einer tollen Journalistin führen dürfen, in dem wir an die Substanz gekommen sind. Denn das, was wir heute als „schön“ betrachten, lässt sich (auch) auf den Kolonialismus zurückführen. Als bestimmte Menschen- und Bevölkerungsgruppen systematisch abgewertet und ihre Körper mit negativen und unerwünschten Eigenschaften beschrieben wurden. Die Faschisten und Nationalsozialisten haben sich einige Jahrzehnte später genau an diesen Zuschreibungen bedient, um ihre menschenverachtende Ideologie zu rechtfertigen. Und wieso spricht darüber niemand? Warum wird es nicht erklärt? Warum sehen sich große Magazine nicht in der Verantwortung, darüber aufzuklären? Weil sie selbst davon profitieren, weil sie Teil eines Marktes sind, der dieses historische Problem zur ‚Frauensache‘ reduziert.“
Hinter dieser systematischen Kontrolle des weiblichen Körpers und den Gründen, wieso schlank gleich schön ist, liegen Strukturen, die viele Menschen – auch Frauen – vielleicht nicht wahrhaben wollen. Oder?
„Es erfordert viel innere Stärke, sich sämtlichen Strukturen, von denen man selbst profitiert, bewusst zu werden. Weiße, gesunde und schlanke Frauen, deren Körper ein Idealbild darstellen, das von machthungrigen Männern definiert wurde, müssten das konsequenterweise auch tun. Da kommt so viel zusammen: Patriarchat, Religion, Kapitalismus – ich kann natürlich verstehen, wieso man das gerne ausblendet und lieber zum Pilates geht. Das Patriarchat verkauft die weibliche Unterwerfung sehr gekonnt als Wellness und spricht neuerdings auch Frauen wie mich mit Ende 40 über das Phänomen ‚Perimenopause‘ an. Das erleben vieler meiner Follower*innen auch. Es ist das neue Wort der Diätkultur. Nahrungsergänzungsmittel, Supplements – ich habe einmal auf eine dieser Werbungen geklickt und jetzt ist meine ganze Instagram-Entdecken-Seite voll mit dem Zeug. Es hört einfach nie auf, egal wie alt man ist. Wir sollen bis zum Lebensende diesem Ideal hinterherlaufen.
Wenn sich Influencer*innen mit Hunderttausenden Follower*innen vor dem Posten einer Story nicht kritisch hinterfragen, ob sie heutzutage noch vom ‚Bikini Body‘ oder ihrem Ziel, vor dem Sommer noch Fett verbrennen zu wollen, sprechen sollten, dann kommen wir einfach nicht weiter. Ich bin an dem Punkt, an dem ich ganz direkt sage, dass man sich dafür auch mal schämen darf. Doch anstatt mehrheitlich kritisiert zu werden, bekomme sie Lob fürs Abnehmen und neue Kooperationspartner, die sie auf ihrem ‚Fat Loss‘-Journey unterstützen.“
Ich frag jetzt mal ganz provokant: Sind dicke Körper wieder „out“?
„Der dünne Körper wird immer im Mittelpunkt stehen. Für eine kurze Zeit durfte ab und zu mal eine Dicke danebenstehen. Dazu habe ich eine gute Anekdote: Vor einigen Jahren war ich Teil einer deutschlandweiten Esprit-Kampagne mit riesigen Plakaten, die unter anderem an Bahnhöfen hingen. Ich neben Sara Nuru und die einzige auf dem Bild ohne Hose, weil mir keine einzige Hose aus der Kollektion gepasst hat. Damit will ich sagen, dass auch zur Hoch-Zeit des Body Positivity-Marketings nicht alles großartig war. Wir durften einfach mal mitspielen. So viel zum Thema ‚in oder out‘.

‚Out‘ führt auch dazu, dass dicke Menschen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und in der Medizin diskriminiert werden. Das macht mich fertig. Dass ästhetische Ablehnung auf dem Niveau ist, dass Menschen außerhalb der Norm in ihrem Alltag behindert werden und um ihre Gesundheit fürchten müssen. Nicht weil sie dick sind, sondern weil sie nicht ernst genommen oder falsch behandelt werden. Diese Diskriminierung betrifft schon mich mit einer Kleidergröße 46. Als ich mal mit Halsschmerzen zum HNO-Arzt gegangen bin, sagte er: ‚Na ja, sie sind ja auch stark übergewichtig‘. Es geht um so viel mehr als Kleidergrößen – es geht um Ausschluss aus der Gesellschaft.“
Wenn es sich bei Nahrungsergänzungsmitteln, Ozempic und Schlanksein als Wellnessprogramm um Trends handelt, die oft in Wellenbewegungen kommen, schaffen wir es vielleicht, das Ruder in Richtung Body Positivity umzureißen?
„Nein. Ich wurde in den letzten Jahren oft gefragt, ob Body Positivity nur ein Trend sei. Ich habe dann immer ganz empört reagiert und gesagt: we are here to stay. Ich dachte ernsthaft, dass es alle verstanden haben und wir endlich gesehen und gehört wurden. Aber das, was jetzt durch die Abnehmspritzen passiert, geht nicht mehr weg. Der Druck wird sogar noch größer werden für alle, die nicht einem bestimmten Ideal entsprechen. Die Industrie hat sich darauf bereits eingerichtet, die großen Größen verschwinden immer mehr aus den Geschäften, online ist Plus-Size nur noch spärlich verfügbar. Darüber hinaus werden die regulären Größen schmaler. Normalgewichtige Menschen betrachten diesen Negativtrend wahrscheinlich nicht als die Gewalt, die er für uns Dicke bedeutet. Für die einen geht es um eine Kleidergröße mehr, für uns verschwindet die Repräsentation.“