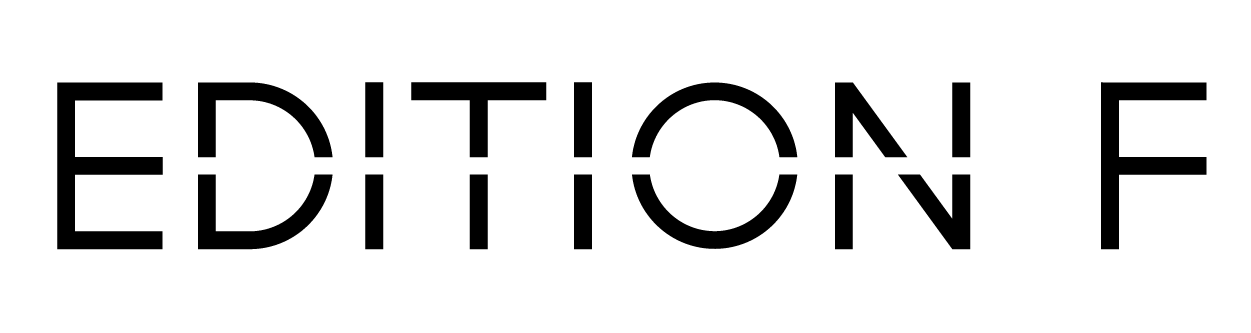Mitten im Alltag, zwischen Bahnhof und Supermarkt, zeigt sich oft, wie schnell Menschen lieber wegsehen, statt ihre Hilfe anzubieten. Unsere Autorin geht in ihrer Kolumne den stillen Momenten nach, in denen Mitgefühl und Zugewandtheit den Unterschied machen könnten – und fragt, wie viel Solidarität unsere Gesellschaft gerade jetzt braucht.
Ich sitze im Zug. Merke, wie sich das Krankgefühl im Körper ausbreitet, während wir nun schon die fünfte Stunde in die Dunkelheit rasen. Wäre gut, wenn das Nasenbluten irgendwann aufhört. Der Mitreisende mir gegenüber starrt vor sich auf den Laptop, schalldichte Kopfhörer auf den Ohren. Ich spüre eine Mischung aus bleierner Müdigkeit und dem Gefühl unsichtbar zu sein und denke darüber nach, wann genau eigentlich dieser Punkt kommt, in dem das erlernte, längst verinnerlichte Wegschauen bei allem, was nicht vertraut ist, einem Hilfsangebot weicht. Wann dieses Diktat des bitte Nicht-Anstarrens, des Nicht-Belauschens, des Nicht-Berührens fremden Menschen gegenüber kurz unterbrochen wird. Der Moment, in dem wir beschließen, dass es nicht mehr übergriffig ist, zu fragen, ob alles ok ist, sondern wichtig.
Natürlich ist mein Nasenbluten nicht der Rede wert. Ich bin eher froh, dass mich niemand anspricht. Aber was wäre, wenn es mehr als ein Taschentuch voll Blut wäre? Was, wenn der eigene Körper einem plötzlich, mitten im Alltag, nicht nur eine kurze Pause-Taste aufzwingt? Wenn man wirklich hilflos wird? Wäre man dann gut aufgehoben, mitten unter Menschen?
Ich denke an den Vater einer Freundin, der vor ein paar Tagen mitten in einem Kaufhaus zusammengebrochen ist. Eine Traube voll Menschen um ihn herum. Zögerlich erst, dann bemüht, später beherzt – dennoch ohne Erfolg. Ein paar Tage später stirbt er. Der Moment verstrichen, wo Zeit nicht da war.
Ich denke an den Obdachlosen, der barfuß durch die U-Bahn läuft und die starren Blicke der Fahrenden auf ihr Smartphone oder aus dem Fenster. Und an den Satz eines Obdachlosen, den ich letztlich irgendwo gelesen habe: „Das Schlimmste von allem ist, wenn sie mich nicht einmal ansehen“.
Die Welt ist seltsam geworden, denke ich mir in solchen Momenten. So mitfühlend wir mit denen sind, die uns lieb und nah sind, so klar liegt doch auch die Trennlinie. Dahinter sind Fremde. Oder das, was man so schön unsere Gesellschaft nennt. Während Kinder noch frei heraus sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, was sie sehen, hört das irgendwann auf. Weil man ihnen sagt, dass sie nicht so laut sprechen sollen, wenn sie fragen, warum der Mann dort keine Schuhe hat und seine Kleidung den Geruch des U-Bahntunnels übertüncht. Irgendwann hört das auf, nach dem hundertsten „Leise. Das fragt man nicht so laut.“
Die Schere zwischen Auseinanderdriften und Miteinander
Dennoch ist das nicht das Bild der Gesellschaft, das ich haben möchte. Denn in ihr steckt auch so viel Gutes. Ich muss nur die Augen aufmachen. Nicht nur das Negative sehen. Die stille Verbundenheit der Frauen im Wartezimmer. Die Verkäuferin, die mich so unfassbar warm anlächelt, dass ich fast erschrecke. Der Moment, wenn tausende Menschen auf einer Demo wie aus einer Kehle „Haltet fest zusammen!“ schreien. Und so viele andere Momente, in denen man denkt: Ja, da ist ein Miteinander. Nicht nur auf den Demonstrationen der letzten Wochen, wo viele Menschen Verbundenheit sichtbar, greifbar und lautstark machen wollten, sondern auch an so vielen anderen Tagen. Gerade weil es Tag für Tag geschieht, ohne viel Lärm und Aufregung, empfinde ich diese Momente als sehr wertvoll.
In einem Kommentar in der FAZ lese ich: „Die AfD wird von vielen nicht wegen ihres Programmes gewählt, sondern trotz.“ Was für eine brandgefährliche Herangehensweise bei einer Wahl, die letztlich für vier Jahre die Politik für uns alle bestimmen wird.
„Angst ist keine gute Beraterin“
Gestern in den Nachrichten ging es um die aktuelle Lage vor der Wahl. Das Wort, das von Seiten der Politiker*innen am häufigsten fiel, war „Unsicherheit“. „Aktuell beeinflussen vor allem Unsicherheit und Angst die Demokratie“, erklärt auch die Neurowissenschaftlerin Maren Urner später in einer Sendung. Und das ist auch in meinem Umfeld irgendwie derzeit das Grundgefühl. Erwachsene Menschen, die auf einmal still werden und dann darüber sprechen, dass sie Angst haben. Dass das diesmal nicht gut enden kann. Dass es alles immer schlimmer wird. Und ja, vor der Wahl in den USA war auch nicht alles rosafarben und einfach. Man wusste um die Zustände dieser Welt. Aber seitdem ist es noch viel schlimmer geworden als vorher. Immer, wenn man denkt, die Welt aktuell ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten, tut sich eine neue Dimension von Irrsinn auf. Man denke nur an die toxische Verbindung von einem Trump mit einem Musk. Man ahnt, dass sich auch bei uns jetzt sehr schnell sehr viel verändern kann. Vieles, was einem als sicher und selbstverständlich erscheint, könnte plötzlich infrage stehen. So wie in den USA, wo bedeutende Auslandshilfen und Diversity-Programme gestrichen und Klimaschutzmaßnahmen eingestellt wurden.
Die Neurowissenschaftlerin stellt die Frage: „Ist es eine Emotion oder ein Thema, das eine Wahl entscheidet?“ Denn oft vermischen wir beides, sagt sie. „Die Angst ist eine gute Beraterin, wenn es jetzt und hier um mein Überleben geht. Und gleichzeitig ist sie eine schlechte Beraterin, wenn es darum geht, sich hinzusetzen und zu überlegen: Wie wollen wir eigentlich Demokratie gestalten? Und das kann ich in Angst und Panik nicht.“ Ich sitze vor dem Bildschirm und frage mich, woher diese Emotionalität kommt. Menschen neigen ja zur Negativität. Aber was bringt uns in derartig geschlossene Angstschleifen? Von Hass und Hetze vor allem auf Social Media gar nicht erst zu sprechen. Und vor allem frage ich mich: Wie kommen wir da raus? Nicht nur jede*r Einzelne, sondern wir alle, als funktionierende Gesellschaft? Dass es nicht reicht, darauf zu vertrauen, dass alles von allein läuft, sollte klar sein. Die fetten Jahre, in denen man womöglich so denken konnte, dass andere sich schon kümmern werden, sind vorbei.
Der erste Weg ist es mit Sicherheit, wählen zu gehen. Aber was kommt danach? Resignation im Falle eines krassen Wahlergebnisses? Resignation im Falle eines knappen, noch für „ok“ befundenen Wahlergebnisses? Beides wäre für ein Miteinander, für eine faire und gerechte Gesellschaft, sicherlich nicht der richtige Weg.
Mein Zug ist angekommen. Ich laufe durch den fast menschenleeren Bahnhof. Nachts ist hier kaum jemand anzutreffen. Nur ein paar Menschen, die Schutz und einen Platz zum Schlafen suchen. Ich werfe ein paar Euro in einen Pappbecher, schaue in müde Augen und denke: Wie gut wäre es, wenn „Solidarität“ das Wort wäre, das wir von Politiker*innen im Wahlkampf am häufigsten hören.
Weitere spannende Themen bei EDITION F
Fake News sind eine Gefahr für die Gleichberechtigung – Sozialpsychologin Pia Lamberty im Interview
Warum Elon Musks verwerfliches Verhalten sich mit etwas ganz anderem als Autismus erklären lässt
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz? – Das können wir alle dafür tun