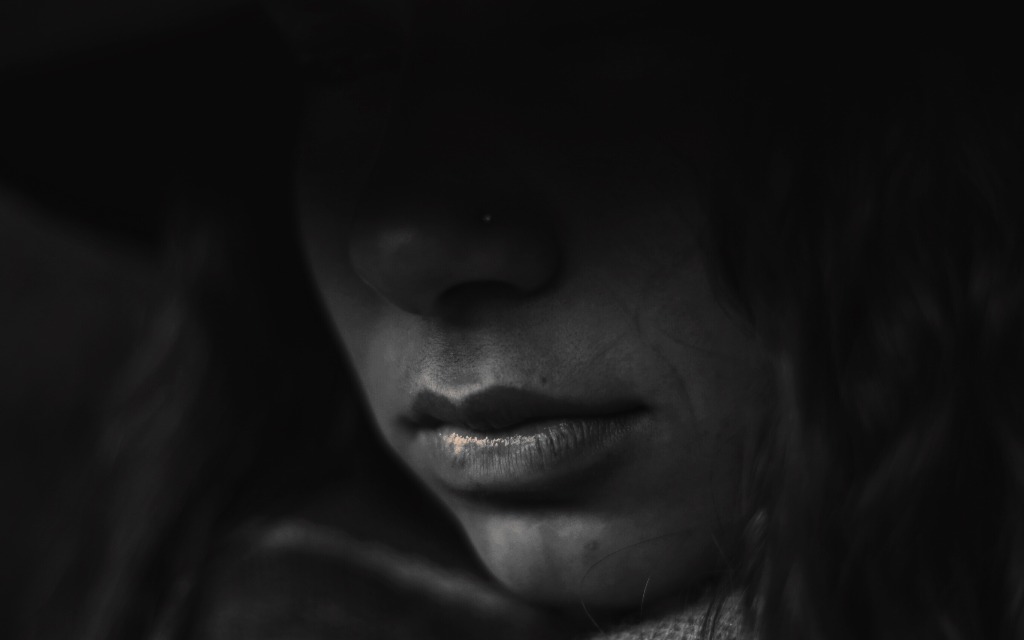Immer noch ein Tabu? Zumindest redet kaum eine Mutter gern darüber: Babyblues und postpartale Depressionen. Elina Penner hat für „Hauptstadtmutti“ einen wichtigen Text zum Thema geschrieben.
Depressionen und Angstzustände seit der Geburt
Vor einigen Monaten traf ich durch Zufall eine alte Schulfreundin wieder. Sie ist vor zwei Jahren von Berlin weggezogen, wir haben beide geheiratet, ich hatte ein Kind bekommen, und sie meiner Meinung nach auch. Doch ich war mir nicht sicher, Lisa hat kein Facebook. Ich frage sie.
„Habe ich. Die Geburt hat mich quasi fast umgebracht, ich brauchte Bluttransfusionen und wurde zwei Stunden wieder zusammengenäht, aber schlimmer sind die Depressionen und Angstzustände seitdem.“
Ich lächle sie an. Lisas lange blonde Haare, ihr zierlicher Körper und ihr elfengleiches Gesicht haben mich noch nie getäuscht. Die Frau ist knallhart, witzig und eine nicht enden wollende Quelle von dreckigen Witzen und großartigen Kalauern. Deshalb wusste ich auch, dass sie niemals Sätze wie „Unser Sonnenschein komplettiert unser gemeinsames Glück zu dritt schon seit Januar“ sagen oder mir haarklein erzählen würde, was ihr Baby kann und macht und tut. Ohne jemals darüber geredet zu haben, waren wir uns einig, dass Babys voll toll und wunderschön sind und halt so ihr Ding machen, wie eben alle Babys. Doch nachdem sie mir DAS mitgeteilt hatte, entwich mir trotzdem ein: „Warum hast du nichts gesagt?“ Sie zuckt mit den Schultern.
„Was hätte das gebracht? Ich wusste ja, was ich durchmache, ich war so schnell wie möglich in psychologischer Betreuung, ich geh zur Zeit zweimal die Woche zur Therapie und nehme meine Medikamente. Ich konnte in den ersten drei Monaten nicht aufstehen, mein Mann hat alles gemacht. Und dann rufe ich bestimmt nicht eine alte Freundin an und sage: ‚Hallo, hab gehört, du hast auch ein Kind bekommen. Geht’s dir auch so scheiße?‘ Außerdem hat man genug zu tun mit Fragen wie ‚Und wie klappt’s mit dem Stillen?‘ oder ‚Schon für’n Rückbildungskurs angemeldet?‘ oder Sätzen wie ‚Oh, das ist die schönste Zeit des Lebens, genieß jeden Moment!‘ und denkt sich dabei ‚Eigentlich bin ich nur froh, dass ich noch lebe.‘“
Sie wusste, dass ich für „Hauptstadtmutti“ schreibe, und auch einen eigenen Blog habe. Noch am gleichen Abend haben wir ausgemacht, dass sie ihre Geschichte aufschreiben sollte. Es ist ein detaillierter Erfahrungsbericht geworden, der nichts auslässt. Ich bin stolz auf meine Freundin, ich bewundere ihren Mut und auch die Nüchternheit, mit der sie meistens über ihre Krankheit spricht. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich schämt, eher noch, dass sie sich ärgert, dass postpartale Depression weiterhin tabuisiert wird.
Ich denke, es ist wichtig, dass ihre Geschichte zum öffentlichen Diskurs beiträgt. Darum möchte ich darüber schreiben. An dem Abend sprach sie über ihre Therapie, Bücher und Organisationen wie Schatten & Licht, die ihr sehr geholfen haben. Sie erzählte mir, dass alles, was sie während ihrer Schwangerschaft über Mutterschaft gelernt, gesehen und gehört hat, beschönigende Darstellungen von Mutterschaft waren, die nichts mit ihrer Realität zu tun hatten.
„Jede Werbung, jeder Blog, jeder Film: Bullshit“
„Wo sind die dunklen Momente? Wo ist die Verzweiflung? Der Dreck und der Gestank? Das ist hart! Das ist ein knochenharter Job! Und ich bin kein naiver Mensch, ich bin auch nicht blöd, ich wusste, dass das kein Zuckerschlecken wird, aber ich meine 15 Prozent aller Frauen leiden an irgendeiner Form von Wochenbettblues und es wird im Vorfeld nichts darüber gesagt und ich finde NICHTS dazu im Internet, es sei denn, ich gehe bewusst und direkt zu Seiten für und von Betroffenen. Das Thema gehört meiner Meinung nach genauso in die Präventionsmaßnahmen bis zur Geburt, wie diese 180 anderen Untersuchungen, die für das Kind gemacht werden oder gemacht werden können. Wie soll man sich bei der mangelnden Aufklärung nicht alleine fühlen, nicht als Freak, wenn man plötzlich so wirre Gefühle und Empfindungen hat ohne Erklärung? Ich konnte meine Depression recht schnell erkennen, weil ich so etwas schon einmal durchgemacht hatte, ich wusste, was los war, aber was ist mit den Frauen, die sich fragen, was mit ihnen nicht stimmt?“
Ich versuchte mich zurückzuerinnern. Egal, mit wem ich sprach, gerade mit Berliner Müttern, viele teilten dieses Gefühl des Alleinseins am Anfang. Manche auch von Überforderung. Vor allen Dingen bei Müttern von Winterbabys. Berliner Winter sind dunkel und lang. Man fühlt sich eh schon beschissen, und dann ist man halb eingeschlossen, erholt sich von den Strapazen der Geburt und sieht keine Menschenseele außer Partner und Hebamme. Klar, die Anstandsbesuche am Anfang sind manchmal eine schöne Abwechslung, aber irgendwie ist ja alles anstrengend. Die Hormone fallen ab, die Haare aus, alles blutet, schmerzt, und der Milcheinschuss lässt auf sich warten. Für viele ist die erste Zeit nach der Geburt nichts, woran sie sich gerne zurückerinnern.
Nein, das muss natürlich nicht bei allen so sein. Die meisten Mütter kommen mit der Umstellung gut zurecht. Sie durchleben weder Stimmungstiefs noch Depressionen, und sie können so gut wie jeden Moment einfach nur genießen. Nach einer Woche richten sie einen Brunch zu Ehren der Geburt ihres Kindes aus und freuen sich über eine volle Wohnung, ihr Leben und ihr Glück.
Das ist vielleicht übertrieben, aber manchmal verweilt man in den Tiefen der Mom-Blogosphere und vor allen Dingen Instagram und man denkt, Celeste Barber ist der einzig normaldenkende Mensch da draußen. Die einzige, die auch nicht glamourös ist, keinen Waschbrettbauch hat, das Kinderzimmer nicht perfekt eingerichtet hat und keine „Outfits“ für ihr Baby zurechtlegt. Manchmal ist der einfachste Schritt, sich dem ganzen Blödsinn zu entziehen, digital abzuschalten und sich mit echten Müttern zu treffen.
Doch was, wenn man dafür nicht stark genug ist? Angst hat rauszugehen? Angst hat zu versagen, sei es auf einem Spaziergang durchs Dorf oder um den Block? Angst davor, alles falsch zu machen? Was ist, wenn man im Kopf schon lange den Koffer gepackt hat? Was ist, wenn man daran gedacht hat, abzuhauen, die Tür zuzumachen? Was ist, wenn man nicht stillen kann und das einem das Gefühl gibt, völlig versagt zu haben? Die Blicke anderen Leute, wenn man im (Still-)Café sein Fläschchen mit Thermoskanne und Milchpulver anmixt? Die Zurechtweisungen der eigenen Mutter, weil sie nicht verstehen kann und will, was man denn nur für ein Problem hat? Der Hass auf den eigenen Körper und die eigenen Gefühle? Wenn man nicht aufhören kann zu weinen?
Was ist, wenn man sein Kind nicht anfassen kann? Was ist, wenn das Kind immer nur schreit, nicht aufhören will, und man sitzt da, und schaut zu wie es schreit, und man möchte auch schreien, aber wer hört zu? Wenn man glaubt, es nicht zu lieben? Wenn sich kein Gefühl von Liebe einstellen will? Wenn da nur Angst und ein bisschen Hass und eine Menge Überforderung ist? Wer versteht einen dann?
Wohin soll dieser verdammte Perfektionismus führen?
Ich sprach mit der Diplom-Pädagogin Melanie Weimer von der Selbsthilfegruppe Blues Sisters / Schatten & Licht e.V. über Babyblues, Wochenbettdepression, Stimmungstiefs und postpartale Depression. Sie steigt sofort in das Thema Perfektionismus ein.
Gerade die organisiertesten Menschen hätten Probleme damit, nachmittags plötzlich immer noch im Schlafanzug zu sein und fragen sich, was sie denn den ganzen Tag gemacht hätten. Jeder Tag wird zum Dienstag. Nichts passiert, und trotzdem hat man die ganze Zeit zu tun. Sie sagt, Frauen, die vorher „alles im Griff“ oder anspruchsvolle Jobs gemeistert hatten, trifft oft es viel mehr als die Frauen, die sowieso immer ein bisschen chaotisch waren.
Strahlend, schön, schick, frisiert, geföhnt. Realität?
Melanie Weimer erklärt, dass gerade die Werbung heutzutage natürlich ein idealisiertes Bild der überglücklichen, geschminkten, reinlichen und organisierten Mutter transportiert und vermittelt. Es bringt dann auch nichts, sich bewusst zu machen, dass das „nur“ Werbung oder Instagram ist, es wirkt dennoch gerade auf die Frauen, die in ihrem eigenen Bekanntenkreis oder der Familie noch keine Erfahrungen mit Neugeborenen oder Babys gemacht haben: Sie kennen nur die Windel- und Breiwerbung.
Doch man muss sich gar nicht über Instagram und Co. aufregen, es geht noch viel einfacher: Das Bild oder die Idee der glücklichen Mutter. Die Mutter muss glücklich sein, froh, dass ihr Kind endlich da ist. Es ist ein freudiges Ereignis, man hat sich monatelang akribisch darauf vorbereitet, alles hingelegt, nachgelesen, geplant. Doch wie viele Frauen empfinden kein Glück nach der Geburt?
Frau Weimer erklärt es mir ganz genau. Je nach Studie, nach Indikator, nach Tests können es auch bis zu 30 Prozent sein. Diese Zahlen kann man natürlich nicht gleichsetzen mit längerfristigen, diagnostizierten postpartalen Depressionen. Nach wirklich strengen ICD-10 Kriterien, wie sie zum Beispiel Dr. Michael Grube von der Stationären Mutter-Kind-Behandlungsstation in Frankfurt anwendet, kann man auch auf den niedrigsten Wert von sieben Prozent kommen. Doch generell lässt sich sagen, dass mindestens jede zehnte Frau bis zu einem gewissen Grad von postpartalen Depressionen betroffen ist. Bei dieser Zahl würde laut Melanie Weimer kein Mediziner oder Therapeut widersprechen.
„Das gabs immer schon, die Wochenbettverrücktheit! Auch im 15. Jahrhundert!
Postpartale Depressionen sind keine neuzeitliche Erfindung. Die Beschreibung der „Wochenbettverrücktheit“ gibt es seit dem 15. Jahrhundert, allerdings natürlich immer als Tabuthema. Doch dass dieses Thema heutzutage unter Umständen anders behandelt wird als früher, zeigt meine Recherche zu Eheratgebern aus den 1950ern. Dort wird explizit darauf hingewiesen:
„Die meisten Frauen, die ein Kind erwarten, leiden oft nicht nur unter körperlichen Beschwerden und Erschöpfungszuständen, sie sind meistens auch seelisch sehr labil und neigen zu Depressionen und Melancholie.“
Meistens. Könnt ihr euch an einen einzigen Ratgeber oder eine Broschüre erinnern, die euch gesagt hat, dass die meisten werdenden Mütter zu Wochenbettdepressionen neigen? Ich jedenfalls nicht. Meistens geht es um Listeriose, Toxoplasmen und Nackenfaltenmessungen. Ist das Kind in Ordnung? Könnte das Kind behindert sein? Wie viele Tests kann ich machen, bis ich mir sicher bin, dass das Kind in Ordnung ist? Wer kümmert sich um die Gesundheit der Mutter?
Melanie Weimer berichtet, dass sie auf Messen regelmäßig von älteren Damen angesprochen wird, die unter postpartalen Depressionen gelitten hatten, aber natürlich nie darüber geredet haben. Sie hat das Gefühl, dass das Thema vor ungefähr 20 Jahren aus der totgeschwiegenen Versenkung auftauchte. Auch dank Celebritys wie Brooke Shields und heute Hayden Panettiere nimmt das öffentliche Bewusstsein für die Krankheit zu (und auch die abfälligen Bemerkungen von Tom Cruise). Die Anzahl der Erkrankungen sei aber nicht gestiegen.
Das Thema ist immer noch scham- und tabubehaftet. Bevor man seine Ärztin, Therapeutin, Mutter oder Freundin anspricht – das setzt voraus, dass man sich bewusst ist, dass man krank ist –, fängt man an zu googlen. In dieser Hinsicht sind die sozialen Netzwerke, die Foren, die digitalen Selbsthilfegruppen natürlich ein Segen. Manchmal traut man sich nicht einmal, eine Organisation wie Schatten & Licht anzurufen, da ist es natürlich einfacher, eine kurze Nachricht zu schreiben. Wobei am anderen Ende der Hotline Mütter warten, die selbst einmal betroffen waren. Die Erkenntnis, nicht die Einzige zu sein, der es so geht, und zu wissen, man ist gar keine Rabenmutter, sondern krank, wirkt auf viele auch erleichternd. Darum helfen Erfahrungsberichte wie der meiner Freundin so ungemein.
Babyblues ist nicht gleich Wochenbettdepression
Was viele Frauen auch nicht wissen: Die sogenannten Heultage oder der Babyblues, direkt nach der Geburt: ganz normal. Für alle. Das ist eher noch die Regel, nicht die Ausnahme. Das muss auch noch nicht eine Depression sein, sondern einfach die Umstellung nach der Geburt. Sollte dieser Zustand sich aber spätestens zwei Wochen nach der Geburt nicht bessern, dann wäre das ein deutliches Alarmsignal, dass es in eine echte Depression übergehen könnte.
Der einzelne schlechte Tag ist nicht das Problem! Jeder noch so psychisch gesunde Mensch kann umgehauen werden oder sich überfordert fühlen, aber am nächsten Tag kann alles wieder gut sein – oder besser. Wenn sich die Traurigkeit oder Wut loslöst von einem äußeren Anlass, wenn der Zustand an sich nicht mehr gut ist, und wenn man nicht sagen kann, warum man sich so fühlt, dann kann es sein, dass die Depression sich vielleicht schon verselbständigt hat.
Auch fehlende Nähe muss kein Anzeichen für eine Depression sein. Es gibt Frauen, die mit Babys oder Kindern nicht klarkommen, und sich auf die Zeit freuen, wenn ihre Kinder älter sind. Deshalb müssen sie aber noch lange keine Depression haben. Auf der anderen Seite gibt es Frauen, die mitten in einer schweren Depression stecken und die Nähe zu ihrem Kind suchen, die nur beim Stillen das Gefühl haben, etwas richtig zu machen. Weimer erklärt, dass es inzwischen auch für stillende Mütter gut verträgliche Antidepressiva gibt, doch da wissen viele Ärzte noch nicht gut genug Bescheid.
Zwei der (viel zu vielen) Serien, die ich gucke, sind Jane the Virgin (sixx/Netflix) und Nashville (Fox/Netflix). Bei beiden werden Frauen dargestellt, die auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise unter postnataler Depression leiden. Doch beide haben eine komplizierte Beziehung zu ihrer eigenen Mutter und beide haben nach der Geburt das Gefühl, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu wollen, um nicht nutzlos zu sein. Beide sehen ihr Dasein als Mutter als Zeitverschwendung an und können keine Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Was mir bei beiden Serien gefiel: Die depressiven Charaktere wurden nicht als weinende, traurige Frauen gezeigt, die im Bett liegen und nicht aufstehen können (auch das ist natürlich eine Form). Es hat sich langsam angebahnt, als Zuschauerin wunderte man sich, was denn mit den beiden ist, und warum sie nicht einen auf happy-peppy-Mommy machen?
„Postnatale Depression. Niemand ist davor gefeit“
Es gibt nie nur eine Ursache. Wenn es einen trifft, haben viele Frauen das Gefühl, es kommt aus heiterem Himmel, unvorhersehbar, doch sobald man sich damit beschäftigt, findet man immer mehrere Ursachen, Belastungen, Wurzeln, Faktoren. Gibt es einen Typ Frau, der besonders anfällig ist? Grundsätzlich gilt, dass Frauen, die bereits zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens unter depressiven Verstimmungen gelitten haben oder schon einmal eine postpartale Depression oder Psychose durchlebt haben, mit einem erhöhten Risiko ausgestattet sind, postpartale Probleme zu entwickeln.
Gerade wenn man vorbelastet ist, sollte man nicht während der Schwangerschaft und schon gar nicht danach Größeres planen (Umzüge und so weiter). Auch die schnelle Hochzeit kurz vor der Entbindung kann belastend sein (muss sie aber nicht). Die Organisation des Alltags mit einem Säugling sollte durchdacht sein. Auch Formen der Unterstützung kann man vorher organisieren, sowie geeignete Betreuungsmöglichkeiten. Sei es, dass man jemanden bittet, auf Abruf da zu sein. Die Entscheidung zu einer Haus- oder Geburtshausentbindung kann das Risiko senken, da eine solche Entbindung selbstbestimmter erlebt wird. Strikte Ruhe nach der Entbindung und in den ersten Wochen nach der Geburt kann das Erkrankungsrisiko senken helfen. Dazu gehört vor allem die Vermeidung von zu viel Besuch und ausreichender Nachtschlaf (nächtliche Versorgung des Babys durch Klinikpersonal oder Familienmitglieder) ist wichtig. Weitere Präventionstipps findet ihr hier.
Melanie Weimer ist selber eine Perfektionistin gewesen, die dann von der Depression überrascht wurde:
„Meine Therapeutin hat mich damals gefragt: Warum haben Sie sich diese Depression ausgesucht? Und ich stutzte. Und war empört. Doch genau wie der Körper beim Bandscheibenvorfall sagt, es geht nicht mehr, genauso sagt auch die Psyche, es geht nicht mehr.“
Melanie Weimer gibt auch Geburtsvorbereitungskurse und sagt, dass die meisten Schwangeren kommen, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Auf den großen Tag! Auch wenn eine gute Geburt ein bedeutender Faktor für einen guten Start ins Elternsein sein kann (sowie eine gute Geburtsvorbereitung oder auch eine Hausgeburt präventiv wirken können), so geht es erst nach dem Tag X richtig los.
„Niemand will den Frauen Angst machen, aber man sollte sich auch schon vorher überlegen, wie man sich sein Wochenbett vorstellt. Vielleicht ist alles gut, und man möchte Besuch haben, vielleicht braucht man aber auch noch ein par Wochen, bis man sich das vorstellen kann. Vielleicht möchte man auch kein schickes Spielzeug und süße Strampler geschenkt bekommen, sondern einfach jemanden haben, der eine Gemüsequiche oder einen Topf Suppe vorbeibringt. Oder die Wäsche aufhängt, das Kind hält… Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen, der Mutter zu zeigen, dass sie das nicht alles alleine schaffen muss.“
Und die Männer?
Es gibt seriöse Artikel, die auch Männer und Depressionen nach der Geburt behandeln. Depressionen ereignen sich oftmals nach oder während großer Lebenskrisen, was nichts anderes heißt als große Umbrüche im Leben, und das ist eine Geburt natürlich! Klar, die körperlichen Ursachen fallen bei Männern weg, zum Beispiel der Hormonabfall.
Doch auf einmal die Verantwortung übernehmen zu müssen, wenn man vorher noch nicht richtig erwachsen sein musste, oder sich plötzlich sogar in der Ernährerrolle wiederfinden – für Männer kann auch das zu viel werden. Liebevoller und engagierter Vater, Liebhaber, Vollzeitangestellter sein zu müssen und an seinem Erfolg gemessen werden. Und attraktiv und tough sein! Die Männer, die auch der perfekte Vater sein möchten, können unter diesem Druck zusammenbrechen. Genau wie die Mutterschaft ist das Vatersein extra, zusätzlich zu allem anderen. Heute sollen Männer sich einbringen, präsent sein und möglichst viel Elternzeit nehmen. Beide Eltern sollen in ihrer neuen Rolle völlig aufgehen und die Erfüllung finden. Das kann für niemanden einfach sein.
Rabenmutter. Dieses Wort.
Auf der anderen Seite ist Mutterschaft so vielfältig wie noch nie. Auch die bewusste Entscheidung, entweder keine Kinder oder Kinder ohne einen Mann zu bekommen, wird mehr und mehr akzeptiert.
Doch was man nicht leugnen kann: Kinder zu haben (oder auch nicht) ist und bleibt Thema für Frauen von circa Mitte 20 bis Ende 40. Nicht, weil sie gerne darüber reden, sondern weil sie tatsächlich immer und immer wieder darauf angesprochen werden und weil es ihren beruflichen Weg beeinflusst. Manche werden nun mit der Biologie ankommen. Dafür gibt es Frauen, dafür ist der weibliche Körper gedacht, man muss ja ein Verlangen danach haben, es muss doch eine tiefe Sehnsucht in jeder Frau stecken, zu gebären. Was ich von solchen Theorien halte, könnt ihr euch denken.
Sagen wir einmal, dank gesellschaftlicher Induktion, ewigem Nachfragen nach Familiengründungsplänen und dem eigenen Verlangen nach beschließt eine Frau, ein Kind zu bekommen. Und weil sie es einfach möchte. Sie ist aufgeregt, hat ein bisschen Angst, das ist normal, sagen ihr alle, sie freut sich. Sie zieht die Schwangerschaft durch, sie fühlt sich manchmal unwohl, das zusätzliche Gewicht macht ihr zu schaffen, alles fällt ihr schwerer, sie mag es nicht, dass man ihr beim Schuhe zubinden helfen muss, sie muss noch so viel erledigen, hat sie wirklich alles besorgt, was man haben muss für so ein kleines Wesen? Sie besucht Stillkurse, Geburtsvorbereitungskurse, sie lässt sich beraten, im Kinderzimmer sind keine Schadstoffe, sie hat eine Excel-Tabelle angelegt mit allen Kitas in der direkten Nachbarschaft, die wird sie noch vom Wochenbett aus anrufen, die Danksagungskarten sind fertig designt, das Studio wartet nur noch auf die Daten und ein Foto, sie hakt Listen ab, sie geht noch einmal essen und noch einmal ins Kino, sie wartet.
Das Kind kommt. Die Geburt ist nicht ideal, aber welche kann das schon sein. Sie fühlt sich körperlich erschöpft. So geht es allen, sagen sie ihr. Das Stillen klappt oder es klappt nicht. Sie versucht es. Sie hört den Ärzten zu, den Hebammen, sie freut sich über Besuch, denn die wollen nur das Baby halten und lassen sie in Ruhe, das gefällt ihr. Sie ist immer noch müde. In den nächsten Tagen blutet sie immer noch stark. Ganze Gewebefetzen fallen beim Duschen aus ihr heraus. Ihr wird schlecht. Ist so viel Blut normal? Ist es, sagen sie ihr. Das Kind schläft viel. Sie auch. Wenn es nicht schläft, isst es. Manchmal guckt sie es an. Schön ist es nicht, ein bisschen fremd, so zerdrückt. Das wird noch, sagen sie ihr. Süß ist anders, denkt sie sich. Sie fängt langsam an, darüber nachzudenken, das Beistellbett abzubauen. Ab wann kann das Kind im eigenen Bett und Zimmer liegen? Sie findet fast nur Einträge zum Familienbett, zur Bindungstheorie, zum Tragen, zum Stillen, zu Pekip, zu Bonding, zum Halten…zum Kotzen. Sie sagt nichts.
Nach ein paar Tagen oder Wochen geht ihr Partner wieder arbeiten, die Familie ist abgereist, ihre Freundinnen melden sich sporadisch. Sie fühlt sich allein. Wenn sie jetzt rausgeht, müsste sie duschen, ab wann soll man mit dem Neugeborenen raus? Sie hat Zeit. Das Kind schläft. Sie möchte auch nur schlafen. Manchmal weint sie. Das Weinen hilft ein bisschen. Essen bestellt sie lieber. Sie hat keine Lust einzukaufen. Oder zu kochen. Die Wohnung ist nicht gerade sauber, es fällt ihr nicht auf. Oder es fällt ihr auf und es stört sie, aber sie kann nichts dagegen machen. Sie kommt nicht zum Duschen. Das Kind muss andauernd umgezogen werden. Alles riecht säuerlich. Irgendwie fragen immer nur alle nach dem Baby. Das fällt ihr erst nach einiger Zeit auf. Bis ihre Oma anruft und fragt wie es ihr geht. Auf einmal heult sie. Sie flennt richtig, sie schluchzt. Sie sagt, dass alles gut ist, sie ist nicht depressiv, sie ist nicht krank, nur vielleicht ein bisschen traurig. Ihre Oma sagt nicht, dass das vorbeigehen wird, ihre Oma sagt, dass sie mit jemandem reden soll.
Einen Selbsteinschätzungstest findet ihr hier.
Als Außenstehende solltet ihr hierauf achten.
Stationäre Behandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind hier möglich.
Diesen Text hat Elina zuerst bei „Hauptstadtmutti“ veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn auch bei uns veröffentlichen können.
Mehr bei EDITION F
An alle Mütter: Wir dürfen Fehler machen, und wir dürfen erschöpft sein. Weiterlesen
Was Frauen wissen sollten, bevor sie Kinder bekommen. Weiterlesen
Frauen vor dem Leben als Mutter warnen? Das ist der falsche Weg! Weiterlesen