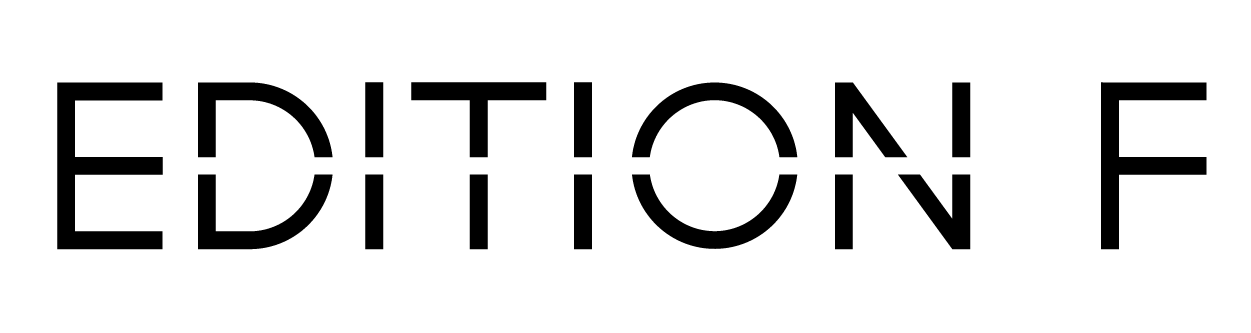Fünf Jahre sind vergangen, seit sich die EDITION F-Redaktion 14 feministische Schlagzeilen für 2025 gewünscht hat – Visionen für eine gerechtere, gleichberechtigte Zukunft. Heute blicken wir zurück: Welche dieser Hoffnungen haben sich erfüllt? Wo gab es Fortschritte, wo Stillstand – und wo erleben wir sogar Rückschritte? Ein Reality-Check zum Feministischen Kampftag 2025.
Der 8. März ist in der Tat der Internationale Frauentag, auch als Feministischer Kampftag bekannt. Dieser Tag hat eine lange und bedeutende Geschichte: Der Internationale Frauentag wurde erstmals 1911 in mehreren europäischen Ländern gefeiert. Die Idee dazu kam von Clara Zetkin, einer deutschen Frauenrechtlerin, die 1910 vorschlug, einen Tag zu schaffen, an dem Frauen weltweit für ihre Rechte und Gleichberechtigung eintreten können.
Ursprünglich konzentrierten sich die Forderungen hauptsächlich auf das Wahlrecht für Frauen und bessere Arbeitsbedingungen. Im Laufe der Jahre gewann der Tag an Bedeutung, insbesondere während des Ersten Weltkriegs und der revolutionären Ereignisse in Russland 1917. Erst 1921 wurde der 8. März als festes Datum für den Internationalen Frauentag festgelegt. Seitdem hat sich dieser Tag zu einer globalen Bewegung entwickelt, bei der FLINTA* (Frauen, Lesben, inter, non-binäre, trans und agender Personen) gemeinsam für Gleichberechtigung und gegen patriarchale Strukturen kämpfen.
Nach wie vor sind wir meilenweit von echter Gleichberechtigung entfernt. Doch was ist eigentlich bislang passiert? Es war vor fünf Jahren, als sich die Redaktion von EDITION F 14 Schlagzeilen überlegte, die sie gerne am 8. März 2025 lesen würde. Wir überprüfen heute, was davon wahr geworden ist, was nicht umgesetzt wurde und wo wir als Gesellschaft sogar Rückschritte gemacht haben.
Schwangerschaftsabbrüche
Vision 2020: „Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland endlich legal – Kosten werden von den Krankenkassen übernommen”
Die Realität im Jahr 2020: In Deutschland wird der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor über das Strafgesetzbuch geregelt. Er ist nur unter besonderen Auflagen straffrei, hinzu kommen eine Pflichtberatung, ohne die kein Abbruch möglich ist, und die Kostenübernahme durch die schwangere Person. Die Regelungen stigmatisieren Personen mit ungewollten Schwangerschaften und erschweren die ohnehin nicht einfache Entscheidung für Betroffene zusätzlich.
Wie es anders geht? Kanada hat es schon 1988, also vor 30 Jahren, vorgemacht. Schwangerschaftsabbrüche sind dort vollständig legalisiert und nicht mehr im Strafgesetzbuch zu finden. Sie werden nun wie jeder andere medizinische Eingriff behandelt und Ärzt*innen sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, Schwangere umfassend zu beraten. Der Oberste Gerichtshof in Kanada schaffte den Abtreibungsparagrafen ab. In der Begründung hieß es, dass Abtreibungsgesetze gegen das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit von Frauen verstoßen würden. Entgegen der Argumentation von Abtreibungsgegner*innen sind die Zahlen der Abbrüche nach der Gesetzesänderung nicht gestiegen, Studien zufolge weiß man schon lange, was die Zahl von Abtreibungen am meisten senkt: umfassende Aufklärung und einfacher Zugang zu Verhütungsmitteln.
Was ist bis 2025 passiert? Eine Abstimmung zur Reform des Paragraf 218 (StGB), die Abtreibungen in den ersten zwölf Wochen legalisieren wollte, ist kurz vor den vorgezogenen Neuwahlen des Bundestags gescheitert. Abgeordnete der SPD, Grünen und Linken hatten sich zusammengeschlossen, um auf den letzten Metern das Gesetz zu ändern, doch die Abstimmung schaffte es nicht mehr auf die Tagesordnung. Da die CDU- und CSU-Fraktion unter Friedrich Merz nun stärkste Kraft im Bundestag ist, wird das wohl auch nicht mehr passieren – zumindest nicht erfolgreich. Die Union ist strikt gegen eine Liberalisierung von Abtreibungen.
Kleinere Erfolge konnte die Ampelkoalition aber erzielen. 2022 wurde Paragraf 219a und damit das „Werbeverbot“ für Abtreibungen abgeschafft. Nun können Kliniken und Praxen auch angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Außerdem wurde 2024 ein neues Gesetz verabschiedet, das Schwangere vor Abtreibungsgegner*innen und Belästigungen schützt.
Gewalt gegen Frauen
Vision 2020: „Finanzierung der Frauenhäuser wird bundeseinheitlich geregelt und aufgestockt“
Die Realität im Jahr 2020: Etwa 20.000 Frauen, sehr oft mit Kindern, suchen jährlich in Deutschland in Frauenhäusern Schutz vor Gewalt. Doch gerade in Großstädten und Ballungsräumen gibt es nicht genug Plätze. So ergaben Recherchen von Buzzfeed 2017: „In Bayern findet etwa jede zweite Frau, die Hilfe sucht, keinen Platz. In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 über 6.000 Frauen abgewiesen, rund zwei Drittel davon wegen Überbelegung. In Schleswig-Holstein erfolgte 2016 auf fast 4000 Anrufe keine Vermittlung.“ Diese Frauen sind weiterhin Gewalt ausgesetzt, durch die sie teils schwere Körperverletzung und seelische Narben erleiden oder sogar ihr Leben verlieren.
Der Zusammenschluss Autonomer Frauenhäuser (ZIF) fordert schon lange, dass sichergestellt sein müsse, „dass alle von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder jederzeit kostenlose Zuflucht und unbürokratische, bedarfsgerechte Hilfe in einem Frauenhaus ihrer Wahl finden können. Dazu gehören insbesondere auch Frauen mit Behinderungen und Frauen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus.“ Die Abkehr vom Modell der Einzelfallfinanzierung und stattdessen eine bundeseinheitliche, einzelfallunabhängige und bedarfsgerechte Finanzierung von Frauenhäusern könnte endlich sicherstellen, dass keine Frau mehr abgewiesen wird, wenn sie Schutz benötigt. Dazu muss sich die Bundesregierung bewegen.
Was ist bis 2025 passiert? Das Gewalthilfegesetz wurde tatsächlich beschlossen. Die Ampel-Regierung hat monatelang um einen entsprechenden Gesetzesentwurf gerungen und konnte sich bis zum Bruch der Koalition nicht einigen. Doch noch vor den Neuwahlen im Februar 2025 konnten SPD und Grüne einen gemeinsamen Gesetzesentwurf durch den Bundestag und -rat bringen. Durch das Gesetz haben von Gewalt betroffene Frauen künftig unabhängig von ihrem Wohnort kostenfreien Zugang zu Frauenhäusern und Beratungsstellen. Bis 2036 beteiligt sich der Bund mit 2,6 Milliarden an den Kosten, die für den Ausbau der Schutzangebote nötig sind.
Um das Gesetz gemeinsam mit der Union auf den Weg zu bringen, mussten allerdings Abstriche gemacht werden. Trans, inter und nicht-binäre (TIN) Personen wurden aus dem Text entfernt und werden demnach auch nicht durch das Gesetz geschützt. Ebenfalls versäumt es das Gesetz, die Hürden und die Diskriminierung, die besonders geflüchtete Frauen betreffen, zu beachten. Das ist vor allem mit Hinblick auf den gesellschaftlichen Rechtsruck und steigender queerfeindlicher und rechtextremistischer Gewalt problematisch.
Das Ziel wurde also mit dem Gewalthilfegesetz erreicht, doch leider werden nicht alle Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt angemessen geschützt. Es gibt also noch klares Verbesserungspotenzial.
Arbeitszeitreduzierung
Vision 2020: „Die 28-Stunden-Woche ist da!“
Die Realität im Jahr 2020: Wer in Deutschland Vollzeit arbeitet, verbringt in der Regel 40 Stunden und mehr mit seinem Job. Viel Zeit bleibt daneben für Familie, Freund*innen und Erholung nicht mehr übrig. Zudem haben die meisten Menschen keine Wahl: Teilzeit-Gehälter oder nur ein Erwerbseinkommen reichen oft nicht mehr aus, um das Nötigste zu finanzieren. Dass die Zahl psychischer Erkrankungen immer weiter steigt, ist ein weiterer besorgniserregender Nebeneffekt davon, dass immer mehr Menschen zu viel arbeiten, ihre Gesundheit und ihre sozialen Beziehungen nicht mehr pflegen können. Doch wie sollen Menschen im Beruf etwas leisten können, wenn sie nicht glücklich und zudem gesundheitlich angeschlagen sind? Worauf warten wir also noch: Die 28-Stunden-Woche muss Realität werden – jetzt, bedingungslos und für alle.
Was ist bis 2025 passiert? Die 28 Stunden-Woche wird noch gar nicht diskutiert, aber über die Viertagewoche wird zumindest gesprochen, wenn nicht sogar erste Ansätze gemacht. Für eine Studie der Uni Münster haben 40 Unternehmen die Viertagewoche ein halbes Jahr getestet und die Ergebnisse waren außerordentlich positiv. Das Stresslevel unter den Arbeitnehmenden sei insgesamt gesunken und 73% der Unternehmen behalten das Modell permanent oder befristet auch nach der Studie bei. Die Studie ist leider nicht repräsentativ, da sich Unternehmen freiwillig meldeten. Doch auch in Großbritannien wurde eine Studie mit 61 Unternehmen durchgeführt. Dort übernahmen ganze 56 Teilnehmer*innen die Viertagewoche nach dem Experiment. Die Ergebnisse waren auch hier eine große Zufriedenheit bei den Beschäftigten und dazu deutlich weniger Fehltage.
Leider ist auch dieses Modell noch weit von einer Reduzierung zu 28 Stunden entfernt, teilweise wird nur auf 38 oder 36 Wochenarbeitsstunden reduziert und damit mehr Arbeitszeit auf die verbleibenden Tage gelegt. Das heißt auch mehr Stress in der verkürzten Arbeitswoche.
Doch gerade scheint es unrealistisch, dass dieses Modell flächendeckend in Deutschland umgesetzt wird. Es scheint sogar, dass der Trend in die entgegengesetzte Richtung geht. Politiker*innen wie der ehemalige Finanzminister Christian Lindner finden, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet würde. In einem Interview sprach der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) davon, dass wir mehr arbeiten müssen und Leistung als Wert gefördert werden solle. Gleichzeitig sehen wir immer mehr Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen.
Pflege
Vision 2020: „Pflegeberufe so beliebt bei Männern wie noch nie!“
Die Realität im Jahr 2020: Frauenarbeit als Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung hat einen Gegenwert von drei Billionen Dollar, fanden die Harvard-Professorin Ana Langer und ihr Team 2015 heraus. Die unbezahlte Arbeit von Frauen im Gesundheitssektor, das heißt die Pflege als ehrenamtliche Tätigkeit oder die Pflege von Angehörigen, macht circa zwei Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts aus. Zum größten Teil findet die Pflege noch immer durch Frauen und privat statt, etwa drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen werden in Deutschland zuhause umsorgt.
Die Öffentlichkeit hält sich raus – was privat passiert, bleibt privat. Was wir brauchen, ist nicht nur mehr Anerkennung und Geld für die Pflegekräfte, sondern auch mehr Männer. Denn wie sollen wir sonst in 15 Jahren den Bedarf decken, wenn die Anzahl pflegebedürftiger Menschen nicht mehr wie heute 2,9 Millionen beträgt, sondern laut Vorhersage weiter um 35 Prozent steigt?
Was ist bis 2025 passiert? Die Zahl der Männer in Pflegeberufen steigt, aber langsam. Mit zuletzt 18% Männeranteil sind wir noch weit von 50:50 im Pflegesektor entfernt. Prognosen vermuten gerade mal, dass bis 2049 20% der Pflegekräfte männlich sind. Das muss deutlich schneller gehen! Das Problem ist allerdings: Pflegeberufe stecken insgesamt in einer Krise. Spätestens seit der Covid-Pandemie ist klar: Krankenhäuser und Pflegeheime sind stark unterbesetzt und daraus folgen schlechte Arbeitsbedingungen mit Überstunden und Überlastung für die Arbeiter*innen. Dazu kommt ein schlechtes Gehalt und damit wirklich kein Anreiz, sondern eher eine Abschreckung vom Beruf. Wir brauchen dringend bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne und infolgedessen mehr Personal in der Pflege!
Dazu kommt, laut dem Gender Care Gap wenden Frauen pro Tag im Durchschnitt 44,3% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer – das sind 79 Minuten pro Tag.
Gender Pay Gap
Vision 2020: „Der Begriff „Gender Pay Gap“ ist Geschichte!“
Die Realität im Jahr 2020: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Dass das jedoch bis dato noch immer in vielen Bereichen keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt nicht zuletzt der Gender Pay Gap. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern noch immer bei 21 Prozent (Stand 2016). Was das eigentlich in Zahlen und Tagen bedeutet, zeigt der Equal Pay Day am 18. März. Dieser markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten müssen, während Männer seit dem ersten Januar für ihre Arbeit entsprechend entlohnt werden.
Warum können wir uns nicht ganz einfach an Island orientieren, wo am 1. Januar 2018 ein Gesetz eingeführt wurde, das Unternehmen ab 25 Mitarbeitern vorschreibt, gleichwertige Arbeit auch mit gleichem Gehalt zu honorieren?
Was ist bis 2025 passiert? Der Gender Pay Gap lag 2024 bei 16 Prozent, im Vergleich zu 2016 ist das ein Rückgang von fünf Prozent, im Vergleich zu 2023 (18%) ein Rückgang von zwei Prozent. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch weit von Gleichberechtigung entfernt. Dazu kommt, dass ab etwa 30 Jahren, dem Durchschnittsalter der ersten Kindesgeburt, der Gender Pay Gap rasant ansteigt. Auf der Regierungsebene stehen immer noch keine Maßnahmen im Raum, den Gender Pay Gap zu verringern.
Armut
Vision 2020: „Das Armutsrisiko alleinerziehender Frauen sinkt“
Die Realität im Jahr 2020: Wenn wir in Deutschland von Alleinerziehenden sprechen, dann sind in der Regel Frauen gemeint, 90 Prozent der Alleinerziehenden sind weiblich.
Das Armutsrisiko für Alleinerziehende steigt seit Jahren an. Mehr als jeder dritte Alleinerziehenden-Haushalt mit Kindern unter 18 Jahren hat im Jahr 2016 Hartz IV bezogen, nämlich 36,9 Prozent. In absoluten Zahlen waren das 606.000 – und damit knapp 42.000 mehr als 2005. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung, die ein eigenes Rechenmodell nutzt, kommt auf die deprimierende Zahl von 68 Prozent der Alleinerziehenden, die armutsgefährdet sind. Der Koalitionsvertrag der alten neuen Großen Koalition sieht allerdings eine Verteilung von Geldern nach dem Gießkannenprinzip vor (Erhöhung des Kindergeldes/Kinderfreibetrags), der allen, also auch nicht bedürftigen Familien, zugute kommt, und nicht gezielt jene unterstützt, die es am nötigsten haben. Das Armutsrisiko ließe sich nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Marcel Fratzscher am besten mit besseren Beschäftigungschancen für Mütter bekämpfen – doch genau an dieser Stelle, so Fratzscher, baut die Politik gerade alleinerziehenden Eltern und Müttern Hürden.
Was ist bis 2025 passiert? Die meisten Alleinerziehenden sind weiterhin Frauen, auch wenn die Zahl der alleinerziehenden Väter langsam steigt, mit zuletzt 18 Prozent im Jahr 2023. Laut aktuellen Zahlen gelten weiterhin 41 Prozent der Alleinerziehenden als armutsgefährdet – diese Zahl könnte allerdings eine unbestimmte Dunkelziffer außer Betracht lassen, weil sie nicht wie in der zuvor erwähnten Studie der Bertelsmann-Stiftung alle Faktoren berücksichtigt. Seit der Corona Pandemie ist außerdem ein Rückgang erwerbstätiger alleinerziehender Mütter zu beobachten, was vermutlich unter anderem mit der Krise des Kinderbetreuungssystems erklärt werden kann. 37,2 Prozent aller alleinerziehenden beziehen Bürgergeld oder andere Sozialleistungen.
Rollenklischees
Vision 2020: „Gendersensible Pädagogik ist jetzt Pflichtfach in der Lehrer- und Erzieherausbildung“
Die Realität im Jahr 2020: Der Umgang mit Geschlechterrollen spielt in der Ausbildung für Lehrer*innen und Erzieher*innen bisher keine geregelte Rolle. Natürlich gibt es hier und da Modellprojekte einzelner Bundesländer, oder besonders engagierte Schulleiterinnen oder Schulleiter, die das Thema auf die Agenda setzen – das Personal für Schulen und Kitas wird aber bisher nicht gezielt darin geschult, wie es Kindern eine unvoreingenommene und offene Haltung vermitteln kann – gleichzeitig werden Kinder durch die immer absurder anmutenden Strategien des Gender-Marketings immer stärker in klassische und klischeehafte Jungen- beziehungsweise Mädchenrollen gedrängt.
Was ist bis 2025 passiert? Es gibt einige Weiterbildungsangebote für geschlechtersensible Pädagogik, aber sie ist nicht Pflicht in der Lehrer*innen- und Erzieher*innenausbildung. Geschlechterforschung insgesamt wird aktuell international immens von Rechten attackiert und teils sogar verboten. Das sieht man aktuell zum Beispiel in Ungarn und sehr extrem in den USA unter Trumps zweiter Amtszeit. Rechtspopulist*innen appellieren gegen geschlechtersensible Bildung und nutzen Kinder als „Waffe“ vor allem gegen die LGBTQIA+-Community. Kinder sollen vor Queerness „geschützt werden“, das heißt im weiteren Sinne auch alles außerhalb der Geschlechternormen.
Verurteilungen bei Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt
Vision 2020: „Die Verurteilungsquote bei Vergewaltigungen und sexualisierter Gewalt ist gestiegen“
Die Realität im Jahr 2020: Bisher führt die Anzeige einer Vergewaltigung in den seltensten Fällen zu einer Verurteilung. Einer der Gründe: Die Arbeitsüberlastung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung ist in den vergangenen Jahren sogar stark gesunken. Im Jahr 2012 ist es nur in acht Prozent der angezeigten Fälle zu einer Verurteilung gekommen. Ein ebenso großes Problem: Nur ein Bruchteil der Fälle sexueller Gewalt werden überhaupt angezeigt, wie Dunkelfeldstudien der Polizei immer wieder zeigen. Ein Beispiel aus Niedersachen: Dort wurde 2014 etwa sieben Prozent der Sexualdelikte angezeigt – aber 94 Prozent der Autodiebstähle.
Was ist bis 2025 passiert? Die Verurteilungsrate bei sexueller Gewalt ist weiter gering, nach einer Studie werden sogar nur etwa 7,5 Prozent aller Täter verurteilt. Leider gibt es nicht viele aktuelle Zahlen, da die Verurteilungsrate nicht vom BKA erfasst wird. Weiterhin wird vermutet, dass circa 85-95 Prozent der Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden.
Doch ein Fall bringt Hoffnung: Die Time Magazin Frau des Jahres 2025 Gisèle Pelicot ist mit ihrem eigenen Prozess an die breite Öffentlichkeit gegangen und hat so eine internationale Debatte zu sexueller Gewalt und Vergewaltigungen gestartet. Die Botschaft: Die Scham muss die Seite wechseln. Pelicot wurde über Jahre mehrfach von ihrem Mann betäubt und von ihm sowie 72 weiteren Männern vergewaltigt. Da ihr Mann die Straftaten selbst aufgezeichnet hat, war die Beweislage eindeutig und alle Männer wurden in einem historischen Gerichtsprozess verurteilt.
Väter in Teilzeit
Vision 2020: „Immer mehr Väter kehren nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit zurück“
Die Realität im Jahr 2020: Das Wort „Teilzeitfalle“ können wir langsam nicht mehr hören – wenn der Begriff fällt, geht es eigentlich immer um Frauen, die nach der Geburt eines Kindes „nur noch“ in Teilzeit in ihr Unternehmen zurückkehren und sich damit Aufstiegschancen dauerhaft verbauen würden. Männer kennen dieses Problem in der Regel nicht, diejenigen, die die Geburt eines Kindes zum Anlass nehmen, mit reduzierter Stundenzahl in den Job zurückzukehren, gelten immer noch als wagemutige Exoten.
Im Jahr 2015 arbeiteten laut Zahlen des Statistischen Bundesamts nur neun Prozent der erwerbstätigen Männer zwischen 20 und 64 Jahren in Teilzeit, als Gründe gaben sie mehrheitlich nicht etwa Familienpflichten, sondern eine Aus- oder Weiterbildung oder die fehlende Möglichkeit eines Vollzeitjobs an. In der Vergleichsgruppe der Frauen arbeiteten 47 Prozent in Teilzeit, hauptsächlich genannter Grund: Kinder.
Was ist bis 2025 passiert? Die Zahl der teilzeitbeschäftigten Männer mit Kindern ist weiterhin sehr niedrig. Väter mit Kindern unter 18 Jahren sind zu acht Prozent in Teilzeit beschäftigt, mit Kindern unter sechs Jahren auch gerade mal 8,6 Prozent. 73 Prozent der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten in Teilzeit. Insgesamt ist die Zahl der Frauen in Teilzeit auf jede zweite angestiegen, bei allen Müttern sind es ganze 67 Prozent.
Verhütung
Vision 2020: „Männer übernehmen Verantwortung beim Thema Verhütung“
Die Realität im Jahr 2020: Noch immer sind Frauen die Hauptverantwortlichen für die Verhütung in heterosexuellen Beziehungen. Und noch immer wirken sich alle existierenden Verhütungsmethoden, abgesehen von der Kupferspirale, dabei massiv auf ihren Hormonhaushalt aus, was eine ganze Reihe von Nebenwirkungen mit sich bringt. Der Risiken durch eine hormonelle Verhütung sind sich zwar viele Männer bewusst. Trotzdem scheint die Pille die einfachste Lösung zu sein. Dabei geht es doch eigentlich nicht nur um Schwangerschaften, sondern auch darum, sich nicht mit Krankheiten zu infizieren. Obwohl sich die Wissenschaft dem Thema der männlichen Verhütung bereits seit vielen Jahren widmet, hat es noch keine der untersuchten Methoden auf den Markt geschafft.
Was ist bis 2025 passiert? Es wird weiterhin erfolglos nach einer „Pille für den Mann“ geforscht. Eine WHO-Studie zu einem vielversprechenden Präparat wurde abgebrochen, weil zehn Prozent der teilnehmenden Männer von Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen, Libido-Verlust oder Depressivität berichteten – also die gleichen Nebenwirkungen, die viele Frauen von der Pille bekommen. Expert*innen bezweifeln, dass die Pille so wie sie ist nach modernen Zulassungsrichtlinien auf den Markt gekommen wäre – dennoch wird sie weiterhin sehr häufig verschrieben. Eine klare Aussicht für eine Pille für Männer gibt es weiterhin nicht.
Klimakrise
Vision 2020: „Klimawandel konnte nachweisbar verlangsamt werden“
Die Realität im Jahr 2020: Der Klimawandel ist ein größtenteils menschengemachtes, nicht aufzuhaltendes Problem. Durch den hohen CO2-Ausstoß erwärmt sich unsere Umwelt. Und wenn dieser Temperaturanstieg nicht aufgehalten wird, schmelzen die Gletscher weiterhin. Der Meerespiegel steigt: Überschwemmungen, neue Krankheitserreger und Nahrungsmittelknappheit sind die Folgen. Die Winter werden milder, die Sommer immer heißer. In der westlichen Welt kommen die gravierenden Folgen bislang nicht so stark an, dass die Bürger*innen hier Anlass zu echter Sorge hätten. Beim Stichwort „Klimaflucht“ zucken sie mit den Schultern.
Durch gezielte Maßnahmen kann jede*r einzelne, als Konsument*in und Verbraucher*in, täglich darauf Einfluss nehmen, dass die Welt an möglichst vielen Orten lebenswert bleibt. Denn Klimaschutz fängt im Kleinen an: weniger Auto fahren, seltener Fleisch essen, Strom sparen, bewusster einkaufen, Müll vermeiden.
Was ist bis 2025 passiert? 2024 wurde erstmals die 1,5 Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens überschritten. 2023 und 2024 waren nacheinander beide die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Extreme Wetterereignisse wie die Flutkatastrophe in Spanien und Waldbrände in Los Angeles nehmen zu. Gleichzeitig stießen protestierende für Klimagerechtigkeit durch ihren zivilen Ungehorsam in den letzten Jahren auf starke gesellschaftliche Ablehnung und starken Widerstand von Bürger*innen und Justiz. Dabei wird Klimaschutz weiterhin jedes Jahr wichtiger und die Politik verfehlt konstant Klimaziele.
Klimaaktivist*innen fordern heutzutage deutlich weniger individuelle Maßnahmen durchschnittlicher Menschen gegen den Klimawandel, sondern wollen vor allem Superreiche in die Verantwortung ziehen. Unterschiedliche Studien zeigen, dass die reichsten Menschen der Welt deutlich mehr Emissionen ausstoßen als der ganze Rest der Welt. Laut Oxfam kommt die Hälfte unserer CO2 Emissionen von den reichsten zehn Prozent der Welt.
Asylpolitik
Vision 2020: „Bundesregierung räumt ein, dass die Aussetzung des Familiennachzugs und eine Obergrenze für Geflüchtete völkerrechtswidrig waren“
Die Realität im Jahr 2020: In den Sondierungsgesprächen zur Großen Koalition haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, den Familiennachzug für Geflüchtete erst einmal weiter bis zum 31. Juli 2018 auszusetzen. Danach soll dieser auf 1.000 Menschen pro Monat begrenzt werden. Außerdem hat sich die zukünftige Regierung auf eine Obergrenze von 180.000 bis 200.000 Menschen pro Jahr geeinigt.
Beide Regelungen führen dazu, dass vor allem Frauen und Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten keinen Schutz in Deutschland finden können. Damit verstoßen beide Maßnahmen aus gutem Grund gegen geltendes Völkerecht. Das sollte die Bundesregierung am besten nicht erst 2025 einräumen – und die Maßnahmen dementsprechend zurücknehmen.
Was ist bis 2025 passiert? Die verantwortlichen Parteien haben nicht nur keine Fehler eingeräumt, die Maßnahmen sollten noch weiter verschärft werden. Der 29. Januar 2025 stellt eine Zäsur da, weil dort CDU/CSU und FDP erstmals gemeinsam mit der AfD einen Antrag durch den Bundestag gebracht. Der sogenannte „Fünf-Punkte-Plan“ der Union sah Völkerrechts- und EU-rechtswidrige Verschärfungen im Asylrecht vor.
Zwei Tage später wurde dann über einen Gesetzesentwurf der CDU abgestimmt. Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz sah vor, den Familiennachzug für Geflüchtete vollständig abzuschaffen. Trotz Zustimmung der AfD wurde für dieses Gesetz zum Glück keine Mehrheit im Bundestag erzielt.
Dennoch sieht es insgesamt düster für nicht nur Asylsuchende, sondern alle Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland aus. Vor der Bundestagswahl sprach unser wahrscheinlich zukünftiger Bundeskanzler Merz von „Remigration“, einen Begriff, den die AfD prägte, der massenhafte Abschiebung über abgelehnte Asylbewerber*innen hinaus zum Ziel hat. Ebenfalls sagte Merz bereits, dass er kriminelle Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsangehörigkeit wieder entziehen wolle.
Da die CDU/CSU stärkste Kraft in der Bundestagswahl geworden ist, die AfD zweitstärkste, eine Große Koalition erneut sehr wahrscheinlich ist und auch die SPD mittlerweile massenhaft abschieben möchte, steht allen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland in den nächsten vier Jahren vermutlich eine schwere Zeit bevor.
Geburtshilfe
Vision 2020: „Jetzt Hebamme werden – noch nie waren die Bedingungen als Hebamme zu arbeiten so gut wie jetzt“
Die Realität im Jahr 2020: Zwar wollen nach wie vor viele junge Menschen, insbesondere Frauen, Geburtshelferin werden, doch aktuell verlassen viele Hebammen vor allem ihren Beruf – meist weniger freiwillig. Denn die Arbeitsbedingungen in den Kliniken sind schlecht, die Hebammen müssen zu viele Geburten gleichzeitig betreuen, freiberufliche Beleghebammen werden durch steigende Haftpflichtprämien und zu niedrige Honorare immer weiter ins berufliche Aus gedrängt. Die Geburtshilfe lohnt sich nicht mehr für diejenigen, die ausgewiesene Expertinnen für Eltern und ihre Babys sind – und darunter leiden vor allem Schwangere, Gebärende und die Allerkleinsten. Schon jetzt finden viele Schwangere in der Zeit vor der Geburt nicht mehr die Betreuung, die ihnen zusteht und sie sind bei der Geburt oder im Wochenbett auf sich allein gestellt. Niemand sollte in dieser Zeit allein gelassen werden – vor allem nicht, weil eine gute Betreuung durch Hebammen körperlichen und seelischen Erkrankungen vorbeugen kann.
Was ist bis 2025 passiert? Die Arbeitsbedingungen von Hebammen sind weiterhin unzumutbar. Fast die Hälfte aller Hebammen betreut gleichzeitig drei Personen während der Geburt. Empfohlen ist eine 1:1 Betreuung, die nur 16 Prozent der Hebammen gewährleisten können. So wie bei anderen Berufsgruppen in der Pflege sind auch hier die Arbeitszeiten zu hoch und die Vergütung zu niedrig. Mit der Kampagne „Frauen zahlen den Preis“ setzte sich der Deutsche Hebammenverband (DHV) zur Bundestagswahl 2025 für eine Reform in der Geburtshilfe ein.
Genitalverstümmelung
Vision 2020: „Weibliche Genitalverstümmelung weltweit abgeschafft“
Die Realität im Jahr 2020: Noch immer werden in einigen Ländern wie im westlichen und nordöstlichen Afrika sowie im Jemen, im Irak und Indonesien Genitalverstümmelungen bei Frauen durchgeführt. Der Grund: die Frau soll keine sexuelle Lust verspüren. Die Eingriffe finden unter großem Hygienemangel und -risiko statt und werden an Mädchen und Frauen vom Säuglings- bis hin zum Erwachsenenalter durchgeführt. Die meisten erfolgen jedoch zu Beginn der Pubertät. Nach der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit 200 Millionen Frauen von der Genitalverstümmelung betroffen. In Europa leben etwa eine Million Frauen, die diese Form der Körperverletzung und Traumatisierung erlebt haben. Auch wenn die Genitalverstümmelung in den meisten europäischen Staaten verboten ist, reichen die existierenden Gesetze nicht aus, um es zu Strafverfahren kommen zu lassen.
Weder Ärzt*innen erhalten in ihrer Ausbildung das nötige Know-how, um Betroffenen medizinisch helfen zu können, noch ist die Genitalverstümmelung als Asylgrund anerkannt. Dabei hat solch ein Eingriff gravierende Folgen – physisch ebenso wie psychisch.
Was ist bis 2025 passiert? Laut einer neuen Studie von UNICEF sind mittlerweile 230 Millionen Frauen und Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen – also eine Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zu den Werten davor. Dennoch wurden Fortschritte gemacht. Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte ist die Wahrscheinlichkeit, als Mädchen beschnitten zu werden um ein Drittel gesunken. Die Vereinten Nationen haben es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 weibliche Genitalverstümmelung zu eliminieren, doch es ist unklar, ob dieses Ziel erreicht werden kann.
Weitere Vorschläge für feministische Schlagzeilen von unseren Leser*innen aus dem Jahr 2020
„Rentensystem reformiert – wie Generationen von ,Hausfrauen‘ eine gerechte Rente bekommen“
Was ist bis 2025 passiert? Das Rentensystem ist leider immer noch nicht reformiert worden.
„Bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen eingeführt – Kompensation fürs Gender-Pay-Gap und andere strukturelle Benachteiligungen“
Was ist bis 2025 passiert? Es ist keine Kompensation für den Gender-Pay-Gap vorgesehen, aber in Hamburg wird es bald einen Volksentscheid zu einem Testlauf für ein (geschlechtsunabhängiges) bedingungsloses Grundeinkommen geben.
„Anpassung der Wahlgesetze in Deutschland an das Grundgesetz : Wahllisten müssen von den Parteien bei allen Wahlen paritätisch besetzt werden“
Was ist bis 2025 passiert? Eine Anpassung gab es nicht. Der Frauenanteil im 20. Deutschen Bundestag liegt bei gerade mal 32,4 Prozent – vor allem Union und AfD stellen deutlich mehr Männer im Bundestag.
„Das seit 2 Jahren geltende Care Gesetz hat dafür gesorgt, dass
a) Frauen ohne schlechtes Gewissen Mutter UND Berufstätige sein können
b) alle Väter Elternzeit nehmen
c) es einen Run von Männern und Frauen auf besser bezahlte Pflegeberufe gibt“
Was ist bis 2025 passiert? Leider gibt es kein Care-Gesetz.
„Die Bundesregierung hat ein Fürsorgegehalt eingeführt, damit private Care-Arbeit nicht mehr arm macht“
Was ist bis 2025 passiert? Auch das ist leider aktuell noch ein Traum.
Fazit
Es ist ermutigend zu sehen, dass wir an einigen Stellen Fortschritte gemacht haben. Doch gleichzeitig gibt es noch viel zu tun – und besorgniserregend ist, wo wir Rückschritte erleben. Umso wichtiger ist es heute, laut und entschlossen für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Demokratie einzutreten.