Wie schaffen wir gerechte Verhältnisse am Arbeitsmarkt? Iris Bohnet ist Professorin an der Harvard Universität und forscht zu der Frage, wie die Gleichstellung in Unternehmen gelingt. Ein Interview.
Ein Vorhang für mehr Gerechtigkeit
Für viele Jahre lag der Frauenanteil bei den fünf besten Orchestern Amerikas insgesamt bei etwa fünf Prozent. Um zu überprüfen, ob Frauen wirklich die schlechteren Musikerinnen seien, ließ eine Jury die Bewerberinnen und Bewerber hinter einem Vorhang vorspielen. Und siehe da – der Frauenanteil ging steil nach oben.
Iris Bohnet mag Vorhänge. Die Verhaltensökonomin und Harvard-Professorin forscht zu der Frage, wie man es ohne Quote schafft, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Außerdem berät sie internationale Unternehmen bezüglich fairer Bewerbungsverfahren. Die Ergebnisse ihrer Forschung hat sie in ihrem Buch „What works. Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann“ veröffentlich. Wir haben mit ihr über das optimale Bewerbungsverfahren, den Abbau von Rollenbildern und ihre Abneigung gegen Bewerbungsgespräche gesprochen.
Warum ist die Art, wie Unternehmen aktuell neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auswählen, nicht optimal?
„Das größte Problem besteht darin, dass immer noch viele Unternehmen Menschen aus ihren Netzwerken einstellen. Also bekommen Freunde von Freunden von Freunden die Jobs. Außerdem beobachten wir, dass die Menschen, die neue Stellen besetzen, sich gerne selbst reproduzieren. Man stellt jemanden ein, der einem ähnlich ist. Dadurch wirft man das Netz nicht weit genug und schließt Menschen aus dem Pool der Bewerberinnen und Bewerbern aus. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es aber Unternehmen die aktiv gegen unbewusste Vorurteile angehen. Sie setzten ihre Stellenanzeigen sehr viel bewusster auf und analysieren diese darauf, ob geschlechtsneutrale Sprache verwendet wird. Aktuell gibt es die ganze Bandbreite dazwischen.“
Ist das Problem der Reproduktion der eigenen Person ein männliches?
„Nein. Wir alle haben die Präferenz, für Leute, die so aussehen, wie wir selbst und uns ähnlich sind. Das kann sich auf das Geschlecht beziehen, aber auch Hautfarbe oder – besonders in Amerika – auch auf die Universität. Da aktuell aber überwiegend Männer an der Spitze von Wirtschaft und Politik stehen, heißt es eben häufig das Reproduzieren eines anderen Mannes.“
Sie sprechen von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Was genau bedeutet das?
„Am einfachsten lässt sich das an der Wortwahl erklären. Es gibt inzwischen Algorithmen, die analysieren können, wie wahrscheinlich es ist, dass sich eine Frau oder ein Mann auf eine bestimmte Stelle bewirbt. Wenn wir das Verhältnis in dieser Gruppe konstant halten wollen, müssen wir unsere Wortwahl überprüfen. Studien zeigen, dass mehr Frauen auf eine Stellenausschreibung reagieren, wenn in dieser Wörter wie ‚kooperativ‘ oder ‚Teamarbeit‘ verwendet werden. Männer werden eher von Begriffen wie ‚Führungswillen‘ oder ‚wettbewerbsorientiert‘ angesprochen. Ein interessantes Beispiel, dass das verdeutlicht, ist eine Grundschule in Amerika, die mehr Männer anstellen wollte. In ihrer Anzeige verwendeten sie Worte wie ‚kollaborativ‘ und ‚warmherzig‘, was die sowieso schon unterrepräsentierten Männer noch weniger anzog. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass diese Eigenschaften Männern fremd sind. Aber in unseren Köpfen sind solche Stereotypen fest verhaftet. Darum assoziieren die meisten Menschen bestimmte Begriffe eher mit Männern oder eben eher mit Frauen. Schon in unseren Stellenaussschreibungen begrenzen wir also unseren Talentpool.“
Warum ist es für Unternehmen wichtig, ihre Teams divers aufzustellen?
„Da gibt es vor allem drei Gründe. Erstens ist Gleichberechtigung ein Menschenrecht. Das wird leider nicht von allen als wichtigstes Argument anerkannt, darum muss man es immer wieder erwähnen. Darüber hinaus zeigen aber ganz viele Studien, dass diverse Teams besser abschneiden als homogene, beispielsweise wenn es um die kollektive Intelligenz geht. Wenn wir uns diverse Aufsichtsräte und Vorstände anschauen, dann lassen sich positive Zusammenhänge genauso beobachten, allerdings ist es sehr viel schwieriger, die Kausalität wissenschaftlich zu beweisen. Denn natürlich kann es auch sein, dass Firmen, die hohe Positionen mit Frauen besetzen, generell zukunftsorientierter und progressiver sind und dadurch erfolgreicher.“
Was sind konkrete Möglichkeiten für Unternehmen, um Einstellungsprozesse weniger voreingenommen zu gestalten?
„Wenn ich mit einer Firma arbeite, versuchen wir zuerst, das Problem zu diagnostizieren. Ich mag die Terminologie der Medizin, weil sie zum einen voraussetzt, dass wir zuerst die Ursache identifizieren müssen, um das Problem zu beheben, und weil ich meine Arbeit gerne mit einer ‚klinischen‘ Studie überprüfe: Hat die ‚Medizin‘ gewirkt? Dementsprechend schaue ich als erstes, was für eine Stelle das Unternehmen besetzen möchte. Wie sieht die Geschlechterverteilung bei den Uniabschlüssen dieser Berufsgruppe aus? Wie viele der Absolventen und Absolventinnen bewerben sich bei dem Unternehmen, wie ist die Verteilung von Männern und Frauen? Daran kann man bereits erkennen, wie gut die Ausschreibung ist. Wenn sich auf eine Stelle besonders wenig Frauen bewerben, muss man schauen: Wie ist die Wortwahl, wie die Reputation des Unternehmens?
Bei vielen Firmen folgt auf die Ausschreibung die Evaluation des Lebenslaufs. Wenn man in diesem Schritt wieder überdurchschnittlich viele Frauen verliert, muss man sich fragen, ob das daran liegt, dass die Namen auf den Lebensläufen ersichtlich waren. Forschung zeigt, dass Frauen bessere Chancen haben, eine Runde weiter zu kommen, wenn die Bewerbungen anonymisiert sind.“
Und danach?
„Meistens folgt dann leider noch immer ein Bewerbungsgespräch. Man muss sagen: Unstrukturierte Bewerbungsgespräche sind das schlechteste Prognose-Instrument überhaupt. Es ist nicht so, dass nichts Sinnvolles passiert in so einem persönlichen Gespräch, allerdings spielen uns unsere unbewussten Vorurteile und Sympathien einen Streich und beeinflussen unsere Meinung über unser Gegenüber, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Das ist der sogenannte Halo-Effekt: Dinge, die eigentlich irrelevant sind, spielen eine Rolle in der Evaluation von Menschen.
Für uns ist es schwierig, dieses ‚Rauschen‘ von den ‚sauberen‘ Informationen zu trennen. Nun ist die Frage, wie können Unternehmen das besser lösen? Am effektivsten ginge das, wenn wir uns nur auf die empirische Evidenz bezüglich Effektivität verlassen, mit der Abschaffung der Interviews, allerdings weiß ich selbst, dass das nicht besonders realistisch ist. Aber was man zumindest tun sollte, ist der Übergang von einem unstrukturierten zu einem strukturierten Interview. Das heißt, dass wir feste Fragen haben und allen Bewerbern und Bewerberinnen die selben Fragen stellen. Im Nachhinein stellt man die Antworten der jeweiligen Fragen dann tabellarisch nebeneinander und vergleicht die Antworten.
„Das beste Prognose-Instrument ist – und das sollte niemanden überraschen – eine Arbeitsprobe der Person.“
Eine wichtige verhaltensökonomische Einsicht ist, dass es Menschen sehr schwer fällt, absolute Evaluationen zu machen. Wie gut mir ein Kaffee schmeckt, hängt davon ab, was für Kaffee ich normalerweise trinke. Durch die vergleichende Evaluation kann ich besser beurteilen, wie gut eine Bewerberin oder ein Bewerber ist und schütze mich selbst davor, in eine stereotyp-lastige Bewertung zu verfallen. Schon durch diese einfachen Punkte können wir Interviews sehr viel fairer und effektiver gestalten. Das beste Prognose-Instrument ist allerdings – und das sollte niemanden überraschen – eine Arbeitsprobe der Person. Wenn man eine Aufgabe kreiert, die der täglichen Arbeit in dem Job sehr ähnlich ist, sehe ich am schnellsten, ob jemand dafür geeignet ist. So wird die tatsächliche Leistung gemessen und nicht, ob ich jemanden gut leiden kann.“
Ist Sympathie völlig irrelevant, wenn es darum geht, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden? Oder gibt es Möglichkeiten, Sympathie mit einzubeziehen, allerdings ohne sich von ihr leiten zu lassen?
„Wem Sympathie in einem Arbeitsverhältnis wichtig ist, kann man natürlich als letzten Punkt in einer Fragen-Matrix im Bewerbungsgespräch Punkte für die Sympathie vergeben. Außerdem ist es gut, vorher zu bestimmen, wie man Sympathie in der Entscheidung gewichten möchte. Selbst wenn man Sympathie am Ende mit 50 Prozent gewichtet, ist das noch besser, als unbewusst von ihr beeinflusst zu werden. Das ist ein großes Anliegen von mir. Ich möchte das Unbewusste sichtbar und damit auch kontrollierbarer machen.“
Ich habe auch schon Interviews mit Personalerinnen geführt. Dabei fielen Sätze wie „Anonymisierte Bewerbungen könnte ich mir prinzipiell vorstellen. Aktuell ist ist sowas aber nicht in Planung“ oder „Sowas brauchen wir nicht. Wir haben keine Vorurteile“. Warum tun sich immer noch so viele Unternehmen schwer damit, ihre Bewerbungsprozesse anzupassen?
„Das Personalwesen ist noch die letzte Hochburg der Intuition. Aber ich denke, dass wird sich in den nächsten zehn Jahren stark verändern. Die eine Herausforderung ist, dass es noch immer zum Selbstbild vieler Personaler gehört, zu denken dass sie eine besonders gute Menschenkenntnis hätten. Dem ist aber nicht so. Da gibt es tatsächlich Tausende von Studien, die zeigen, dass wir uns sehr häufig irren, wenn wir uns auf unsere Intuition verlassen. Außerdem ist es leider bisher immer noch nicht in der Ausbildung angekommen. Die wenigsten Personaler und Personalerinnen lernen, mit Big Data zu arbeiten oder kennen sich mit Statistik aus, sodass viele Probleme gar nicht erkannt werden können. Alle Firmen sollten in ,Workforce Analytics‘ investieren. Oft höre ich in Unternehmen: ‚Wir haben kein Problem!‘ Das kann gut sein. Die Frage ist nur, ob Unternehmen aufgrund von Zahlen und Fakten zu diesen Ergebnissen kommen oder ob es wieder eine Frage des Bauchgefühls ist.“
Sie haben in Interviews darüber gesprochen, dass Frauen auch durch die Rollenvorstellungen der Gesellschaft daran gehindert werden, Karriere zu machen. Wie können wir unsere gesellschaftlichen Vorstellungen von geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen verändern?
„Das ist sehr schwierig. Unsere Rollenbilder kommen immer zumindest zum Teil aus der Realität. Wenn ich zum Beispiel keine Frauen in Führungspositionen sehe, dann halte ich es als Frau auch für unwahrscheinlicher, selber zum Leader aufzusteigen. Ich denke, es ist einfacher, zuerst unsere Umgebung zu verändern und dann werden im zweiten Schritt unsere Denkmuster folgen. Wenn wir es Frauen einfacher machen, Karriere zu machen, wird es mehr Frauen in hohen Ämtern geben und dementsprechend werden sich die Bilder in unseren Köpfen verändern. Dazu gibt es Evidenz aus Indien.
Dort wurde das bisher größte Quotenexperiment durchgeführt. 1993 wurde die Verfassung so verändert, dass ein Drittel der Bürgermeisterämter mit Frauen besetzt werden mussten. Dieses Drittel wurde zufällig ausgewählt und seit 24 Jahren können wir beobachten, welche Auswirkungen diese Gesetzesänderung hatte. Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit in Science zeigt, dass in Städten und Dörfern, die mindestens zwei Bürgermeisterinnen hatten, sich die Rollenbilder veränderten. Der IAT, ein wichtiger Test bezüglich implizierter Vorurteile, wurde dort durchgeführt, aber genauso wurden Einstellungen und Karriereerwartungen gemessen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Karrierewunsch der Eltern sich in dieser Zeit stark veränderte: Heute wünschen sich viele Eltern für ihre Töchter, dass sie Politikerinnen werden.“
Kann eine Frauenquote also dabei helfen, die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern in Unternehmen auszugleichen?
„Ich versuche immer, da ganz wissenschaftlich dran zu gehen. In England war ich involviert in einem Projekt, in dem es darum ging, bis 2015 25 Prozent Frauen in Verwaltungsräte zu bringen – und das ohne Quote. Das brauchte natürlich sehr viel mehr verhaltensökonomische Einsichten. Die Quote ist normalerweise nicht mein Instrument. Aber wenn Sie mich fragen, was sind die Vorteile, dann kann man sagen, der große Vorteil ist – wie das Beispiel aus Indien zeigt – dass wir, was wir sehen, sehr schnell verändern können. Aber eine Quote allein reicht nicht. Quoten verändern zwar die Rollenbilder, die wir haben, es befreit uns aber nicht davon, die Verzerrungen in unseren Organisationen zu korrigieren und eine Kultur zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen und entfalten können.“
Sie erwähnen immer wieder die Unterschiede zwischen Männern und Frauen – zum Beispiel, dass Frauen in Entscheidungsprozessen häufig weniger risikofreudig sind als Männer. Auch Gegner der feministischen Bewegung berufen sich gerne darauf, dass Frauen und Männer einfach grundsätzlich unterschiedlich veranlagt seien. Sind Unterschiede biologisch bedingt oder werden sie uns kulturell anerzogen?
„Da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Mein Argument ist allerdings: wir werden es nicht wissen, solange wir keine Chancengleichheit haben. Aktuell ist das aber nicht der Fall, daher lassen sich gerade auch keine Aussagen darüber treffen. Was einigen Menschen nicht bewusst ist, ist, wie früh diese Sozialisierung der Geschlechter einsetzt. Es gibt eine Studie, die Kindern geschlechtsneutrale Holzpuppen gezeigt hat. Die eine Figur hatte die Hände in die Luft gestreckt und war in einer Power-Pose. Die andere stand gekrümmt, versuchte sich klein zu machen. Die Kinder sollten die Puppen beschreiben. Von den Vierjährigen wurden die Puppen als groß und stark oder klein und schwach beschrieben. Die Sechsjährigen sagten, die eine Puppe sei ein Junge, die andere ein Mädchen. Etwas war in diesen zwei Jahren passiert, wodurch bei den Kindern diese Stereotypen verankert wurden.“
Was können wir heute tun, um Mädchen auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten?
„Wir brauchen Kontrastereotypen in den Medien – sowohl für Mädchen, als auch für Jungen. Wir brauchen Bilder, die Kindern zeigen, dass es Feuerwehrfrauen geben darf, Krankenpfleger, Präsidentinnen, damit unsere Kinder nicht auch mit unseren Stereotypen groß werden. Schön ist, dass wir langsam diversere Heldinnen und Helden in Filmen und Büchern bekommen. So etwas ist wichtig, so etwas hilft.“
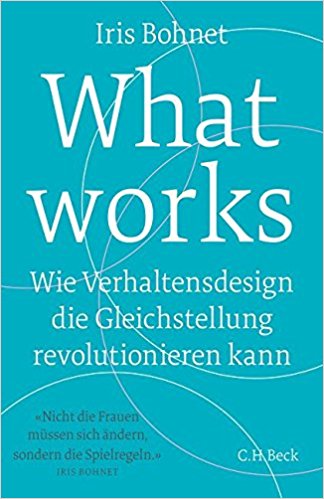
Iris Bohnets Buch „What works: Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann“ ist am 29. August 2017 erschienen.
Mehr bei Edition F
Wie ein Tech-Unternehmen 50 Prozent Frauenanteil schaffte – ohne Quote. Weiterlesen
Warum die Quote allein nichts bringt. Weiterlesen
Bericht zeigt: Frauen in Vorständen bleiben eine Seltenheit. Weiterlesen


