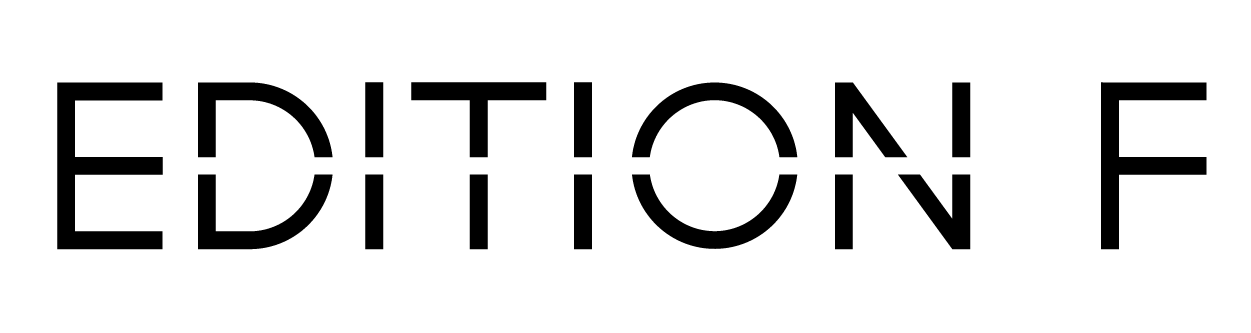Heute vor drei Jahren griff Russland die Ukraine an. In Deutschland wird der Krieg mittlerweile vor allem als Zahlenspiel betrachtet, doch für die Ukrainer*innen bedeutet der 24. Februar 2022 eine Zäsur. Unsere Autorin Marta Zamira Ahmedov hat ukrainische Frauen gefragt, wie ihr Alltag derzeit aussieht und wie sie auf den Krieg in ihrer Heimat blicken.
Es gibt Tage, die man niemals vergisst. Für viele Menschen sind das persönliche Meilensteine wie die eigene Hochzeit oder die Geburt ihrer Kinder. Für 44 Millionen Ukrainer*innen ist es der 24. Februar 2022. Egal, wen aus der Ukraine man fragt; egal, welche Wege dieser Mensch seitdem gegangen ist – jede*r kann von dem Moment erzählen, in dem ihm*ihr klar wurde: Jetzt ist Krieg. Und dieses Jetzt dauert seit drei Jahren an.
In Deutschland stumpfen Augen und Ohren dafür mittlerweile ab. Es ist immer schwieriger, Aufmerksamkeit auf den Krieg zu lenken, den Russland gegen die Ukraine führt – und zwar nicht erst seit drei Jahren, sondern bereits seit der Besatzung der Krim und den Kämpfen in der Ostukraine 2014. Die aktuelle Lage ist dramatisch: Immer noch greifen russische Drohnen und Soldaten täglich an, nicht nur an der Front, sondern in der gesamten Ukraine. Große Teile der zivilen Infrastruktur wurden zerstört, hunderttausende Familien durchleben die Minusgrade im dritten Kriegswinter ohne Heizung, Strom oder fließendes Wasser.
Und immer wieder werden Zivilist*innen getötet, auch außerhalb der Front. Allein für die Dauer der russischen Belagerung von Mariupol geht man von etwa 25.000 Toten aus, bis heute ist die Stadt besetzt. Das Dunkelfeld der zivilen Todesopfer ist in der gesamten Ukraine groß. Ausgerechnet in dieser Lage verharmlost Donald Trump die russische Verantwortung für den Krieg und möchte gemeinsam mit Wladimir Putin über Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verhandeln.
Zahlenspiel statt Empathie für zerstörte Leben
Wenn in Deutschland über den Krieg gesprochen wird, passiert das oft nur noch in Form von Zahlen. Wie viele Menschen befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine? Wie viele Milliarden Euro hat Deutschland für die Ukraine ausgegeben? Wie viel Munition geliefert? Wie viele Meter Land ist Russland wieder vorgerückt?
Das lässt vergessen, um wen es eigentlich geht: 44 Millionen Menschen, die mit dem 24. Februar 2022 ihre Heimat und ihr gewohntes Leben verloren haben. Während es vielen Deutschen zunehmend schwerfällt, sich mit dem Krieg zu beschäftigen, haben Ukrainer*innen gar nicht die Wahl, das nicht zu tun.
Eine von ihnen ist Yana Skybenok, 44 Jahre alt, ursprünglich aus Tschernihiw nördlich von Kyjiw. Sie erinnert sich noch ganz genau an den Tag, an dem ihre neue Wirklichkeit begann. „Ich bin morgens ganz normal zur Arbeit gefahren. Plötzlich hat meine Schwiegermutter mich angerufen und gesagt, dass der Krieg angefangen hat. Ich habe ihr erst nicht geglaubt, dann hat unser Abteilungsleiter uns versammelt und es bestätigt“, erzählt sie. „Er hat uns gesagt, dass es unsere persönliche Entscheidung ist, ob wir bleiben oder gehen wollen.“
Yana fuhr nach Hause, traf sich dort mit ihrem Mann und den beiden Töchtern. In den nächsten Wochen verbrachten sie die meiste Zeit in einem Tiefenlager vor ihrem Haus, um sich vor Luftangriffen zu schützen. Bis heute wird ihr von dem Anblick und Geräusch von Flugzeugen unwohl, auch Silvester kann sie aufgrund der Raketen nicht genießen. Als ihre Töchter wegen der Kälte in ihrem Unterschlupf beide krank wurden, entschied Yana sich, zu fliehen. Über Kyjiw fuhren sie in den Westen der Ukraine bis nach Polen, zufällig gerieten sie da in einen Bus, der sie ins deutsche Nirgendwo brachte: Nach Peenemünde in Mecklenburg-Vorpommern.
Wie der Krieg Familienstrukturen verändert
Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind in den letzten drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Je nach Schätzung sind etwa 70 Prozent von ihnen Frauen, viele der männlichen Geflüchteten sind noch Kinder. Auch Yana kam allein mit ihren beiden Töchtern nach Deutschland. Ihr Mann hätte aufgrund seiner körperlichen Behinderung vielleicht sogar fliehen dürfen, aber er wollte nicht. Den meisten ukrainischen Männern bleibt diese Entscheidung verwehrt, weil sie das Land nicht verlassen dürfen.
„Die typische Struktur von ukrainischen Familien hat sich durch den Krieg grundlegend verändert“, sagt dazu die Soziologin Dr. Olena Strelnyk, die an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kyjiw zu Geschlechterverhältnissen in der Ukraine forscht. Seit Kriegsausbruch beobachtet sie einen steilen Anstieg der Zahl von Alleinerziehenden und Witwen. „Frauen müssen dadurch mehr Verantwortung tragen. Sie leisten die Sorgearbeit für ihre Kinder ganz allein und müssen auch finanzielle Sicherheit allein gewährleisten. Dafür übernehmen viele von ihnen Jobs, die bisher männlich dominiert waren.“ Dies sei eine enorme Belastung für die Frauen, über die gesellschaftlich jedoch nur wenig gesprochen werde, weil das akute Kriegsgeschehen Vorrang habe.
„Mein Mann und ich sind kein Paar mehr. Nur zwei Menschen, die sich kennen“, sagt Yana zu den persönlichen Folgen des Krieges für ihre Familie. Anfangs hätten sie noch täglich miteinander telefoniert, inzwischen haben sie einmal wöchentlich einen Termin, der sich wie eine Verpflichtung anfühle. „Wir sprechen nur noch darüber, welche neuen Zerstörungen es in der Stadt gibt und wer gestorben ist“, sagt sie. Die Telefonate ermüden Yana. Sie will wieder in die Zukunft schauen können. Gerade lernt sie intensiv Deutsch. Mit 44 Jahren eine neue Sprache zu lernen, ist nicht leicht, aber Yana strengt sich an und besucht sogar freiwillige Zusatz-Kurse.
„Wir sprechen nur noch darüber, welche neuen Zerstörungen es in der Stadt gibt und wer gestorben ist.“
– Yana Skybenok
Ihr Ehrgeiz hat einen Grund: „Ich will hierbleiben. Auch, wenn es einen Waffenstillstand gibt, will ich nicht zurück in die Ukraine“, sagt sie. Die Folgen des Krieges werden in der Ukraine voraussichtlich noch Jahrzehnte spürbar sein. Yanas Lebensstandard würde also auch im Falle eines Friedensabkommens in Deutschland höher sein als in der Ukraine. Vor allem für ihre Töchter erhofft sie sich hier eine bessere Zukunft.
Gleichberechtigung durch Krieg gefährdet
Nicht alle ukrainischen Frauen denken so wie Yana. Einige wollen unbedingt zurück, andere haben die Ukraine nie verlassen. Laut der ukrainischen Politikerin Natalia Kalmykova (bis September 2024 Vize-Verteidigungsministerin) dienen sogar mehr als 67.000 Frauen freiwillig der ukrainischen Armee, 48.000 von ihnen in einer militärischen Funktion. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Erst seit 2014 dürfen sich Frauen in der Ukraine den Streitkräften anschließen, seit 2016 dürfen sie sich an Kampfhandlungen beteiligen.

Foto: privat
„Große Teile der ukrainischen Gesellschaft und Politik vertreten ein traditionelles Geschlechterrollenbild“, ordnet die ukrainische Soziologin Olena Strelnyk diese späte Entwicklung ein. Umfragen würden jedoch zeigen, dass geschlechtsspezifische Stereotype in der ukrainischen Bevölkerung seit Kriegsausbruch abgenommen haben. Auch die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen wurde seitdem von der Ukraine ratifiziert, was einen wichtigen Erfolg der feministischen Bewegung darstellt.
Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist durch den Krieg laut Olena Strelnyk jedoch auch gefährdet. Die Wehrpflicht für Männer erzeuge eine große Kluft zwischen den Geschlechtern. Männer, die aus dem Krieg zurückkehren, würden häufiger häusliche Gewalt ausüben. Und auch langfristig sieht die Soziologin die Gefahr, dass Frauen von der hohen Verschuldung durch den Krieg sozial überproportional betroffen sein werden. Daneben gibt es eine sehr akute Bedrohung für Frauen in der Ukraine: Russische Soldaten setzen sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe ein. 376 solcher Fälle haben die Vereinten Nationen (Stand: November 2024) dokumentiert, die Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt.
Der Horror dieser Methode verbreitet sich in der Ukraine wie ein Feuer. Auch in die 18-jährige Yuliia Darmenko haben sich Schilderungen der Taten eingebrannt. Eine Freundin hat ihr von einer zu Tode vergewaltigten Frau in Kharkiv erzählt, in Telegram-Channels hat sie immer weitere solcher Geschichten gelesen. Seitdem ist sie ein anderer Mensch, sagt Yuliia. Der Krieg habe sie ernst gemacht.
Psychische Belastung durch den Krieg
Als die russische Vollinvasion in die Ukraine begann, war Yuliia gerade einmal 15 Jahre alt. Schon am Abend vor dem 24. Februar war sie unruhig. Die Familien einiger ihrer Freundinnen waren da schon in den Westen der Ukraine gefahren, um sich in Sicherheit zu bringen. „Ich habe meine Mutter gebeten, dass wir uns für die Nacht isolieren, aber sie wollte meinen kleinen Bruder nicht aufwecken“, sagt sie. „Am Morgen kam dann mein älterer Bruder in mein Zimmer gestürmt und hat gerufen: ,Yuliia, du musst aufwachen, der Krieg hat angefangen!‘“

Das erste Jahr des Krieges verbrachte Yuliia in ihrer Heimatstadt in der Nähe von Kyjiw. Im Sommer 2022 machte sie dort sogar noch ihren Schulabschluss. Doch im folgenden Herbst startete Russland eine große Offensive, bei der viel zivile Infrastruktur zerstört wurde. „Wir hatten nur noch für zwei Stunden pro Tag Licht und Strom. Um lernen zu können, musste ich in einen Laden in meiner Nähe gehen, der Generatoren aufgestellt hatte. Das war nicht leicht, ich bin in eine Depression gefallen und habe viele Tage im Bett verbracht“, erinnert sie sich.
Eine Freundin, die mit ihrer Mutter nach Deutschland geflüchtet war, bot an, dass Yuliia zu ihnen kommen könnte. Im Januar 2023 brach Yuliia tatsächlich auf und fuhr allein per Bus bis nach Hamburg. Ihre Familie hat sie seitdem nur einmal wiedergesehen, im letzten Sommer, als sie für eine Woche in der Ukraine zu Besuch war. Mit 16 in ein anderes Land zu ziehen war nicht leicht für sie. „Ich habe das Gefühl, dass mir etwas weggenommen wurde“, sagt sie. „Wenn ich deutsche Jugendliche in meinem Alter sehe, bin ich deshalb manchmal neidisch.“
Deutsch zu lernen, fällt Yuliia immer noch schwer. In ihren ersten Monaten in Deutschland machte sie noch ein Fernstudium an der Universität in Kyjiw, aber auch dabei konnte sie sich schlecht konzentrieren. „Ich habe eine Posttraumatische Belastungsstörung und bekomme Medikamente gegen Depression und Angstanfälle, aber eigentlich bräuchte ich eine Therapie“, sagt sie.
In Deutschland setzen sich vor allem junge Frauen aktivistisch für die Ukraine ein
Trotz dieser Belastung will Yuliia sich nicht abschotten. „Der Krieg hat mich politisiert“, sagt sie. Sie will in Deutschland darauf aufmerksam machen, was in ihrer Heimat geschieht. Damit ist sie Teil eines größeren Phänomens: In Deutschland sind es vor allem junge Frauen, die sich aktivistisch für die Ukraine einsetzen. Sie organisieren Demonstrationen und Spendensammlungen, in großen Städten wie Hamburg oder Berlin kann man sie oft an öffentlichen Plätzen beobachten. Während viele ukrainische Geflüchtete sich Ruhe wünschen, wird diese Gegenbewegung vor allem von Ukrainerinnen getragen, die schon länger in Deutschland leben.
„Der Krieg hat mich politisiert.“
– Yuliia Darmenko
Eine von ihnen ist Ilona Naydyonova. 2006 kam sie als Neunjährige nach Deutschland, heute ist sie 27 Jahre alt. Ursprünglich stammt sie aus Sewastopol, eine Stadt auf der ukrainischen Krim, die 2014 von Russland eingenommen wurde.

„Wir waren jeden Sommer zu Hause in der Ukraine. Im März 2014 hat meine Mutter plötzlich gesagt: Wir können diesen Sommer nicht hinfahren, die Russen sind in Sewastopol einmarschiert“, erzählt Ilona. Bis dahin sei ihre Heimat für sie nie politisch gewesen, damals spürte sie zum ersten Mal eine Wut auf Russland.
Als die Vollinvasion 2022 begann, sei das alles wieder hochgekommen. „Nach dem 24. Februar bin ich spontan nach Berlin gefahren und habe dort einige Wochen verbracht, um am Hauptbahnhof zu helfen und Geflüchtete in Empfang zu nehmen.“ Schließlich änderte Ilona sogar ihr Studienfach und studiert jetzt Politikwissenschaft und Slavistik, um den Krieg besser zu verstehen.
„Die meisten Deutschen wissen nur sehr wenig über die Ukraine“, sagt sie. „Sogar, dass der Krieg schon viel früher begonnen hat und meine Heimatstadt Sewastopol seit 2014 unter russischer Okkupation leidet, wissen nicht alle.“ Das will sie ändern und nach ihrem Studium über internationale Konflikte aufklären.
Flucht aus der Ukraine
Svitlana Kaidash weiß aus eigener Erfahrung, wie lang der Krieg bereits andauert: Die 50-Jährige kommt aus dem Osten der Ukraine. 2014 wurde sie mit ihrer Familie schon einmal für drei Monate evakuiert, als prorussische Separatisten die Stadt kurzzeitig besetzten. Auf ukrainisch heißt Svitlanas Heimatstadt Mykolajiwka. Sie selbst nennt sie Nikolajewka, es ist die russische Bezeichnung. Schon das verrät viel über die Unterschiede innerhalb der ukrainischen Bevölkerung: Im Westen des Landes sprechen viele Menschen Ukrainisch und gerade jüngere Menschen wollen bewusst kein Russisch sprechen – im Osten sieht das ganz anders aus.

In der Region, aus der Svitlana kommt, sind einige Menschen sogar prorussisch eingestellt. „Viele Männer aus Nikolajewka sind zum Arbeiten nach Russland gefahren, weil die Löhne dort besser waren“, sagt Svitlana. Auch ihr Mann hat sich dazu entschieden und ist 2014 nach Russland übergesiedelt. Svitlana wollte nicht mitkommen, weil sie sich mit dem politischen System in der Ukraine wohler fühlte. Der Krieg hat ihre Ehe endgültig zerrissen.
2023 verstarb ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen in Russland, da war Svitlana schon in Deutschland. Kurz nach der Vollinvasion flüchtete sie gemeinsam mit ihrer Tochter Kateryna, die damals 13 Jahre alt war. Sie fuhren gen Westen durch die Ukraine, bis sie durch einen deutschen Journalisten auf die Idee kamen, nach Deutschland zu fliehen. Dort kamen sie zuerst lange bei Privatpersonen unter. Um sich eine eigene Wohnung leisten zu können, zogen sie schließlich nach Rathenow in Brandenburg.
Die deutsche Bürokratie erschwert den Alltag
Während des Interviews steht Svitlana plötzlich auf und ist kurz weg. Als sie wiederkommt, schleppt sie Aktenordner an. Einen, zwei, drei, am Ende hat sie acht Ordner aufgetürmt, die sich in drei Jahren Deutschland angesammelt haben. Briefe vom Jobcenter, Aufenthaltsdokumente, Strom- und Gasrechnungen, Bewerbungsschreiben, Unterlagen von der Schule ihrer Tochter, all das sammelt sie gewissenhaft, heftet es Monat für Monat ab.
„Ich glaube, die Deutschen sehen uns Ukrainer immer noch als Fremde.“
– Svitlana Kaidash
Die deutsche Bürokratie ist eine Belastung für Geflüchtete, über die wenig gesprochen wird. Während die FDP ein bürokratiefreies Sabbatical für deutsche Unternehmen fordert, wird von Geflüchteten einfach erwartet, dass sie mit dem Schwall an Dokumenten klarkommen, der sie nach ihrer Ankunft überspült. Svitlana beschwert sich darüber nicht. Auch nicht darüber, dass sie schon fast ein Dutzend Bewerbungen geschrieben hat, um wieder als Chemikerin arbeiten zu können – alle davon erfolglos. „Ich glaube, die Deutschen sehen uns Ukrainer immer noch als Fremde und wollen uns erstmal mit Abstand beobachten“, erklärt sie sich die vielen Absagen, die sie trotz ihrer hohen Qualifikation erhalten hat. Gar nicht zu arbeiten, ist für sie aber keine Option. Stattdessen arbeitet sie aktuell Vollzeit in einer Fabrik für Verpackungen.
Wie Svitlana sprechen auch Yana und Yuliia sehr gut von Deutschland. Saubere Luft. Schöne Gebäude. Volle Regale im Supermarkt. Die Beschreibungen sind positiv, aber auch distanziert. Man merkt ihnen an, dass in ihr Leben in Deutschland noch kein gewöhnlicher Alltag eingekehrt ist, in dem sie sich wohlfühlen. Auch, wenn sie im Kontrast dazu über ihre Heimat sprechen, die es so nicht mehr gibt.
Wie soll es weitergehen?
Jedes Gespräch gerät an einem bestimmten Punkt ins Stocken. Immer, wenn es zu einer bestimmten Frage kommt. Wie soll es aus deiner Sicht mit dem Krieg weitergehen?
Es ist zermürbend, sich diese Frage drei Jahre lang jeden Tag aufs Neue zu stellen, wenn die Aussichten auf echten Frieden immer weiter schwinden. Die Antworten kommen deshalb zögerlich. Aber dann sind sie doch alle auf ihre eigene Weise sehr klar.
„Ich sehe gerade keine Aussicht auf echten Frieden.“
– Ilona Naydyonova
„Die Ukraine muss befreit werden, weil wir unter russischer Besatzung nicht leben können“, sagt Yuliia.
„Ich will einfach, dass nicht mehr täglich so viele Menschen sterben“, sagt Svitlana.
„Ich sehe gerade keine Aussicht auf echten Frieden“, sagt Ilona.
„Ich bin keine Expertin für Politik“, sagt Yana. „Aber ich denke, dass Europa konsequent sein und weiterhin helfen sollte.“
Die vier Frauen zeigen, wie unterschiedlich Ukrainer*innen mit dem Krieg umgehen. Die einen versuchen, drei Jahre später nach vorne zu schauen und sich nicht darin zu verlieren, was ihnen genommen wurde. Andere sind immer noch dabei, ihr Trauma zu verarbeiten. Und manche wollen auch aus Deutschland heraus einen Beitrag leisten, um sich gegen den Angriff zu verteidigen. Alle vereint jedoch, dass ihr Leben aus der Zeit vor dem 24. Februar 2022 nie wieder zurückkommen wird. Und insofern kann keine von ihnen dem Krieg jemals wirklich entkommen.