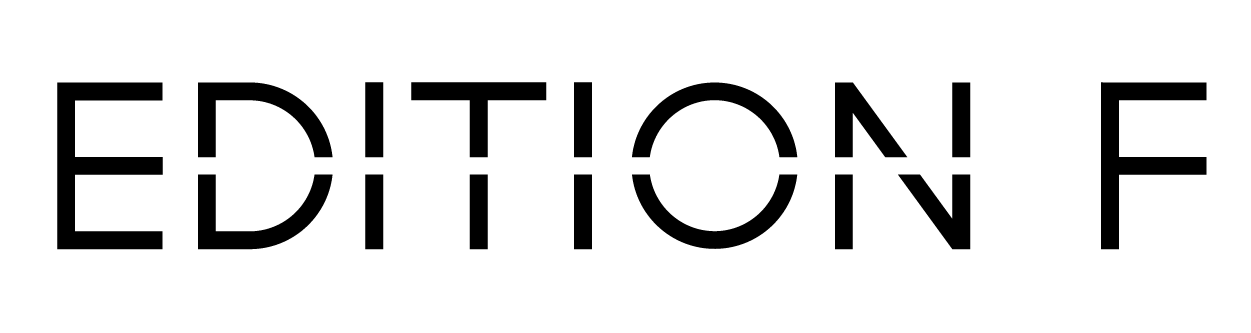Das Gewalthilfegesetz wurde am 14. Februar vom Bundesrat beschlossen. Es ist hart erkämpft und längst überfällig. Wir wollten wissen: Wie sieht der Alltag in der Antigewaltarbeit aktuell aus? Wir sprachen mit der stellvertretenden Leiterin des Vereins Paula Panke in Berlin und mit einer hier tätigen Sozialarbeiterin.
Das endlich beschlossene Gewalthilfegesetz ist ein wichtiger Schritt zur Beseitigung von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt. Ab 2032 sollen demnach von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder einen kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Zudem soll ein bundesweit flächendeckendes Hilfesystem entstehen, welches mit 2,6 Milliarden Euro bis 2036 finanziert werden soll. Wie sieht die Realität in der Antigewaltarbeit aus? Und: Verbessert das neue Gesetz wirklich die Situation aller von Gewalt betroffenen Personen?
Das Frauenzentrum Paula Panke ist ein Ort des Austausches. Chancengleichheit, gesellschaftliche Partizipation und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind Kern der „Paula-Panke-Philosophie“. Paula Panke existiert seit 1990. Mittlerweile gehören drei Zufluchtswohnungen für gewaltbetroffene Personen zum Angebot. Im Interview mit Nadja Bungard, zuständig für Programm- und Öffentlichkeitsarbeit sowie stellvertretende Leiterin von Paula Panke, und mit Rahel*, Sozialarbeiterin in der Anti-Gewalt-Arbeit (*den vollständigen Namen dürfen wir zum Schutz der Mitarbeiterin nicht veröffentlichen) sprachen wir über die Bedürfnisse der von Gewalt betroffenen Personen und warum insbesondere Menschen mit Behinderungen sowie trans, inter, nicht-binäre und agender Personen dringend mitgedacht werden müssen.
Das Jahr 2025 ist noch jung. Aber es zählt bereits 14 vollendete und 28 versuchte Femizide (Quelle: Erhebung One Billion Rising). Mich macht das wütend. Aber warum gibt es hier keinen Aufschrei wie in anderen Ländern, z.B. in Frankreich, Italien oder Spanien?
Nadja Bungard: „Auch mich macht das wütend. Aber wir haben ja gesehen, wo sich ein Großteil der Leute empört: Wenn sich junge Menschen auf der Straße festkleben, um das Klima zu schützen und die dicken Autos nicht mehr durchkommen – da gibt es große Emotionen. Aber das Thema Gewalt wird noch immer viel zu häufig als Familiendrama und individuelles Problem dargestellt. Ganz langsam beginnt die Öffentlichkeit zu verstehen, dass der Femizid eine geschlechtsbezogene Gewalttat ist und wir arbeiten daran klarzumachen, wo die Gewalt eigentlich beginnt.
„Das Thema Gewalt wird noch immer viel zu häufig als Familiendrama und individuelles Problem dargestellt.“
Nadja Bungard
Das merken auch wir in unserer täglichen Arbeit. Frauen sind sich oft gar nicht bewusst darüber, dass sie in einer gewaltvollen Beziehung leben und potenziell gefährdet sind. Sie erkennen die Anzeichen nicht. Hier brauchen wir viel mehr Prävention.“
Der Bundestag hatte das Gewalthilfegesetz Ende Januar bereits verabschiedet. In der Merz-Lautstärke ging diese Meldung etwas unter. Ich möchte wissen: Was hat das mit Ihnen gemacht? Was ist gut am Gewalthilfegesetz? Und wo sehen Sie Lücken?
Nadja Bungard: „Es ist gut, dass dieses Gesetz den Bundestag passiert hat. Ein echter Meilenstein. Denn mit der Verabschiedung erkennen die Gesetzgeber*innen ein Stück weit an, dass es ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist und dass gehandelt werden muss. Dass es in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unterging, war vielleicht sogar hilfreich. So wurde es von konservativer Seite nicht sofort wieder heruntergespielt.
Leider hat das Gewalthilfegesetz auch Lücken: TIN* (trans, inter und nicht-binäre Menschen) Personen sind ausgenommen. Aber gerade sie sind, ähnlich wie Personen mit Behinderung, stärker von Gewalt betroffen und haben zu wenig Schutz. Außerdem dauert die Umsetzung bei der hohen Opferzahl viel zu lange. Daran sieht man wieder, dass der Schutz von FLINTA (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen) keine hohe Priorität hat.“
„Leider hat das Gewalthilfegesetz Lücken: trans, inter und nicht-binäre Personen sind ausgenommen. Aber gerade sie sind stärker von Gewalt betroffen und haben zu wenig Schutz.“
Nadja Bungard
Wir befinden uns mitten im Wahlkampf. Im TV-Duell zwischen Merz und Scholz wurde über Migration und Wirtschaft diskutiert. Es ging mit keinem Wort (auch nicht von Seiten der Moderation) um Gewaltschutz, Care-Arbeit, Kinder, Armutsbekämpfung oder Visionen für eine gerechtere Zukunft. Wenn die entscheidenden Politiker (und Moderatorinnen) jetzt vor Ihnen säßen: Was würden Sie ihnen sagen?
Rahel: „Ich bekomme direkt eine Gänsehaut: Wir brauchen eine sichere Finanzierung. Wir brauchen Perspektiven, mit denen wir planen können. Wir brauchen Strukturen, die stabil sind und die bedarfsgerecht sind und die alle mit einschließen. Strukturen, die Prävention beinhalten und niedrigschwellige Angebote. Wir fordern, dass auf die Fachkräfte und auf die Expert*innen gehört wird. Es sind unglaubliche Kämpfe, die wir in Kontakt mit Verwaltungen und Politiker*innen austragen. Warum muss das sein? Wir sprechen sehr deutlich und haben sehr klare Forderungen: eine vollumfängliche Umsetzung der Istanbul-Konvention und des Gewalthilfegesetzes.“
Nadja Bungard: „Ich würde gern von den Politiker*innen wissen, woher diese mittelalterliche Rollenvorstellungen kommen. Warum sie gegen die Gleichberechtigung sind, was für Paula Panke auch ein Gründungsanlass war. Und wie eine alternde Gesellschaft mit immer weniger Fachkräften es ohne Frauen schaffen möchte, weiter zu bestehen? In was für einer Blase befinden sich die Politiker*innen? Mich stört die Arroganz. Nach dem Motto: ,Das ist ja Kleinkram – Care-Arbeit, Altersarmut von Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt – was geht mich das an?’ Aber hinter jedem erfolgreichen Mann steht immer noch meistens eine Frau, die ihm den Rücken freihält, Hemden bügelt, Essen besorgt, den Alltag organisiert. Das wird nicht gesehen.“
Zentral bei Paula Panke ist ja genau das: die Zusammenhänge zu sehen durch einen ganzheitlichen Ansatz und eine intersektionale Herangehensweise.
„Ja, wir machen nicht nur Antigewaltarbeit, sondern auch viel Kultur- und Bildungsarbeit, sodass wir Leuten, die keinen Zugang zu Bildung haben, zum Beispiel weil sie es sich nicht leisten können, diesen Zugang ermöglichen. So wurde hier das Buch ,Mama Superstar’ vorgestellt, in dem Töchter ihre Mütter feiern, die nach Deutschland gekommen sind und hier für ihre Familien ein vollkommen neues Leben aufgebaut haben. Wenn das Menschen hören, die eine ähnliche Geschichte haben, ist das ein wahnsinnig empowernder Moment.
„Prävention wird gerade in der Sozialen Arbeit oder Sozialpolitik nicht gern unterstützt, weil es sich nicht direkt messen lässt.“
Rahel, Sozialarbeiterin
Mittlerweile haben wir zwölf Selbsthilfegruppen, zum Beispiel ,Reden wie Rosa’, wo Frauen lernen, wie sie auf einer Bühne einfach mal eine Rede halten und selbstbewusst auftreten können. Oder die Krabbelgruppe: Hier begreifen die Beteiligten oft erst im Austausch mit den anderen, dass das, was sie zum Teil in ihren Familien, bei Behörden oder auf der Straße erleben, eine Form von Gewalt ist – das betrifft auch die sogenannten ,gutbürgerlichen Haushalte’ hier in Pankow. Wir können dann sofort intervenieren und Hilfe anbieten. Es ist extrem wichtig, dass es diesen niedrigschwelligen Erstzugang gibt.“
Rahel: „Ja, Niedrigschwelligkeit ist eigentlich das Wichtigste. Denn hier liegt ein ganz großer Teil der Prävention. Und Prävention wird einfach gerade in der Sozialen Arbeit oder Sozialpolitik nicht gern unterstützt, weil es sich nicht direkt messen lässt. Man wird eher zeitlich verzögert wissen, ob sich das Geld, das man in die Prävention gesteckt hat, wirklich auszahlt. Und das ist ein riesiges Problem. Antigewaltarbeit beginnt sehr früh. Es kann nicht nur Krisenhilfe sein, wenn schon längst etwas passiert ist. Es geht los bei von Gewalt betroffenen Kindern, und hier sehen wir einen großen und immer größer werdenden Bedarf.“
Hintergrund: Gewalt gegen Kinder
Kinder sind immer mitbetroffen von häuslicher Gewalt, sie stellen eine eigene Betroffenengruppe dar.
Kindeswohlgefährdungen: Im Jahr 2023 wurden mindestens 63.700 Fälle von Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt gemeldet. Unter Berücksichtigung fehlender Daten wird die tatsächliche Zahl auf etwa 67.300 geschätzt. Die häufigste Gefährdungsart war Vernachlässigung (58 %), gefolgt von psychischer (36 %), körperlicher (27 %) und sexueller Gewalt (6 %).
Sexuelle Gewalt: Im Jahr 2023 wurden 18.497 Kinder unter 14 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs, was einem Anstieg von 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Jeden Tag werden in Deutschland durchschnittlich 54 Kinder Opfer sexueller Gewalt.
Häusliche Gewalt: Fast ein Viertel der Opfer innerfamiliärer Gewalt im Jahr 2023 waren unter 14 Jahre alt.
Die Dunkelziffer bei allen Formen von Gewalt gegen Kinder wird jedoch als erheblich höher eingeschätzt, insbesondere bei sexueller Gewalt, da viele Fälle nicht gemeldet werden
Wie kam es zur Gründung von Paula Panke – und wie hat sich der Verein bis heute entwickelt?
Nadja Bungard: „Die Zeit Anfang der 90er-Jahre war für viele Frauen im Osten Berlins sehr schwierig. In der DDR war es üblich, dass fast alle Frauen arbeiten gingen. In der Wendezeit verloren dann viele von ihnen ihre Arbeit und für ihre Kinder gab es keine Betreuung mehr. Beim damaligen Arbeitsamt bekamen sie häufig zu hören, dass sie sich lieber um Haushalt und Familie kümmern sollten, statt auf einen neuen Job zu hoffen. Das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau war auf dem Papier zu finden, in der Realität allerdings kaum.
Damals bildeten sich infolgedessen verschiedene Frauenzentren im ehemaligen Osten von Berlin, dazu gehörte 1990 auch Paula Panke in Pankow. Der Fokus in diesen Einrichtungen lag auf der Weiterbildung und Beratung für erwerbslose oder von Erwerbungslosigkeit bedrohte Frauen und auf der Kinderbetreuung. Viele dieser Angebote wurden aufgrund fehlender Finanzierung nach und nach eingestellt.
„Paula Panke gehört zu einer der wenigen Organisationen in Berlin, die im Rahmen der Istanbul-Konvention speziell ausgestattete Schutzplätze bereithalten.“
Nadja Bungard
1994 wurde die erste Zufluchtswohnung eröffnet, es war auch das Gründungsjahr der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Hier wurden also erstmals Strukturen aufgebaut, um der zunehmenden Gewalt entgegenzutreten. 2008 eröffnete dann die zweite Schutzwohnung bei Paula Panke. Und vor kurzem erst, im Januar 2025, kam die dritte Zufluchtswohnung dazu – für Frauen/TIN* Personen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Hier wurde darauf geachtet, Barrieren so weit wie möglich zu reduzieren, damit gehört der Verein zu einer der wenigen Organisationen in Berlin, die im Rahmen der Istanbul-Konvention speziell ausgestattete Schutzplätze bereithalten.“
Hintergrund: Frauen in der Wendezeit
Bis 1989 trugen Frauen in der DDR mit rund 40 Prozent zum Familieneinkommen bei – zumeist durch Vollzeitstellen. Doch nach der Wiedervereinigung verschlechterte sich ihre berufliche Lage erheblich: Zwei Jahre später waren in Ostdeutschland 40 Prozent der neuen Stellen gezielt für Männer ausgeschrieben, nur elf Prozent für Frauen, und weniger als die Hälfte der Angebote war geschlechterneutral. Obwohl ostdeutsche Frauen zuvor häufiger in typischen Männerberufen tätig waren, schrumpfte ihr Anteil auch dort rasch auf das westdeutsche Niveau.
Quelle: Tagesspiegel | Myra Marx Ferree: Feminismen
Wie unterscheiden sich die Schutzwohnungen von Frauenhäusern?
Rahel: „Es handelt sich um anonyme Schutzunterkünfte. Die Personen wohnen dort in Wohngemeinschaften zusammen. Frauenhäuser können noch akuter aufnehmen und sind auch anders geschützt, sie treffen sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind als Sozialarbeiterinnen nicht vor Ort in den Schutzwohnungen, dafür können wir stärker auf intersektionale Bedürfnisse eingehen: Wir statten die Wohnungen technisch aus, um Taube Personen aufzunehmen oder eben rollstuhlgerechte Plätze anzubieten. Wir können auch ältere Kinder aufnehmen oder Mütter mit vielen Kindern, was in Frauenhäusern aus Kapazitätsgründen oft schwierig ist.“
Hintergrund: Taub | Taubheit
Taub/Taubheit ist eine positive Selbstbezeichnung nicht hörender Menschen. Es handelt sich hierbei um die Wiederaneignung eines Begriffes, der lange Zeit als abwertende Beschreibung verwendet wurde (reclaiming). Viele Mitglieder der Tauben Community verwenden inzwischen wieder das Wort „Taub“ für sich, weil es im Gegensatz zum Begriff „gehörlos“ nicht schon im Wort selbst einen Mangel („-los“) benennt.
Warum ist es so wichtig, dass die Zufluchtswohnungen im Besonderen für Menschen mit Behinderung ausgelegt sind?
Rahel: „Das Problem ist, dass Menschen mit Behinderung noch viel leichter Opfer werden von Gewalt. Bei Gewaltvorfällen geht es auch immer um Machtdemonstration. Es ist unglaublich wichtig, dass man spezialisierte Schutzräume anbietet, weil gerade Taube von Gewalt betroffene Frauen vulnerabler sind. Sie sind so viel schneller von Diskriminierung in Räumen, auch in Schutzräumen, betroffen.
„Man kann extrem gewaltvoll agieren, ohne es zu merken, wenn man die Regeln der Community nicht kennt.“
Rahel, Sozialarbeiterin
Meine Kolleg*innen und ich werden geschult, wir sind sensibilisiert im Umgang mit Betroffenen und versuchen, Barrieren abzubauen. Dabei geht es nicht nur um die Kenntnis der Gebärdensprache. Man kann (Re-)Traumatisierungen hervorrufen. Man kann extrem gewaltvoll agieren, ohne es zu merken, wenn man die Regeln der Community nicht kennt. Taube Personen werden sehr wenig in unserer Gesellschaft beachtet oder inklusiv mitgedacht. Das Technische ist das eine. Aber eben auch die Soft Skills im Umgang als hörende Person sind immens wichtig, was die Form der Kommunikation angeht.“
Hintergrund: Gewalt gegen Personen mit Behinderung
Frauen mit Behinderungen erleben zwei- bis dreimal so häufig sexualisierte Gewalt wie Frauen ohne Behinderungen.
Fast die Hälfte aller Frauen mit Behinderungen hat in ihrem Leben bereits sexualisierte Gewalt erlebt.
Drei von fünf Frauen mit Behinderungen haben körperliche Gewalt erfahren – also doppelt so häufig wie Frauen ohne Behinderungen.
Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Studie Juli 2024
Wie steht es um die Auslastung: Sind die Wohnungen immer belegt?
Rahel: „Ja. Wir sind fast das ganze Jahr über ausgelastet und müssen beinahe täglich Anfragen von gewaltbetroffenen Personen ablehnen.“
Was ist das für ein Gefühl, verzweifelten Personen, die sich über einen Platz informieren, absagen zu müssen?
Rahel: „Das ist ein schreckliches Gefühl, aber es ist Alltag für alle Sozialarbeiterinnen im Antigewaltbereich. Man hat immer die Hoffnung, dass ein anderes Projekt Platz hat. Aber ein Blick auf die Zahlen ist ernüchternd: Es fehlen fast 14.000 Frauenhausplätze in Deutschland.“
Wenn ich von Gewalt betroffen bin und in eine der Schutzwohnungen möchte: Welcher Weg ist zu empfehlen?
Rahel: „In Berlin ist das sehr gut über die BIG Hotline organisiert. Die ist rund um die Uhr erreichbar und hier werden auch Akutplätze vermittelt. Viele Personen werden über die BIG Hotline erst auf uns aufmerksam. Und wenn wir einen freien Platz haben, melden wir ihn natürlich auch.“
Hintergrund: Die BIG-Hotline
Die BIG Hotline bietet telefonische Beratung bei Häuslicher Gewalt in Berlin unter der Nummer 030 611 03 00. Die BIG Hotline ist rund um die Uhr erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Bei Bedarf kann in andere Sprachen vermittelt werden. Mehr Informationen
Oft hört man diesen Satz: „Warum geht die Frau nicht einfach?“ Dass das alles andere als einfach ist, gerade auch mit Kindern, zeigt ein Blick auf den Wohnungsmarkt. Dieses immense Problem kann Leben kosten. Was brauchen wir jetzt, damit Betroffene die Gewaltsituation verlassen können?
Rahel: „Die von Gewalt betroffenen Personen brauchen Schutz, niedrigschwellige Angebote, sie müssen Alternativen kennenlernen, die Scham aufbrechen, die Isolation aufbrechen – denn Gewalt in Partnerschaften gehen sehr häufig mit Isolation einher. Es handelt sich vor allem um ein strukturelles Problem. Und einem strukturellen Problem muss man auch strukturell begegnen. Stattdessen wird das Problem individualisiert mit solchen Aussagen: ,Ja, du kannst doch einfach gehen. Du hast doch die Wahl. Du kannst dir doch Hilfe holen.‘ Damit wird komplett heruntergeredet, welche Ausmaße Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt annehmen kann.“
Nadja Bungard: „Ich habe auch schon eine Frau sagen gehört: ,Nur wenn er einmal schlägt, ist er doch kein schlechter Mensch.’ In einem Schutzraum darf so ein Satz auf gar keinen Fall ausgesprochen werden, denn damit retraumatisiert man Personen, die davon betroffen sind. Das haben sehr viele Menschen nicht im Blick. Deshalb ist es so wichtig, darüber aufzuklären, wo Gewalt eigentlich anfängt: beim Kontrollieren, Einschränken, Isolieren, bis hin zu finanzieller Gewalt oder reproduktiver Gewalt, Stalking, etc.“
Rahel: „Ich denke, Profis, die solche Geschichten begleiten, benötigen einen langen Atem. Trennungsprozesse verlaufen in vielen Schritten. Da geht man mal ein paar Schritte zurück, dann wieder einen Schritt vor. Und da braucht man einfach sehr viele Ressourcen. Dafür müssen wir ausreichend bezahlt werden. Dafür müssen Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit wir unbürokratisch und schnell Beratungen anbieten können, damit Personen regelmäßig zu Beratungen gehen können, damit es keine oder kaum Wartezeiten gibt.“
„Da sind Richterinnen, die nicht geschult sind. Da ist die Polizei, die nicht sensibel genug ist, um zu verstehen, in welcher Situation sich die von Gewalt betroffene Frau befindet, bis hin zu der Gewaltambulanz, die von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet hat – in dieser Zeit findet Gewalt für gewöhnlich aber selten statt.“
Nadja Bungard
Nadja Bungard: „Und hier ist dieses Thema Fallkonferenzen auch so wichtig. Dass die verschiedenen Akteurinnen in diesem System auch voneinander wissen und sich gemeinsam zu diesem Fall beraten. Das hat auch Christina Clemm am Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November 2024 betont: Da sind Richterinnen, die nicht geschult sind. Da ist die Polizei, die nicht sensibel genug ist, um zu verstehen, in welcher Situation sich die von Gewalt betroffene Frau befindet, bis hin zu der Gewaltambulanz, die von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr geöffnet hat – in dieser Zeit findet Gewalt für gewöhnlich aber selten statt.
Wichtig ist, dass die Gewalt sofort dokumentiert wird, das heißt, wir brauchen eine Rund-um-die-Uhr-Ambulanz, wo verschiedene Akteur*innen vor Ort sind. Es gibt schon Entwicklungen in die richtige Richtung. Aber es muss substanzieller werden, wir brauchen eine echte Hilfe-Struktur, bis hin zu den Präventionsangeboten, die nicht gerne finanziert werden, weil man sich da als Politikerin innerhalb von vier Jahren noch keinen Lorbeerkranz umhängen und feiern lassen kann.“
Häusliche Gewalt verursacht jährlich erhebliche Kosten. Eine aktuelle Studie des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) beziffert die Kosten geschlechtsspezifischer Gewalt in der gesamten EU auf 366 Milliarden Euro, wovon etwa 68 Milliarden Euro auf Deutschland entfallen. Das ist viel mehr, als wir jetzt ausgeben müssen, um sowohl die Gewalt als auch die durch sie entstehenden Kosten zu senken.
Nadja Bungard: „Absolut. Aber so rechnet die Politik nicht. Das kann man in allen möglichen Bereichen sehen.“
Rahel: „Vor allem in den sozialen Bereichen rechnet die Politik nicht so.“
Nadja Bungard: „Und das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt: Frauen, die aus den Beziehungen rausgehen, die verlassen ihr soziales Umfeld, ebenso wie die Kinder. Die Frauen brauchen eine unglaubliche Kraft, um sich daraus zu befreien und sie haben ausschließlich Nachteile, auch finanzieller Art. Während die Täter meist in den Wohnungen bleiben, sie müssen keine Strafe befürchten. Von diesen vielen Fällen, die zur Anzeige gebracht werden, ist es nur ein sehr geringer Teil, der vor Gericht landet. Und allein 0,5 Prozent der Täter bekommt überhaupt eine Strafe, zumeist sind das Geldstrafen.
„Welche Haltung haben wir Frauen gegenüber? Es gibt eine konsequente Abwertung von allem, was weiblich ist.“
Nadja Bungard
Am Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 2024 berichtete eine Oberstaatsanwältin im Abgeordnetenhaus über einen Femizid, der sich im August in Zehlendorf ereignet hatte. Sie sagte, diese Frau habe alles richtig gemacht. Sie war mit ihm mehrfach vor Gericht, er hat immer Geldstrafen bekommen und es hat ihn einfach überhaupt nicht interessiert. Da bleibt die Frage: Welche Haltung haben wir Frauen gegenüber? Es gibt eine konsequente Abwertung von allem, was weiblich ist.“
Spende und Wähle!
Seit mehr als 30 Jahren ist das Frauenzentrum Paula Panke eine wichtige Anlaufstelle für Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Ob rechtliche Fragen, soziale Notlagen oder seelische Belastungen – hier finden Frauen Unterstützung und konkrete Hilfe. Besonders Alleinerziehende, Frauen in belastenden Beziehungen oder Geflüchtete profitieren von der kostenfreien Beratung durch erfahrene Anwältinnen und Sozialarbeiterinnen.
Damit diese wichtige Arbeit fortgesetzt werden kann, ist das Zentrum auf Spenden angewiesen. Jeder Beitrag hilft, Frauen in akuten Krisen eine Perspektive zu geben und ihnen den Zugang zu rechtlicher und sozialer Beratung zu ermöglichen.
Jetzt spenden und unterstützen!
Mehr zum Thema bei EDITION F
14. Februar: Bundesrat stimmt Gewalthilfegesetz zu: Artikel lesen
Christina Clemm: „Gewalt gegen Frauen wird schulterzuckend hingenommen“: Interview lesen
Stefanie Knaab: „Jede vierte Frau in Deutschland erfährt häusliche Gewalt: Wir alle kennen Betroffene, aber auch Täter!“: Interview lesen