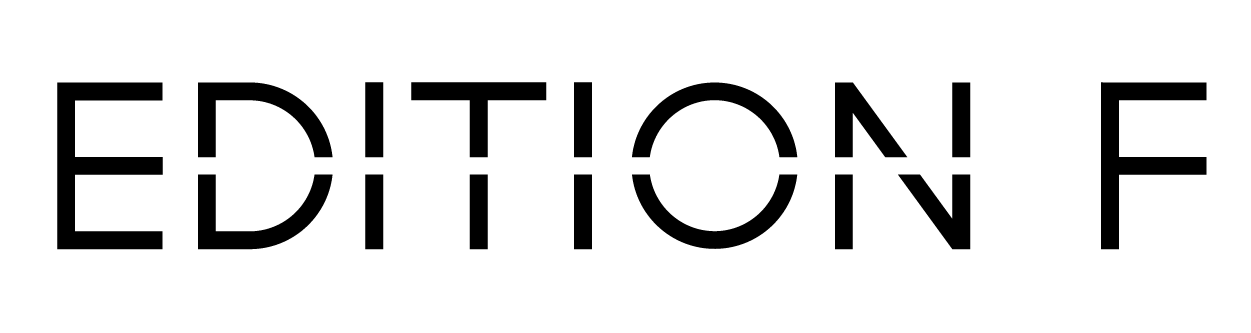Hyperemesis Gravidarum (HG) ist eine schwere, aber oft verharmloste Schwangerschaftskomplikation. Sie geht mit extremem Erbrechen, Dehydration und psychischer Belastung einher, bis hin zu Klinikaufenthalten, Isolation und Abbruchgedanken. Unsere Community-Autorin war selbst betroffen und beschreibt, was sich dringend ändern muss.
CN: In diesem Text geht es um Hyperemesis Gravidarum, eine schwerwiegende Schwangerschaftserkrankung. Der Beitrag beschreibt körperliche und psychische Belastungen während der Schwangerschaft. Wenn dich solche Inhalte belasten, überlege bitte, ob du den Text lesen möchtest – oder nimm dir bewusst Zeit und Raum dafür.
Ich hatte aufgehört zu zählen, wie oft ich mich an diesem Tag schon übergeben hatte – es kam ohnehin nur noch Galle und gelber Magensaft. Der widerliche Geschmack im Mund wurde zu einem ständigen Begleiter. Ebenso wie meine Verzweiflung und meine Einsamkeit. Ich war schwanger – und wollte es lieber nicht sein
In den dunkelsten Tagen meiner Hyperemesis konnte ich keinen Schluck Wasser bei mir behalten. Ich schleppte mich nur noch von Couch zu Bett zu Badezimmer. Alltag? Nicht vorhanden. Arbeiten? Undenkbar. Soziale Kontakte? Wie?
Ich saß mit Spucktüten in Straßenbahnen, erbrach mich in Kanaldeckeln und lag mehr als ein Mal auf dem Boden meines Büros, unfähig, nach Hause zu kommen. Es ging nicht mehr. Es ging nichts mehr.
„In den dunkelsten Tagen meiner Hyperemesis konnte ich keinen Schluck Wasser bei mir behalten.“
Dann kamen die Klinikaufenthalte. Ich bekam Infusionen, um meinen Kreislauf zu stabilisieren. Statt zuzunehmen, nahm ich täglich 500 Gramm ab. Ich litt unter dem Unverständnis, der Ablehnung, dem Unglauben und der Geringschätzung, die mir entgegengebracht wurden. „Da müssen Sie leider durch, Übelkeit ist in der Schwangerschaft ganz normal“, war einer der harmloseren Sätze, die ich zu hören bekam. Was dem Ganzen die Krone aufsetzte, waren ganz offen artikulierte Spekulationen des Klinikpersonals, die in die Richtung gingen „Wollen Sie dieses Kind überhaupt – oder rebelliert Ihr Körper deshalb so sehr?“
Ich möchte es hier in aller Deutlichkeit sagen: Mein damaliger Wunsch, die Schwangerschaft zu beenden, war nicht Ursache, sondern allenfalls die Konsequenz von Hyperemesis Gravidarum.
Was ist Hyperemesis Gravidarum?
• Die ICD-10-Klassifikation führt HG unter O21.1 – Übermäßiges Erbrechen in der Schwangerschaft mit Stoffwechselstörung.
• Laut dem MSD Manual: Ausgabe für medizinische Fachkreise ist Hyperemesis Gravidarum eine schwere Form der Schwangerschaftsübelkeit, die durch anhaltendes und exzessives Erbrechen gekennzeichnet ist. Sie führt zu erheblichem Flüssigkeits- und Elektrolytverlust, Gewichtsabnahme von mehr als 5 % des Körpergewichts, Dehydration und in schweren Fällen zu Hospitalisierung.
• Schätzungen zufolge sind etwa 0,3 bis 2% aller Schwangeren betroffen.
• Bei manchen Betroffenen nimmt die Übelkeit im Laufe der Schwangerschaft ab, bei manchen endet sie erst mit der Geburt.
Ich versuchte alles Mögliche: Hausmittel von Ingwer bis ätherische Öle, unzählige Tipps aus Foren, Gespräche mit Hebammen, Vomex (Mittel gegen Übelheit), Brechnuss (Heilpflanze), Globuli, Cariban (Medikament gegen Schwangerschaftsübelkeit). Ich wandte mich an eine Heilpraktikerin mit Fokus auf Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Ich aß gegen meine Übelkeit an. Es half: nichts!
„Nicht nur für mich, für meinen Körper und meine Schwangerschaft, sondern auch für meinen Partner und unsere Beziehung war meine Hyperemesis Gravidarum eine große Belastung.“
Nach zwei Klinikaufenthalten und vielen Telefonaten mit Embryotox (Anmerkung der Redaktion: Embryotox ist ein Beratungszentrum und Informationsportal, das Schwangeren und Stillenden Informationen zur Arzneimittelsicherheit bietet. Das Institut ist an der Charité-Universitätsmedizin Berlin angesiedelt.) – und einer Gynäkologin, die Verständnis, wenn auch kein Mitgefühl zeigte – bekam ich schließlich eine Medikation, die mich bis ins letzte Trimester stabilisierte. Ich musste kaum noch erbrechen, aber die Übelkeit verschwand erst mit der Geburt meines Kindes.
Nicht nur für mich, für meinen Körper und meine Schwangerschaft, sondern auch für meinen Partner und unsere Beziehung war meine HG eine große Belastung. Er fühlte sich teils ohnmächtig und hilflos, war teils mehrere Wochen krankgeschrieben – um mich zu unterstützen und unseren Alltag zu organisieren.
Und ich weiß: Das trifft bei Weitem nicht auf alle HG-Betroffenen zu. Viele sind in dieser Situation allein. Ohne Partner*in, ohne unterstützendes Umfeld. Und selbst wer nicht allein ist, erlebt oft, dass das soziale Umfeld verhalten, überfordert oder sogar ablehnend reagiert – nach dem Motto: „So schlimm kann das doch nicht sein.“ Diese Mischung aus Isolation, Unverständnis und subtiler Abwertung macht das Erleben von HG für viele noch belastender, als es ohnehin schon ist.
„Viele Betroffene fühlen sich unverstanden, allein gelassen – und nicht selten in ihrer Not ignoriert.“
Ich bin mit meiner Erfahrung nicht allein. Viele Betroffene berichten Ähnliches: Sie fühlen sich unverstanden, allein gelassen – und nicht selten in ihrer Not ignoriert. Viele erleben späte oder falsche Diagnosen. Das medizinische Personal ist häufig unzureichend über HG informiert. Die psychische Belastung ist enorm: Isolation, Angstzustände, Depressionen – und nicht selten Gedanken an einen Schwangerschaftsabbruch.
Hyperemesis Gravidarum zerreißt Leben. Die Erkrankung hinterlässt Verletzungen, die traumatisches Potenzial haben. Trotz dieser Schwere ist die Forschungslage zu HG insgesamt dürftig.
Mangel an Grundlagenforschung
Die Ursachen von Hyperemesis Gravidarum sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Vermutet werden hormonelle, genetische und neuroendokrine Einflüsse. Neue Studien weisen auf das Protein GDF15 als möglichen Mitverursacher hin. Dennoch fehlt es bislang an gezielter Diagnostik, wirksamer Therapie und einem verlässlichen Biomarker.
Forschungslücke & Gender Bias
Wie viele frauen*spezifische Erkrankungen wurde HG lange verharmlost oder als psychosomatisch abgetan. Studien bezogen Betroffene selten ein, blieben oft eindimensional und ignorierten intersektionale Perspektiven.
Aktuelle Studien & Entwicklungen
Forscher*innen wie Marlena Fejzo treiben die HG-Forschung voran, unterstützt u. a. von der HER Foundation. Studien zeigen psychische Langzeitfolgen wie PTBS oder Depressionen. Es existieren Behandlungsleitlinien, doch sie sind teils veraltet oder wenig verbreitet.
Fazit: Großer Bedarf an interdisziplinärer Forschung
Es mangelt an interdisziplinärer, inklusiver Forschung und fundierten Therapie-Evaluationen. Aus feministischer Sicht braucht es Studien, die Betroffene einbeziehen und Schwangerschaft als potenziell krisenhaften Ausnahmezustand anerkennen.
In unserer Gesellschaft hält sich hartnäckig die Vorstellung, Schwangerschaft sei vor allem eines: ein freudiger, natürlicher Zustand. Wer abweicht, wer Leid, Zweifel oder Überforderung äußert, stößt schnell auf Unverständnis. Ambivalente Gefühle werden nicht nur ignoriert, sondern aktiv tabuisiert. Wer nicht ins Idealbild der glücklichen, strahlenden Schwangeren passt, wird subtil zurück ins „Normale“ gedrängt – oder offen kritisiert. Wenn das nicht gelingt, droht soziale Ächtung. Gerade bei einer so extremen Erfahrung wie Hyperemesis Gravidarum entsteht ein Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Erwartung und persönlichem Leiden, das viele Betroffene zusätzlich belastet.
Doch es bleibt nicht bei fehlender gesellschaftlicher Anerkennung: Auch strukturell fehlt es an Unterstützung. Krankenkassen erkennen den Behandlungsbedarf oft nicht an. Das Arbeitsrecht bietet Schwangeren in solchen Extremsituationen kaum Schutz. Und soziale Sicherungssysteme greifen zu kurz, wenn die Betroffenen wochen- oder monatelang weder arbeiten noch für sich selbst sorgen können.
„Medizinisches Personal muss Hyperemesis Gravidarum als schwere, potenziell traumatisierende Erkrankung erkennen und entsprechend behandeln.“
Eine feministische Perspektive hilft zu verstehen, warum das Leiden schwangerer Personen so häufig übersehen wird. Schwangerschaft wird romantisiert – als etwas Schönes, Natürliches. Schmerz, Kontrollverlust und psychische Belastung passen nicht in dieses Bild. Wer leidet, wird nicht als ernst zu nehmend krank wahrgenommen, sondern als empfindlich, übertrieben oder gar unwillig. Hyperemesis Gravidarum bricht mit diesem gesellschaftlichen Ideal – und wird deshalb oft bagatellisiert oder ignoriert.
Was es braucht, sind strukturelle und politische Veränderungen. Medizinisches Personal muss HG als schwere, potenziell traumatisierende Erkrankung erkennen und entsprechend behandeln. Es braucht mehr Forschung im Bereich frauen*spezifischer Gesundheit – zu Ursachen, Verläufen und wirksamen Therapien. Gesetzliche Regelungen müssen Betroffene besser schützen: durch Lohnfortzahlung, flexible Arbeitsmodelle und unkomplizierte Zugänge zu Haushaltshilfe und stationärer Versorgung. Gleichzeitig braucht es Aufklärung und Sichtbarkeit – in medizinischen Ausbildungen, Medien, Politik und Öffentlichkeit. Und vor allem: Räume für Vernetzung und Austausch, in denen Betroffene gehört werden.
Hyperemesis Gravidarum ist kein Einzelfall – und ganz sicher keine Bagatelle. Was Betroffene brauchen, ist Anerkennung, Sichtbarkeit – und wirksame Unterstützung. Was wir als Gesellschaft brauchen, ist die Bereitschaft hinzusehen und zuzuhören, ein Gesundheitssystem, das Schwangere nicht im Stich lässt, eine Politik, die reproduktive Realität ernst nimmt, ein Ende der Romantisierung von Schwangerschaft – und mehr Solidarität statt Schweigen.
Unterstützung bei Hyperemesis Gravidarum – Was kann das soziale Umfeld tun?
Verständnis zeigen
- Gefühle Betroffener ernst nehmen.
- Möglichst differenzierter Blick auf die Situation und sich selbst zurücknehmen ohne die betroffene Person alleine zu lassen.
- Keine „guten Ratschläge“ wie Ingwer, frische Luft oder „zusammenreißen“ – HG ist keine Schwangerschaftsübelkeit.
- Keine Anekdoten: “Bei meiner Schwangerschaft war es ja auch so schlimm mit der Übelkeit…”
Ruhe ermöglichen & Alltag entlasten
- Hilfe im Alltag anbieten: Haushalt, einkaufen, kochen, ggf. Kinder versorgen, etc.
- Unterstützung bei Behördengängen, z. B. Beantragung einer Haushaltshilfe über die Krankenkasse.
- Gespräche mit Arbeitgeber:innen begleiten (z. B. Beschäftigungsverbot statt Krankschreibung).
Hilfe bei Organisation & Recherche
- Bei drohender Dehydrierung: ins Krankenhaus – möglichst mit HG-Erfahrung.
- Ärzt:innentermine gemeinsam wahrnehmen und Infos bereitstellen (z. B. über hyperemesis.de).
- Auf Infoplattformen wie z. B. Embryotox hinweisen.
- Infos zu Austauschmöglichkeiten sammeln: Foren, Blogs, Selbsthilfegruppen, etc.
Auf den Punkt:
Hyperemesis Gravidarum ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Unterstützung beginnt mit Zuhören, Glauben und Entlasten.