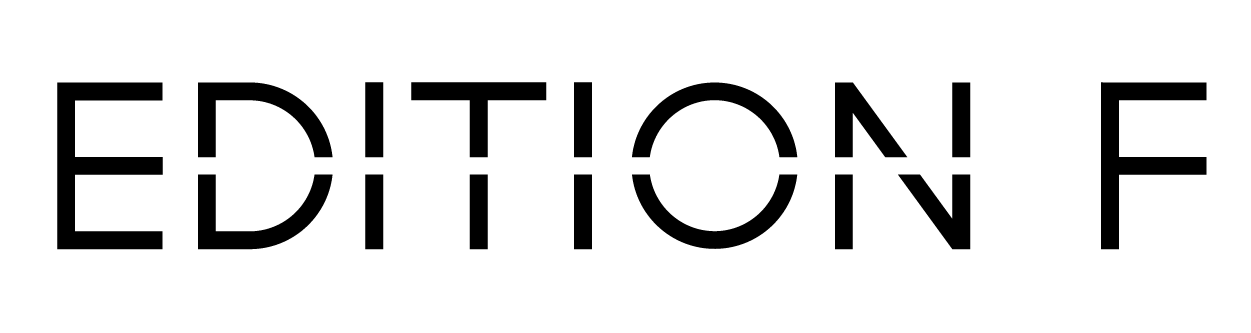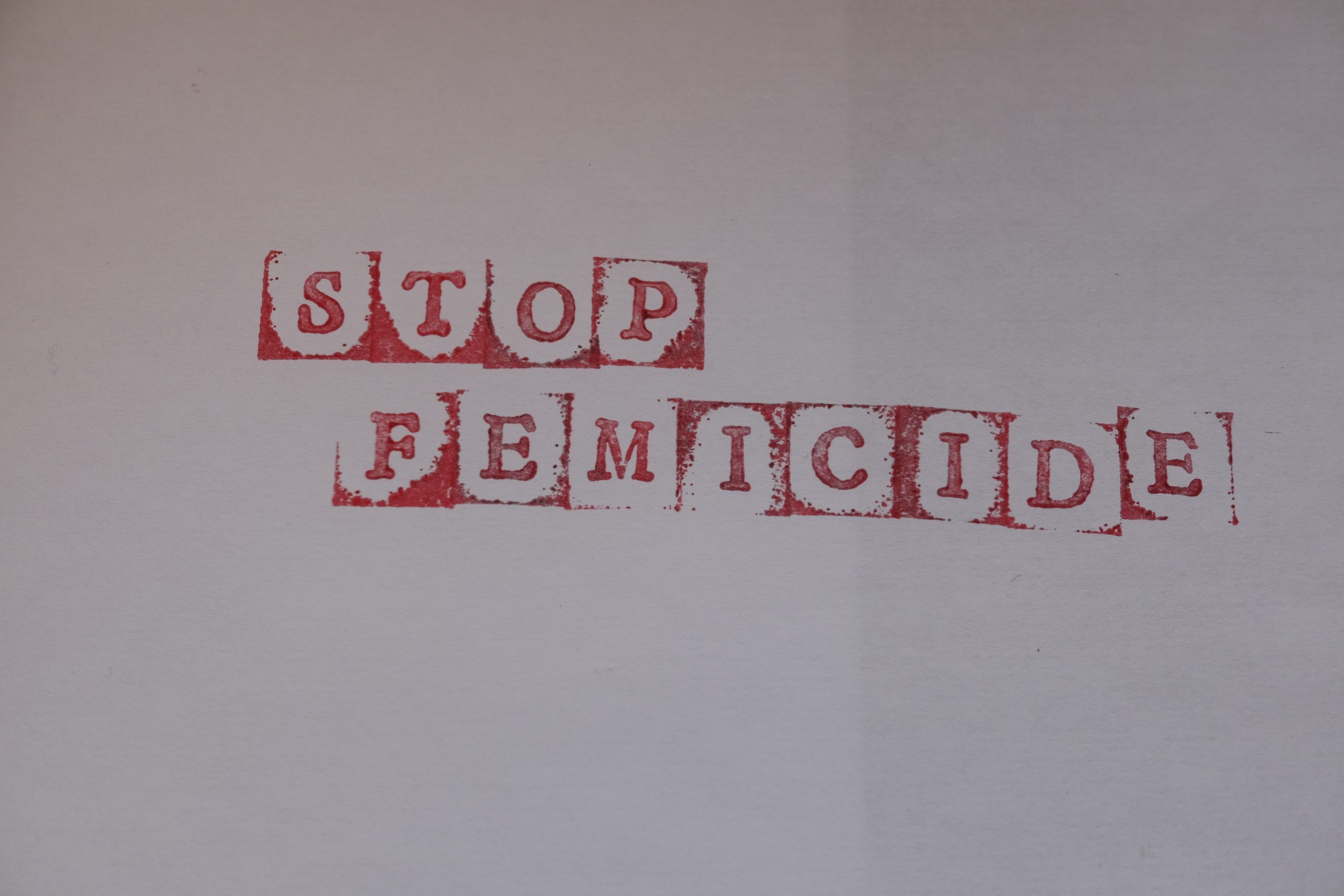Laut einem Lagebild des Bundeskriminalamts gab es 2023 beinahe jeden Tag einen Femizid. Warum Lilly vom Instagram-Account @femizide_stoppen die Zahlen kritisiert und wie sie auf Instagram selbst mitzählt, erzählt sie im Interview.
Ende Juni 2025 zählt @femizide_stoppen den 44. Femizid in Deutschland im Jahr 2025. Mit schwarzer Schrift auf rotem Grund halten die Betreiberinnen des Accounts, Saskia und Lilly, den Todestag, manchmal den Namen und häufig die Geschichte des Opfers fest. 2022 haben sie damit angefangen, die Femizide in Deutschland zu zählen – aus persönlicher Betroffenheit. Inzwischen verfolgen über 120.000 Menschen die Beiträge, mit denen die beiden laut Lillys Aussage politisieren wollen. Wir haben mit der 27-Jährigen darüber gesprochen, was den Mord oder Totschlag einer Frau von einem Femizid unterscheidet, warum diese Unterscheidung wichtig ist und wie sie auf die mediale Berichterstattung über Femizide blickt.
Lilly, ihr bekommt über Instagram Nachrichten zu potenziellen Femiziden in Deutschland. Wie viele Hinweise kommen bei euch an?
„Wir kriegen eigentlich täglich Nachrichten auf Instagram mit Hinweisen zu Femiziden. Wie viele, variiert von Tag zu Tag und hängt auch davon ab, wie ausführlich die Medien gerade berichten. Wir posten das dann aber nicht direkt. Bis wir einen Fall auf Instagram teilen, vergehen bis zu zwei Wochen.”
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass nicht jeder Mord oder Totschlag einer Frau ein Femizid ist. Wie unterscheidet ihr für den Kanal?
„Das ist von uns am Ende auch eine Mutmaßung, die wir damit rechtfertigen, dass wir Aktivismus betreiben. Die Datenlage in Deutschland zu Femiziden ist nicht gut. Wir recherchieren jeden Fall, so gut es geht. Bis zu zwei Wochen nach der ersten Meldung kommen häufig noch neue Informationen zum Täter und zum Tatmotiv. Daher warten wir. Es gibt meist wenig Berichterstattung, das heißt, es ist nicht immer leicht für uns nachzuvollziehen, was das Motiv ist. Damit wir einen Fall als Femizid einordnen, muss es aber einen geschlechtsspezifischen Aspekt geben. Bei einem Raubmord ist das Motiv eben dieser Raub und da spielt das Geschlecht nicht wirklich eine Rolle. Aber bei Trennungstötungen zum Beispiel wegen patriarchalem Besitzdenken spielt das Geschlecht eine Rolle. Grundsätzlich muss man sagen: Die meisten Opfer von Tötungen in Deutschland sind Männer und die meisten Täter auch. Wenn man sich aber Partnerschaftstötungen anschaut, dreht sich dieses Verhältnis um. Denn dann sind die Opfer plötzlich zu 80 Prozent Frauen, es wird also geschlechtsspezifisch. Hier liegt das Problem.“
Du sagtest gerade, dass die Datenlage zu Femiziden in Deutschland nicht gut sei. Warum?
„Unserer Meinung nach ist es wichtig, Femizide so zu benennen, um das Muster zu erkennen und zu bekämpfen. Deutschland hat sich mit der Istanbul-Konvention verpflichtet, eine Datenanalyse zu Femiziden zu machen. Diese findet aber nicht statt.“
Ende 2024 kamen die Ergebnisse im Lagebild „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“.
„Genau. Was das BKA aber gemacht hat, ist, jede Tötung einer Frau und eines Mädchens als Femizid zu betiteln. 2023 waren das 360. Dadurch verpasst das BKA die Chance, dieses Muster zu benennen und dagegen vorzugehen. Weil es keine Bennenung eines Musters mehr gibt, wenn man einfach jede Tötung an Frauen und Mädchen als Femizid bezeichnet.

Auch Femizide kann man nochmal kategorisieren. Es gibt beispielsweise Matrizide, da töten Männer ihre Mütter oder Großmütter. Das ist auch ein Muster. Außerdem lassen sich Femizide auch weiter differenzieren: Es gibt Trennungstötungen mit anschließendem Suizid oder erweiterte Femizide, das heißt, der Mann tötet nicht nur die Frau, sondern zum Beispiel auch die gemeinsamen Kinder. Bei Stellvertreter-Femiziden möchte der Mann seiner Partnerin oder Ex-Partnerin möglichst viel Schaden zufügen und tötet deswegen ihr nahestehende geliebte Personen, wie beispielsweise ihr Kind oder eine Freundin, damit die Frau möglichst doll leidet.
Das sind alles Kategorien, bei denen es sich lohnen würde, diese aufzubereiten und darzustellen. Das versäumt das BKA. Scheinbar wird das Problem immer noch nicht ernst genommen. Die Dringlichkeit, Femizide ausreichend zu analysieren und darzustellen, hat man noch nicht erkannt.“
Ihr wünscht euch eine detailliertere Analyse. Was bringt das?
„Wenn man die Tatumstände besser kennt, kann man die typischen Abläufe eines Femizids besser erkennen. Dann wissen wir, wie häufig Täter schon vorher gewalttätig oder polizeibekannt sind, dass womöglich häufig schon ein Annäherungsverbot vorlag. In Spanien stufen sie Gefährder anhand solcher Daten ein und arbeiten mithilfe von elektronischen Fußfesseln präventiv.“
Euer Account ist ein Versuch, diese unzureichende Datenlage zu füllen?
„Als wir 2022 gestartet haben, gab es den Begriff Femizid noch nicht in Statistiken. Uns war wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Dass alle zwei Tage ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin tötet, wird gar nicht wirklich deutlich, wenn immer nur regional berichtet wird. Wir wollten eine überregionale Berichterstattung und ein Bewusstsein schaffen. Zusätzlich wollten wir das Thema politisieren und Druck machen.“
Häufig erzählt ihr auch die persönlichen Geschichten der Opfer.
„Ja, wir versuchen so einen solidarischen Raum für Hinterbliebene zu schaffen. Die mediale Berichterstattung über solche Fälle ist manchmal verletzend und romantisiert Femizide. Da war uns wichtig, einen Raum zu schaffen, wo Hinterbliebene sich ausdrücken können und einen Raum, in dem wir der Frauen gedenken.“
Wie seid ihr zum Thema Femizide gekommen?
„Wir haben im November 2021 selbst eine Freundin durch einen Femizid verloren. Der Täter hat auch den gemeinsamen Sohn getötet. Das war alles sehr schlimm. Die gesellschaftliche Empörung ist irgendwie einfach ausgeblieben. Es gab keine Lokalpolitiker*innen, die sich geäußert haben, die Berichterstattung war schlecht. Der Fall wurde nicht öffentlich als Femizid eingeordnet. Wir konnten das nicht einfach so hinnehmen. Der Tod ist absolut, da kann man nichts mehr tun. Aber wir hatten trotzdem das Gefühl, dass wir nicht ohnmächtig bleiben wollen.“
Woher kam die Idee, Femizide zu zählen?
„Ich kannte von feministischen Seiten aus anderen Ländern, beispielsweise aus Chile, das Konzept des Femizid-Counters. Das ist die politische Einordnung, die ich mir auch hier gewünscht hätte. Aber als ich nach einem Counter für Deutschland gesucht habe, in dem Derya auftaucht, habe ich keinen gefunden. Also haben wir ihn gestartet, anderthalb Monate nach dem Mord an Derya und Kian.“

Eure aktivistische Arbeit zum Thema Femizide ist eng verknüpft mit dem Mord an eurer Freundin. Was macht die Arbeit mit deiner Trauer um Derya?
„Anfangs war es voll wichtig für die Trauerbewältigung, dass man nicht das Gefühl hat, dass man es einfach so hinnehmen muss. Mittlerweile ist es gut zu sehen, dass es so viele Leute erreicht und wir eine Plattform bieten können, um Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen und an die getöteten Frauen zu erinnern.“
Du hast schon ein paar Mal auf den medialen Umgang mit Femiziden angespielt. Wie empfindest du den Umgang, auch mit Blick auf den Mord an Derya?
„Häufig werden Femizide als Beziehungsdramen oder Familientragödien betitelt. Damit romantisiert man den Femizid und benennt nicht konkret, wer Täter und wer Opfer war. Auch hier verpasst man die Chance, das strukturelle Problem aufzuzeigen. Generell wird zu wenig berichtet. Häufig nur zu Anfang eines Prozesses oder beim Urteilsspruch. Ich glaube, dass eine ausführlichere Berichterstattung dazu beitragen würde, dass Menschen ein größeres Bewusstsein für diese geschlechtsspezifische Gewalt kriegen. Femizide nehmen überregional gar keinen großen Raum ein, sie bleiben häufig im Lokalen und Regionalen. Wenn überregional berichtet wird, dann meist nur zum 8. März (Anm. d. Red.: Internationaler Frauentag) oder zum 25. November (Anm. d. Red.: Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen). Das finde ich nicht verhältnismäßig zum Ausmaß dieser geschlechtsspezifischen Gewalt in Deutschland.“
Tut sich denn etwas in der Berichterstattung?
„Ich sehe die Entwicklung, dass immer mehr Medien mittlerweile den Begriff Femizid nutzen. Bei öffentlich-rechtlichen Seiten online ist auch häufig unten eine Begriffserklärung und ein Hinweis, wie gewaltbetroffene Frauen sich Hilfe suchen können.“
Was muss sich strukturell ändern, damit Gewalt gegen Frauen sinkt?
„Ich glaube, es ist sehr hilfreich, dass wir einen europäischen Nachbarn haben, der gesellschaftlich ähnlich aufgebaut ist und das gleiche Problem mit geschlechtsspezifischer Gewalt hat wie wir: Spanien. Spanien ist tatsächlich sehr fortschrittlich im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Dort sinken die Zahlen. Ich glaube, dass wir uns da viel abgucken können. Neben einer besseren Datenlage zu Femiziden gibt es dort auch eine elektronische Fußfessel, die – kombiniert mit einem Peilsender beim Opfer – anspringt, wenn der Täter sich dem Opfer nähert.“
Du denkst, eine solche Fußfessel nach spanischem Modell könnte auch in Deutschland hilfreich sein?
„Wenn wir die Fälle für ,Femizide stoppen‘ recherchieren, setzen wir uns ja auch immer mit dem Tathergang auseinander. Wir sehen, dass diesen Femiziden oft schon andere Gewalt vorhergegangen ist. Frauen haben teilweise schon Anzeigen wegen dieser Gewalt erstattet, es gab Annäherungsverbote und Gefährderansprachen. Diese Gewalt findet also bereits statt. Ich glaube, dass es in solchen Fällen sehr hilfreich ist, den Gewalttätern eine elektronische Fußfessel anzuordnen. Ich glaube, so können Leben gerettet werden.“
Was braucht es noch?
„Ich glaube nicht, dass höhere Strafen die Täter abhalten. Stattdessen müssen wir anfangen, präventiv zu arbeiten. Es braucht ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, dass Frauen und alle Geschlechter gleichberechtigt sind. Das schaffen wir nur mit präventiven Maßnahmen. Wir müssen ganz früh mit gleichgeschlechtlicher Erziehung, Aufklärung und Sensibilisierung anfangen, damit Männer nicht mehr zu Tätern werden.“
Du bist täglich mit dem Thema patriarchaler Gewalt konfrontiert. Was macht das mit deinem Sicherheitsgefühl?
„Ich fühle mich nicht unsicher dadurch. Aber ich merke, dass ich sehr intolerant werde, was Alltagssexismus angeht. Ich habe einfach keine Toleranz mehr für jegliches sexistisches Verhalten von Leuten in dieser Gesellschaft. Das bin ich leid.“
Macht es dich wütend?
„Ja, definitiv. Ich bin sensibilisierter für geschlechtsdiskriminierende Äußerungen oder Strukturen und fange eher an, mit anderen Leuten zu streiten.“
Wann pausierst du vom Thema patriarchaler Gewalt?
„Eigentlich nie. Patriarchale Gewalt findet überall allgegenwärtig auf verschiedensten Ebenen statt und wird von allen möglichen Leuten reproduziert. Ich muss keinen Account zum Thema Femizide betreiben, um damit konfrontiert zu sein.“
Gibt dir etwas Grund zur Hoffnung?
„Ich glaube, es tut sich was in Deutschland. Das Thema wird präsenter, das tut gut zu sehen. Zusätzlich tut es gut, sich zu vernetzen und zu sehen, dass andere Leute aktiv werden. In Würzburg haben wir jetzt eine neue Ortsgruppe gegründet.“
Was macht eine solche Ortsgruppe?
„Wenn Femizide begangen werden, organisieren die Ortsgruppen häufig Mahnwachen. In Hamburg hat eine Ortsgruppe einen Platz inoffiziell zu einem Widerstandsplatz umbenannt, wo sie sich immer wieder trifft, um den Opfern von Femiziden zu Gedenken, Demos mit Forderungen abzuhalten und Sichtbarkeit zu schaffen. Mitglieder begleiten auch die Gerichtsprozesse. Sie setzen sich dann in den Saal mit rein und dokumentieren. Denn vor Gericht wird die Frau häufig nochmal mitschuldig gemacht für die Tat, die der Mann begangen hat. Sowas gehört dokumentiert.“
Hast du einen Appell an Politik, Gesellschaft und Rechtsprechung?
„Es muss noch viel mehr Sensibilisierung stattfinden. Verschiedene Institutionen und die Leute, die dort arbeiten, müssen geschult werden zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Und es muss viel mehr in Prävention gesteckt werden.“