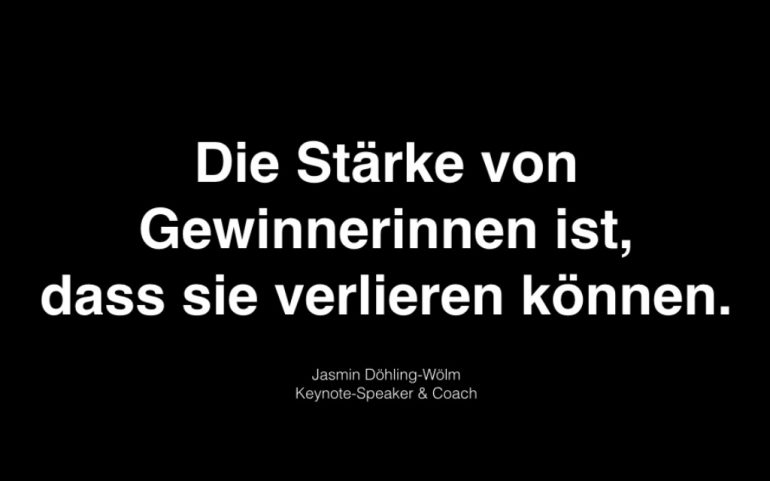Gewalt am Arbeitsplatz trifft nur die Schwachen! Nur jene, die es irgendwie auch verdienen. Falsch! Gewalt am Arbeitsplatz kann alle treffen. Aber vor allem jene, die irgendwie anders sind.
Gewalt am Arbeitsplatz ist zu gewissen Teilen ein Phänomen von sozialer Diversität und steigendem Konkurrenzgefühl. Bewusst beschreibe ich hier Konkurrenz-Gefühl und nicht knapper werdende Ressourcen. Denn selbst bei steigenden Ressourcen in konkreten Karrierefeldern beobachte ich, dass zunehmend mehr Coachees psychische, ökonomische und sogar physische Gewalterfahrungen in Arbeitssituationen erleben. Dies ist zum Beispiel der Fall bei Frauenquoten, wo die Quote ja für die weiblichen Fachkräfte rechnerisch eine Steigerung der Chancen bedeutet. Da erfahren Frauen als ‚Quotenfrauen’ in der Tat nicht nur von einigen Männern unter anderem verbale Angriffe sondern auch von Frauen. Auch sind zum Beispiel Drittmitteleinwerbungen und Fundings einerseits ja eher ein Zeichen von Ressourcensteigerung, wenn man sie denn individuell zu nutzen weiß. Und sie bieten in vielen Karriereverläufen gerade Wissenschaftlerinnen mehr Karriereoptionen, die eigene Forschung und Lehre zu finanzieren, als bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und dem Ende der erlaubten Verweildauer mit befristetem Arbeitsvertrag gemäß Wissenschaftszeitvertrags auf eine Haushaltsstelle zu warten.
Wer die Leidensgemeinschaft stört und sich zum Beispiel leistungsorientiert aus dem Schutz der Solidargruppe löst, ist dann natürlich störend. Sie bzw. er stört die traute Gemütlichkeit des Mittelmaßes und der nicht ausgesprochenen Nicht-Angriffs-Pakte. Auch jene, die sich nicht als Manövriermasse für jede Aufgabe jenseits von Arbeitsvereinbarungen und realistischer Einschätzung der
Belastungsgrenzen anbieten, geraten ins Fadenkreuz. Diversität fordert
weniger Toleranz, also Ertragen und Erleiden, als eher Ambiguitätstoleranz und geistige Flexibilität, mehrere mentale Modelle und Wertesysteme zu jonglieren.
Leistungsorientierung innerhalb von Systemen der sozialen Gleichheit sind da ebenso irritierend wie Qualitätsorientierung. Denn Qualitätsorientierung als ein Unteraspekt von Leistungsorientierung bietet genauso Angriffsfläche für verschiedene Formen der sprachlichen Platzanweiser, bitte zu bleiben, wo man gerade ist, und den sozialen Frieden nicht zu stören.
KLEINE UMFRAGE MIT GROSSER WIRKUNG
Meine kleine und natürlich nicht repräsentative Umfrage auf Facebook im Mai
hatte interessante Nebeneffekte. Zwar nahmen nur 15 Personen innerhalb der einen Woche Laufzeit teil. Von 15 Stimmen, die teilnahmen, bejahten 80% allerdings, dass sie bereits Gewalt am Arbeitsplatz erlebt hatten. Klar: 12 Ja-Stimmen sind nicht viel. Aber viel interessanter waren die Dialoge, die per Messenger und Mail abliefen, auch mit jenen, die lieber nicht wollten, dass man ihre Namen in der Umfrage las. Was denn überhaupt Gewalt genau sei, ob das nicht ein viel zu großes Wort wäre, weil dann ja beinahe alles Gewalt wäre, dass man dieses erst einmal gründlich überlegen müsste und vieles mehr.
In den Diskussionen – auch mit Coachees in den letzten Jahren – wurden hinter vorgehaltener Hand jedoch stets schnell Beispiele beschrieben, wie Rituale der Erniedrigung, Bloßstellung oder zum Beispiel nachhaltiges Verweigern des Blickkontaktes, Schweigen oder konsequentes Späterkommen. Diese konnten als Manipulationstechniken zur drohenden Ausgrenzung bei Nichtanpassung als Platzanweiser und Dominanzgesten entlarvt werden.
GROSSE WORTE KLEINER GEMACHT
Der Duden bietet als Synonym für Gewalt neben der Herrschaft und Macht ebenso Druck und Zwang sowie Heftigkeit, Kraft, Stärke, Wucht und Vehemenz an. In einem Standardwerk der Psychologie von Philip Zimbardo wird Gewalt als Aggression in ihrer extremen und sozial nicht akzeptablen Form definiert. Der Soziologe Max Weber definiert Macht zum Beispiel, als jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichgültig auf welcher Basis diese Chance besteht, wie zum Beispiel aus Status, Prestige, körperlicher oder finanzieller Überlegenheit etc..
Da linguistisch, psychologisch und soziologisch sehr klar zu sein scheint,
wie Gewalt definiert ist, stellt sich die Frage, warum so viel Ungewissheit darüber herrscht, ob man Gewalt individuell erlebt hat oder nicht. Das ist der viel größere Gewinn dieser Diskussion im Zuge der Umfrage. Dass diskutiert wird! Dass hinterfragt wird! Dass Bewusstwerdung stattfinden kann über Tabus. Zum Beispiel auch über das Tabu, dass es in einer kompetitiven Struktur ohne Gewalt nicht zu gehen scheint. Und auch das Tabu, dass wir selber viel öfter Gewalt anwenden, als wir uns eingestehen wollen. Ja, Gewalt ist ein großes Wort für viele kleine Alltagserlebnisse. Gewalt ist ein machtvolles Wort für ebenso viele Erfahrungen von täglichen Ohnmachten. Tägliche Ohnmachten, die wir im gesellschaftlichen Korsett der Wohlerzogenheit und Benimmregeln so lange hinnehmen, bis uns nicht mehr nur die Luft sondern auch noch die Worte wegbleiben, obwohl der Duden sie hat. So weiten viele auch die Grenzen der sozial akzeptablen Form immer weiter aus, teils aus ökonomischen, teils aus emotionalen Motiven, um die Definitionen von Zimbardo und Weber gegebenenfalls nicht zum Zuge kommen zu lassen. Wenn die Ausnutzung dieser Grenzerweiterung dann nicht an sich schon Gewalt ist, was bitte dann?
MUT, ZUR EIGENEN AGGRESSION
Gewalt und Macht gehören zusammen wie Immunstärke und Genesung. Wer sich nicht wehren kann, entweder weil er oder sie es nie gelernt oder verlernt
hat, ist antisozialen wie auch prosozialen (im Sinne der Gruppe regelhütend) Aggressionen Dritter schutzlos ausgesetzt. Das fühlt sich weder gut an, noch kann etwas nachhaltig Gutes daraus werden. Das Buch ‚Wut ist ein Geschenk’ von Arun Ghandi ist da ein heilsamer Ansatz, um Aggressionen richtig einzuordnen. In diesem Zusammenhang bewerte ich zum Beispiel auch Angebote wie Coachings und Trainings zu ‚Lateraler Führung’ oder ‚Führung von Unten’ als äußerst irritierend und auch kontraproduktiv in Sachen Aufbau von Führungskultur. Denn wer wollte selbst lateral oder von unten führende Mitarbeitende? Das Ziel sollte doch eher sein, den eigenen Macht- und Gestaltungswillen zu akzeptieren, die Liebkindfalle endlich zu verlassen, mit dem Neid der andern zu leben und eine Verantwortungsposition anzustreben, um unter anderem angemessen anzuleiten und selbst Agent oder Agentin des Wandels zu werden.
Die ersten Schritte sollten also sein, sich den eigenen Durchsetzungswillen einzugestehen, mit der eigenen gesunden Aggression ins Reine zu kommen und dann die Strukturen und das soziale Umfeld zu erschaffen, welche dies mittragen. Im Zweifelsfall heißt das auch, ein Feld bzw. den Job zu verlassen. Aber aus Selbstachtung zu gehen, ist immer ein Erfolg.
Nur die Verlierer und Verliererinnen bleiben und liefern sich weiterhin offene und verdeckte Machtkämpfe. Gewinnertypen können verlieren, weil sie keine Gewalteskalation zulassen. Das ist ihre wahre Stärke.
Dieser Beitrag erschien bereits am 30. Mai 2018 im BLOG zur Karrierekolumne | karrierekunst on the road.