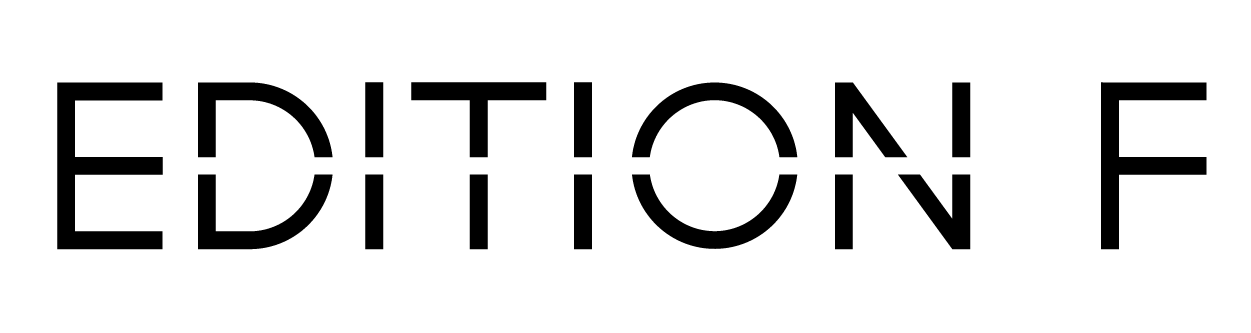Erstmals in der Geschichte des Eurovision Song Contest hat eine nicht-binäre Person gewonnen. Die gesellschaftspolitische Bedeutung von Nemos Sieg geht jedoch weit über den Musikwettbewerb hinaus.
Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) war nicht nur für Fans des Musikwettbewerbs spannend, sondern für alle Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie unsere Welt inklusiver und gerechter gestaltet werden kann. Gewonnen hat Künstler*in Nemo mit „The Code“ und brachte die gläserne Trophäe damit erstmals seit Céline Dions Sieg 1988 wieder in die Schweiz.
Treffendere Worte, um den Song zu beschreiben, als die von ZEIT-Journalist Timo Posselt gibt es wohl kaum: „Der Song klingt, als wäre Freddie Mercury von Queen Pate gestanden, als schaute ein Wiedergänger von Eminem vorbei, als hätte Mozarts Zauberflöte das Team inspiriert, aber auch der Komponist Hans Zimmer und alle James-Bond-Titelsongs der letzten Jahre.“ Und mit der beeindruckenden Performance beim ESC-Finale in Malmö hat Nemo dann auch Menschen von sich überzeugt, die mit dem Song selbst nicht viel anfangen können.
Ich würde mich eigentlich nicht als riesigen Fan des Musikwettbewerbs bezeichnen. In diesem Jahr aber habe ich mitgefiebert. Und das lag nicht daran, dass Nemo mein Herkunftsland vertrat – so weit geht die Heimatliebe nicht mal annähernd. Grund für mein Interesse am diesjährigen ESC war die politische Dimension des Songs.
Nemo besingt in dem Stück die Suche nach sich selbst: „This story is my truth/ I went to hell and back/ To find myself on track/ I broke the code/ Somewhere between the 0’s and 1s.” Durch die Hölle gehen, den Binärcode brechen und dann zwischen den Nullen und Einsen fündig werden, bedeutet in Nemos Fall zu erkennen, dass es mehr gibt als nur zwei Kategorien von Geschlecht: Nemo ist weder männlich noch weiblich, Nemo ist nicht-binär.
Als nicht-binär bezeichnen sich Menschen, die sich außerhalb der binären Geschlechterordnung von „männlich“ und „weiblich“ verorten, möglicherweise irgendwo zwischen männlich und weiblich oder weder als männlich noch weiblich.
Solltest du dir weitere Definitionen für Begriffe rund um Geschlechtsidentität wünschen, findest du hier ein Glossar feministischer Wörter.
Die Augen vor der Realität verschließen
Das Ausnahmetalent liefert mit „The Code“ nicht nur einen identitätsstiftenden Song für die eigene Community, sondern schafft als erste*r nicht-binäre*r ESC-Sieger*in dringend benötigte Sichtbarkeit für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft kaum stattfinden. Abgesehen von der so wichtigen Repräsentation freue ich mich darüber, was das für jene Personen bedeutet, die so tun, als gäbe es geschlechtliche Vielfalt nicht und als sei die sprachliche Inklusion aller Geschlechtsidentitäten ein Ding der Unmöglichkeit.
Denn: Nach Nemos Sieg finden die Menschen plötzlich Wege, sprachlich abzubilden, was längst gelebte Realität ist. In der konservativen „NZZ“, wo sonst Vorträge über die Unmöglichkeit geschlechtergerechter Sprache und den Einsatz entsprechender Sonderzeichen publiziert werden, mussten die Journalist*innen jetzt kreativ werden, um Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche zu vermeiden und dennoch korrekt über Nemo zu schreiben. Geht also doch.
Die Schweiz, wo die Politik sich 2022 dagegenstemmte, einen dritten Geschlechtseintrag einzuführen und damit nicht-binären sowie intergeschlechtlichen Menschen Sichtbarkeit verwehrte, hat nun ein prominentes Aushängeschild, das genau dieser unsichtbar gemachten Gruppe angehört.
Für mich ein wunderschönes Signal dafür, dass Wandel trotz all dem konservativen Widerstand nicht verhindert werden kann. Und genauso wie sich unsere Gesellschaft wandelt, verändert sich auch unsere Sprache. Die Vergangenheit zeigt: Änderten sich gesellschaftliche Verhältnisse, veränderte sich oft auch der Sprachgebrauch.
Während unverheiratete Frauen früher noch als „Fräulein“ bezeichnet wurden, ist es heute gesellschaftlicher Konsens, dass man als Frau keine Auskunft über den Ehestand geben muss. Und das hat wiederum dazu geführt, dass das Wort „Fräulein“ quasi abgeschafft wurde.
Sichtbarkeit von Vielfalt
Warum mich das Sichtbarmachen von Geschlechtervielfalt so umtreibt? Weil auch wir Frauen in der Sprache über Jahrhunderte – und vielerorts bis heute – nicht stattfinden. Und welche Auswirkungen das in so ziemlich allen Lebensbereichen, von Medizin über Politik bis hin zu KI oder Stadtplanung hat, haben Bücher wie „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez oder „Das Patriarchat der Dinge“ von Rebekka Endler eindrücklich aufgezeigt.
Sprache – insbesondere jene öffentlichkeitsrelevanter Institutionen – sollte die Realität abbilden. Doch das tut sie nicht, solange wir das generische Maskulinum verwenden. Damit wird nämlich nicht nur der sprachlichen Sichtbarkeit aller anderen Geschlechter entgegengewirkt, es wird zugleich auch vertuscht, wie es teilweise um die nicht-diverse Besetzung an vielen Orten steht. Woher wissen wir beispielsweise, wie viele Angestellte eines Unternehmens männlich sind, wenn pauschal von Mitarbeitern gesprochen wird?
Insbesondere dem Journalismus obliegt in meinen Augen eine besondere Verantwortung, die Realität korrekt abzubilden und dabei nicht zu verfälschen. Genau das ist aber fast unmöglich, wenn man auf das generische Maskulinum besteht. Ein Beispiel: Wenn in der Zeitung steht „alle Parlamentarier beteiligten sich an der Abstimmung“, könnte man das entweder so verstehen, dass alle männlichen Parlamentarier sich beteiligten oder eben alle Parlamentarier*innen. Es bleibt unklar.
Unsere Sprache ist seit Jahrhunderten gegendert
Gegner*innen gendergerechter Sprache sprechen immer wieder vom „Gendern“, verkennen dabei aber, dass unsere Sprache seit Jahrhunderten gegendert ist: männlich gegendert. Manche Menschen verstehen das Männliche offenbar so sehr als Norm, dass sie es gar nicht mehr als gegendert erkennen. Das Gegenteil wäre also eine gendergerechte Sprache, die wiederum alle inkludiert. Manchmal lässt sich das über neutrale Umformulierungen wie Zuschauende lösen und manchmal braucht es dafür ein Sonderzeichen.
Apropos gelebte Realität abbilden: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kommt in einem neuen Kurzgutachten zum Schluss, dass das staatliche Verbot inklusiver und geschlechtergerechter Sprache verfassungsrechtlich problematisch ist. Demnach handelt das Bundesland Bayern mit dem Verbot, an Schulen und in Behörden inklusive Sprache zu nutzen, den Wertungen des Grundgesetzes zuwider. Demzufolge sollen nämlich alle Geschlechter gleichbehandelt und niemand diskriminiert werden.
In Bundesländern mit entsprechenden Verbotsregelungen berichten Lehrpersonen davon, dass sie bestimmte Unterrichtsmaterialien (bspw. herausgeben von der Bundeszentrale für politische Bildung) nicht mehr verwenden dürfen, weil darin geschlechtergerecht formuliert wird. Das widerspricht laut Kurzgutachten des Bundes sowohl der Wissenschaftsfreiheit, die in Hochschulen gilt, als auch der Meinungs- und Handlungsfreiheit von Unterrichtenden und Lernenden an Schulen.
Das brachiale Durchdrücken-wollen männlich gegenderter Sprache zementiert nicht nur Jahrhunderte patriarchaler Unterdrückung, sondern ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. Wer da den antifeministischen Backlash, den zunehmenden Einfluss und das Anbiedern an rechtsextreme Kräfte nicht sieht, verschließt bewusst die Augen. Dabei ist genau das: Antifeminismus at it’s best.
Sprache ist mächtig
Ein weiteres Argument für inklusives Sprechen ist die Tatsache, dass Sprache die Realität nicht nur korrekt wiedergeben sollte, sondern auch umgekehrt wirkt: Sie schafft Realität. Diverse Studien belegen, dass die Nutzung des generischen Maskulinums in Stellenausschreibungen dazu führt, dass Frauen sich eher nicht angesprochen fühlen; dass sie, wenn von Ärzten, Studenten oder Erziehern die Rede ist, nicht unbedingt mitgedacht werden; und dass sich Kinder, insbesondere Mädchen, durch die Nennung aller Geschlechter in Jobtiteln mehr Berufe zutrauen. Mitgemeint reicht also nicht. Denn mitgemeint bedeutet nicht automatisch mitgedacht.
Die sprachliche Unsichtbarkeit von Frauen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen ist das Relikt einer Gesellschaft, die uns gesellschaftliche Teilhabe verwehrt hat. Wie Nemos Beispiel zeigt, wird der männlich gegenderte Sprachgebrauch der immer offener gelebten Vielfalt in unserer Gesellschaft nicht (mehr) gerecht und bildet die Realität schlicht nicht korrekt ab.
Natürlich wird Gleichberechtigung nicht allein durch gendergerechte Sprache erreicht. Doch Sprache entscheidet darüber, wie wir die Welt wahrnehmen, und die sprachliche Inklusion mehrerer Geschlechter hat das Potenzial, uns einige Schritte näher an eine vielfältigere, tolerantere Welt zu bringen. Und das, im Vergleich zu deutlich größeren Brocken wie ungleich verteilter Care-Arbeit, dem Gender Health Gap oder Altersarmut, mit sehr einfach umzusetzenden Mitteln.