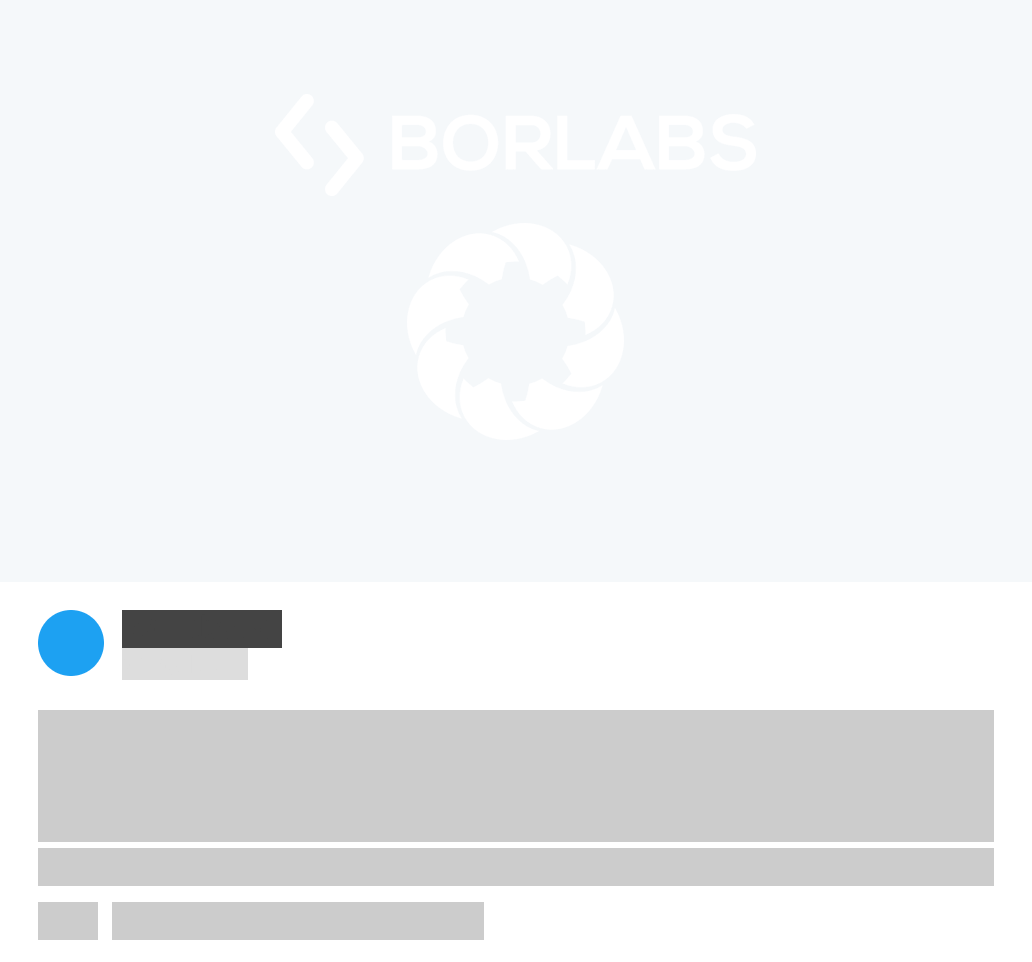Ein Mann aus Essen ist mutmaßlich in der Silvesternacht mit seinem Auto in Menschengruppen gerast, um sie gezielt zu töten. Warum das keine Amokfahrt, sondern Terrorismus und keine Fremdenfeindlichkeit, sondern Rassismus ist. Ein Kommentar.
Sprache schafft Wirklichkeit
Ein Mann aus Essen ist mutmaßlich in der Silvesternacht mit seinem Auto in Menschengruppen gerast, um sie gezielt zu töten. Acht Menschen wurden verletzt. Kaum vorstellbar, was in Deutschland los wäre, wäre diese Amokfahrt, wie es oft in den letzten Tagen zu lesen war, nicht von einem weißen Herkunftsdeutschen namens Andreas N. verübt worden. Da müsste man sich auf manchen Nachrichtenseiten wohl nicht beinahe die Finger wundscrollen, um auf die Schlagzeile zu stoßen.
Dann würde da vielleicht auch stehen, was es nach aktuellen Erkenntnissen tatsächlich war: Terrorismus. Als gezielter Anschlag wird der Vorfall mittlerweile auch von den Behörden eingestuft. Nach Informationen des Tagesspiegels prüft die Bundesanwaltschaft, ob sie die Ermittlungen übernimmt, da es sich um Terrorismus handele. Terrorismus – ein Begriff, der verständlicherweise die Alarmsignale aller bedient, der aber hierzulande nur den Fällen vorbehalten ist, in denen Täter*innen und Opfer bestimmte Voraussetzungen in Bezug auf ihre Hautfarbe, ihren Namen oder ihren Glauben erfüllen müssen.
Stattdessen kann man in Deutschland, wie auch bei rechten Terroranschlägen in den USA, die Uhr danach stellen, wann die*der Erste auf den sozialen und psychischen Zustand des Täters hinweisen wird.
Dass der 50-jährige mutmaßliche Täter systematisch versuchte, über einen längeren Zeitraum an vier verschiedenen Standorten Menschen zu töten, zählt offenbar nicht. Und auch nicht, dass seine Tat einen ideologisch-politischen Hintergrund hatte, der laut UN-Definition von Terrorismus maßgebend ist. Der Mann handelte aus rassistischen Motiven, wie er gleich bei der Vernehmung nach seiner Festnahme deutlich machte. Es ärgere ihn etwa, sagte er laut Ermittler*innen, dass auch arbeitslose Ausländer, wie er sie nennt, Geld vom Staat bekämen. In Bottrop fuhr er auf dem zentralen Berliner Platz in die Menge. Vier Menschen wurden dort verletzt, darunter Menschen mit syrischem und afghanischem Background. Eine 46-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr.
Wenn wir ein Interesse daran haben, Rassismus zu bekämpfen, müssen wir ihn beim Namen nennen
Stattdessen kann man in Deutschland, wie auch bei rechten Terroranschlägen in den USA, die Uhr danach stellen, wann die*der Erste auf den sozialen und psychischen Zustand des Täters hinweist. Der Mann aus Essen war wohl Hartz-4-Empfänger und litt vermutlich an einer psychischen Erkrankung, ließ NRW-Innenminister Herbert Reul im WDR-Fernsehen gleich wissen. Nein, weder ist Rassismus eine hinreichende Bedingung für psychische Erkrankungen, noch ist er das Produkt einzelner, schizophrener oder armer Menschen. Und am wenigsten schließt das Eine das Andere aus. Die Journalistin und Autorin Fatma Aydemir twitterte dazu treffend:
Wenn unsere Gesellschaft ein ernsthaftes Interesse daran hat, Rassismus zu bekämpfen, muss er ihn endlich als das flächendeckende, systematische Phänomen erkennen, das er ist. Denn spätestens seit der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) im Jahre 2011, der fast ein Jahrzehnt scheinbar unbemerkt durch das Land morden konnte, ist unübersehbar, dass die deutsche Öffentlichkeit und Ermittelnde den Mord an nicht-weißen Menschen mit einer anderen, milde gesagt, geringeren Differenziertheit und mit weniger Nachdruck nachgehen.
In einem Gastbeitrag für Spiegel Online im letzten Monat schrieb der Schriftsteller Deniz Utlu, nachdem die rassistischen Drohungen durch ein Netzwerk aus Polizist*innen, das sich selbst NSU 2.0. nannte, bekannt geworden waren: „Einige Politiker und Medienberichte bezeichneten das Vorgehen der Behörden als ‚Pannen‘ oder ‚Versagen‘, Ausnahmen also in einem grundsätzlich funktionierenden System. Die entscheidende Frage ist aber nicht, ob das System funktioniert, sondern für wen es funktioniert und für wen nicht.“ Die längst überfällige Einsicht, dass die Leben aller Menschen in dieser Gesellschaft gleichermaßen zu schützen seien, beginne damit, „die Perspektive derjenigen in der Gesellschaft einzunehmen, deren Körper am gefährdetsten sind.“
Wenn nun sogar der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im WDR davon spricht, es habe klare Absichten des Mannes gegeben, „Ausländer zu töten“, bekommt man schon ein Gefühl dafür, wie weit Politiker*innen und auch die meisten Journalist*innen davon entfernt sind, ihre eigene Perspektive zu verlassen. Viele Medien haben in den letzten zwei Tagen diese Formulierungen übernommen oder von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Da haben sie und der Täter schon mal eins gemeinsam: Sie markieren bestimmte Menschen aufgrund äußerer Merkmale wie ihrer Haut- und Haarfarbe als fremd. Oder wie es zwei Twitter-Userinnen auf den Punkt bringen:
Wörter schaffen den Rahmen dafür, wie wir mit Erlebtem und Erfahrenen umgehen, es kategorisieren, Relevanz zusprechen, relativieren und: wie wir zu den Betroffenen stehen. Werden diese immer und immer wieder als Fremde und Außenstehende markiert, ist rassistischer Terrorismus nichts, was die Mehrheitsgesellschaft als „uns“, sondern wieder nur als „die da“ betrifft. Deren Perspektive, wie Deniz Utlu es nannte, bleibt so eine isolierte, andere, gefährdete. Eine einsame.
Der Originaltext von Seyda Kurt ist bei unserem Kooperationspartner ze.tt erschienen. Hier könnt ihr ze.tt auf Facebook folgen.
Mehr bei EDITION F
„Ich habe Angst“ – wie Rassismus den Alltag junger Menschen verändert. Weiterlesen
#MeTwo zeigt, wie verankert Rassismus in unserer Sprache und Gesellschaft ist Weiterlesen
Chimamanda Ngozi Adichie: „Privilegien machen uns blind“ Weiterlesen