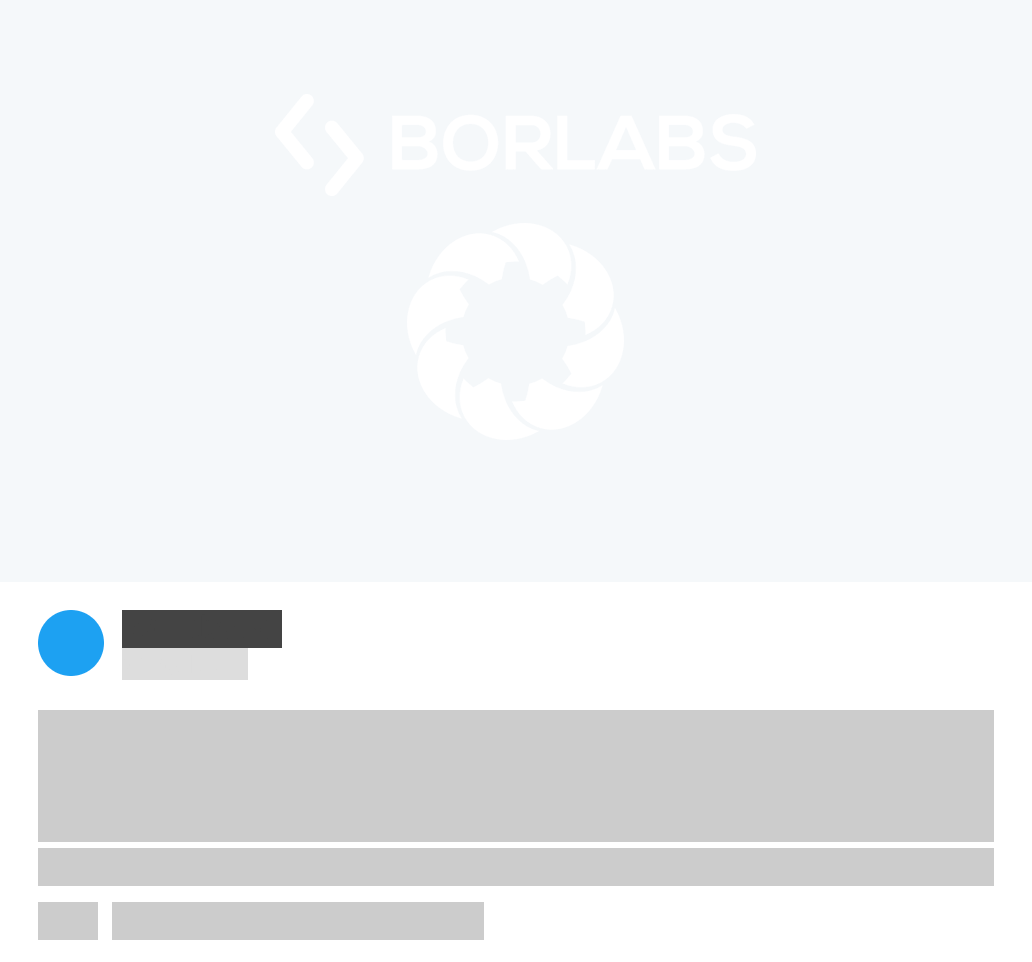Miriam Davoudvandi schafft mit ihrem neuen Psychologie-Podcast einen virtuellen Rückzugsort für Betroffene. Ihre eigene Geschichte zeigt: Marginalisierte Menschen führen in der Psychotherapie noch immer ein Schattendasein.
Am 26. August schickt Miriam Davoudvandi auf Twitter Grüße in die Nacht: „Morgen 5 Uhr ist eine neue Folge von DANKE, GUT online. Meine lieben Malocher:innen und Arbeiter:innen i got u“. 274 Menschen gefällt das. Sie ergänzt: „Meine Depris mit Schlafstörungen i got u too“.
Miriam Davoudvandi ist Journalistin und DJ. Sie spricht und schreibt über Feminismus, Rassismus und Rap. Bei Twitter folgen ihr über 19.000 Menschen. „Ich mach Rap wieder weich“ steht in ihrer Twitter-Bio und als Tattoo in ihrer Armbeuge: Stay soft.
In ihren Interviews spricht sie mit Rapper*innen, die ihrem Ruf nach früher auf dem Schulhof Nackenklatscher statt Freundschaftsbücher verteilt haben. Mit Davoudvandi sprechen sie über ihre Kindheit, Angstzustände und Depressionen. Und das geht gut, denn Miriam Davoudvandi ist selbst betroffen: Sie hat Depressionen.
Jetzt moderiert sie den neuen Gesprächspodcast „Danke, Gut.“ zum Thema mentale Gesundheit. Ob Podcasts, Tweets oder Rap-Interviews – ihr Thema: psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren und mit Vorurteilen aufzuräumen.
Marginalisierte Gruppen sind besonders gefährdet
Mit einer Mutter, die als Reinigungskraft arbeitet und einem Vater, der als Maler und Anstreicher sein Geld verdient, zählt Davoudvandis Familie selber zu den Malocher*innen und Arbeiter*innen, denen sie die zweite Folge ihres Psychologie-Podcasts widmet. Studien belegen, dass genau diese Bevölkerungsgruppe besonders von psychischen Erkrankungen betroffen ist. Denn psychisches Leid und gesellschaftliche Ungleichheit bedingen einander: Menschen marginalisierter Gruppen weisen häufiger psychische Erkrankungen auf. Belastungen durch die Arbeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, unbestimmte Zukunftsängste – all das macht krank.
Meine Eltern waren von morgens bis nachts ackern, teilweise in drei verschiedenen Jobs.
Miriam Davoudvandi
Gleichzeitig sind Krankheiten genau in dieser sozialen Schicht häufig ein Tabuthema, auch weil Kranksein bei bestimmten Jobs mit dem Ausfall des Verdienstes einhergeht. Hat Davoudvandis Mutter bei der Arbeit gefehlt, blieb auch der Lohn aus. „Das hat sie dann auf mich übertragen: Wenn ich aufgrund von Depressionen zuhause bleibe und nicht zur Schule gehe, dann verpass ich was, mache meinen Abschluss nicht und lande auf der Straße“, erzählt Miriam Davoudvandi am Telefon.
Schmerzen und Krankheit, ob körperlich oder psychisch, wurden daher einfach verdrängt. Zeit für Selbstfürsorge gab es nicht. Wenn Miriam Davoudvandis Eltern nach einem ganzen Tag ackern, mit zeitweise drei Jobs, nach Hause kamen, hatten sie keine Kapazitäten mehr, sich mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen, oder der ihrer Tochter. Rückblickend kann Davoudvandi das verstehen: „Dass man abends vielleicht auch einfach mal nur Bock auf Glotze hat und eben nicht darauf, sich tiefgründig mit sich zu befassen.“
Wer profitiert vom psychotherapeutischen Angebot?
Mentale Gesundheit ist ein immerwährendes Nicht-Gesprächsthema, doch ganz gleich wohin man blickt, es ist überall präsent: Flucht und Migrationserfahrungen, wie Miriam Davoudvandi sie mit ihrer Familie im Alter von sechs Jahren erlebt hat – und auch Diskriminierungserfahrungen – sind oft traumatisch. Die Sprache erlernen, sich im neuen Umfeld integrieren, Geldsorgen, Kindererziehung, Arbeit – und das alles unter erschwerten Bedingungen: Das ist belastend.
Doch genau die Menschen, die das höchste Risiko für eine psychische Erkrankung haben, profitieren am wenigsten von psychotherapeutischen Angeboten: Menschen marginalisierter Gruppen. Die größte Risikogruppe sind alleinerziehende Mütter. Sie haben nicht nur das höchste Armutsrisiko in unserer Gesellschaft, sondern damit einhergehend auch das höchste Risiko, eine psychische Erkrankung zu bekommen. Die Patient*innengruppe, die bei stationärer psychischer Behandlung die kürzeste Verweildauer aufweisen, sind Hausfrauen. Ist Psychotherapie immer noch ein Privileg der „erfolgreichen“ Mittelklasse?
Psychotherapie, ein Privileg?
Studien aus den USA deuten darauf hin, dass Therapeut*innen Patient*innen höherer sozialer Schichten bevorzugen. Alle Patient*innen hatten den gleichen Versicherungsstatus. Trotzdem hatte die soziale Klasse der Patient*innen Einfluss darauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, einen Platz für eine Psychotherapie zu bekommen. Auch andere Studien zeigen: Als attraktiv wahrgenommene, intelligente und erfolgreiche Patient*innen werden bevorzugt.
Davoudvandi spricht offen über ihre Erkrankung – mal eindringlich, mal ironisch, immer mit sanfter, aber klarer Stimme: Sie ist 13 oder 14 Jahre alt, als sie keine Kraft mehr für die Schule und keinen Bock mehr auf Freund*innen hat. Dass wirklich etwas mit ihr nicht stimmt, merkt sie, als sie anfing sich ganze Haarbüschel auszureißen und selbst keine Antwort darauf fand, wieso sie das machte.
Fast zeitgleich bekam sie von ihren Eltern einen Psychologie-Duden geschenkt, mit Definitionen psychischer Erkrankungen. „Den habe ich damals verschlungen“, sagt Davoudvandi „aber da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es mich ja vielleicht betrifft, was in diesem schlauen Buch steht.“ Miriam Davoudvandi hatte sich das Buch zu Weihnachten gewünscht. Mit wenig Geld mussten ihre Eltern die Weihnachtsgeschenke genau kalkulieren. „Das Buch war zum Glück drin“, erinnert sich Davoudvandi.
Ein Studium der Reichen?
Auch hier liegt der Kern der ungleichen Zugänglichkeit zur Psychotherapie: Wer Psycholog*in werden möchte, hat einen langen Weg vor sich. Fünf Jahre mindestens für das Bachelor- und Masterstudium, anschließend drei bis fünf Jahre Weiterbildung zum*r Psychotherapeut*in, um die praktische Tätigkeit zu lernen. Bis vor kurzem mussten die Auszubildenden gar nicht bezahlt werden. Seit der diesjährigen Reform der Psychotherapeut*innenausbildug steht den Student*innen eine Mindestvergütung von monatlich 1.000 Euro zu – in Vollzeit.
Die Auszubildenden schuften für einen Niedriglohn und können mit ihren Einnahmen die Kosten kaum decken. In einer Umfrage aus dem Jahr 2009 geben über 80 Prozent der Student*innen an, dass es finanzielle Gründe sind, die sie von einer Ausbildung in Psychotherapie abhalten. Wer Psychotherapeut*in werden will, muss es sich leisten können.
Bestimmte Lebensrealitäten kommen kaum vor
Die Effekte sozialer Unterschiede zwischen Therapeut*innen und Patient*innen sind nicht gut untersucht. Doch Menschen suchen psychotherapeutische Unterstützung zur Bewältigung bestimmter Schwierigkeiten im Leben auf, nur dass in der Praxis die alltäglichen Lebensbedingungen bestimmter soziokultureller Kontexte keine Rolle zu spielen scheinen. Jedenfalls kommen sie kaum vor.
Was verändert es für die Patient*innen, wenn Therapeut*innen aus privilegierteren sozialen Schichten kommen? „Es wäre wichtig, dass gerade Psychotherapeuten ihre eigene Positionierung in der Gesellschaft, die eigene Privilegierung, aber auch Diskriminierungserfahrungen reflektieren“, sagt die Psychotherapeutin Leonore Lerch in einem Interview. Lerch forscht im Bereich Diversität, Intersektionalität und Rassismus in der Psychotherapie.
Denn nicht nicht nur sozioökonomische Merkmale, auch der kulturelle Hintergrund, oder Flucht- und Rassismuserfahrungen, werden in der Psychotherapie noch zu wenig reflektiert. „Ich glaube, dass viele Patient*innen sich eher Personen anvertrauen, bei denen sie das Gefühl haben, sie teilen einen Erfahrungsraum“, sagt Parissima Taheri-Maynard. Die Psychologin hat sich auf die Erfahrungen von Minderheiten in der Psychotherapie spezialisiert und das Projekt „Wir sind auch Wien“ gegründet, um einen Raum zu schaffen für People of Color, frei von Stigmata und Vorurteilen.
Es wäre wichtig, dass gerade Psychotherapeuten ihre eigene Positionierung in der Gesellschaft, die eigene Privilegierung, aber auch Diskriminierungserfahrungen reflektieren.
Leonore Lerch, Psychotherapeutin
Auch bei der Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie in Berlin melden sich immer wieder Patient*innen, die Diskriminierungserfahrungen in der Psychotherapie erlebt haben. „Ich kenne es von mir selbst, sowie von allen meinen Klient*innen in der Psychotherapie, die immer wieder Rassismus und Queerfeindlichkeit erfahren mussten, Bildungsarbeit leisten mussten, und sich in Frage gestellt gefühlt haben“, sagt Parissima Taheri-Maynard. Viele würden sich erst gar nicht trauen hinzugehen.
Wenn der Leidensdruck groß ist…
Auch Miriam Davoudvandi fühlte sich zunächst fremd bei ihrer Therapeutin: „Ich war da auf jeden Fall die Außenseiterin in der Praxis. Sie meinte auch zu mir, dass ich die erste Person mit Migrationshintergrund bin, die sie überhaupt behandelt.“ Ein traumatisierender Vorfall, über den sie öffentlich nicht sprechen will, hatte Davoudvandi damals den Spiegel vorgehalten: Es geht so nicht mehr weiter.
Ihre Freund*innen haben für sie Therapeut*innen abgeklappert, Nummern herausgesucht und ihr am Ende den Platz bei der Therapeutin besorgt. Davoudvandi kommt aus einem badischen Dorf, das Angebot war klein, der Leidensdruck groß. Also hatte Davoudvandi keine andere Wahl, als sich trotz Schwierigkeiten auf ihre Therapeutin einzulassen: „Wir haben uns angenähert“, sagt Miriam Davoudvandi heute.
Als ich weggezogen bin, habe ich eine neue Therapeutin gesucht und natürlich habe ich bewusst nach ausländisch klingenden Nachnamen geschaut.
Miriam Davoudvandi
Die Frage, ob sie sich eine Therapeut*in gewünscht hätte, die ihrer Lebensrealität näher gewesen wäre, verneint sie jedoch. Denn sie hat eine gute Erfahrung gemacht und ist auch ein bisschen stolz auf sich: „Das Wissen, dass sie jetzt vielleicht durch mich sensibilisiert wurde und das neue Wissen dann bei der nächsten Person mit reinnimmt, das finde ich eigentlich sogar ganz schön.“
Dass Davoudvandis Therapeutin erst durch ihre Patientin sensibilisiert wurde, zeigt jedoch: Klassismus, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft und Position, und ein rassismuskritischer Umgang werden zu wenig in der psychotherapeutischen Praxis thematisiert und fehlen auch als Teil der Ausbildung. Auch wenn Davoudvandi zufrieden war mit ihrer Therapie, sieht sie die Dringlichkeit für das Bewusstsein, über Klassismus und mangelnde Diversität in der Psychotherapie zu sensibilisieren: „Als ich weggezogen bin, habe ich eine neue Therapeutin gesucht und natürlich habe ich bewusst nach ausländisch klingenden Nachnamen geschaut.“
Mehr Perspektiven beim Thema mentale Gesundheit
Medienprodukte wie der Podcast von Miriam Davoudvandi können zwar keine Therapie ersetzen; sie können aber eine Perspektivenvielfalt auf mentale Erkrankungen zeigen. Die Punchline zum Podcast liefert die Musikjournalistin Davoudvandi selbst: „Ich hatte selber immer das Bedürfnis nach mehr Themen dazu, nach mehr Medien dazu. Ich hätte mir das einfach selber gewünscht für mein 14-jähriges Ich, das sich damals die Haare ausgerissen hat.“
Hilfsangebote:
Solltest du dich betroffen fühlen, oder Personen in deinem Umfeld haben, die betroffen sind, dann findest du bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Hilfe: 08001110111 und 08001110222. Zögere bei Selbst- oder Fremdgefährdung nicht, den Rettungsdienst unter 112 zu rufen, oder dich an einen psychiatrischen Notdienst zu wenden.