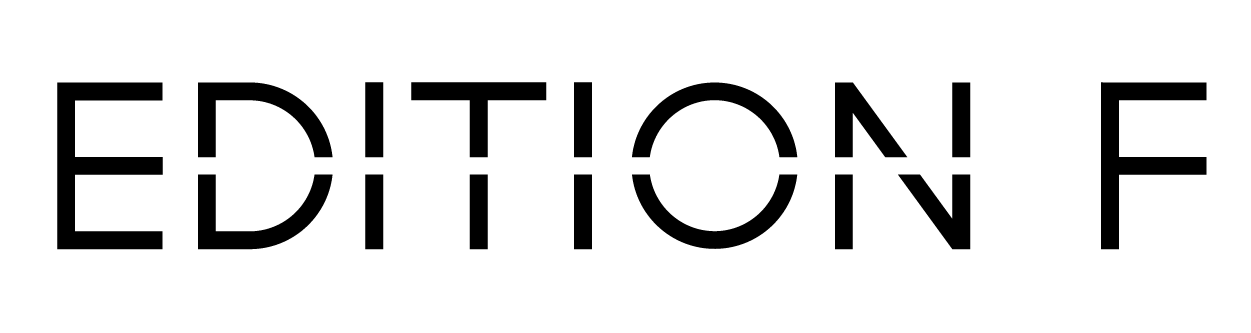Zwischen digitaler Omnipräsenz und der Suche nach Authentizität ringen junge Menschen mit der Frage: „Was will ich eigentlich vom Leben?“ So geht es auch unserer Community-Autorin Daniela Pirchmoser.
Mitte 20 machen viele Menschen eine Krise durch: die sogenannte „Quarter Life Crisis“. Neben den Krisen, die wir in der Welt miterleben – sei es eine Pandemie, der Klimawandel oder das Aufkommen neuer Kriege auf der ganzen Welt – drängt sich vielen Millennials und GenZs dann auch noch die ganz persönliche Krise auf. Fragen stellen sich wie: Was mache ich bloß mit meinem Leben? Wer bin ich? Und: Wer will ich sein? Es fühlt sich an, als würden Selbstbild und gesellschaftliche Erwartungen miteinander ringen.
Die Qual der Wahl
Ich weiß nicht, was ich will oder gar wohin es gehen soll. Ich weiß nicht, welche berufliche Laufbahn ich anstreben soll oder wie mein allgemeiner Lebensentwurf aussieht. Ich weiß ja nicht mal, was ich heute anziehen soll. Ich schreibe an meiner Masterarbeit, zweifle aber an meiner Studienwahl. Ich tüftle an Codezeilen in der Programmiersprache „R“, dabei wollte ich seit drei Jahren Französisch lernen. Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, ein neues Studium anzufangen, wo ich doch langsam beginne, Geld zu verdienen, das ich, so nebenbei bemerkt, zum Leben brauche. Was mache ich aus all diesen Bestrebungen, die sich teilweise diametral gegenüberstehen und mich nicht mehr links von rechts unterscheiden lassen? Als „Digital Native“ stehe ich vielleicht vor der ersten großen Frage, deren Antwort ich nicht einfach so bei Google herausfinden kann. Und ich sage euch, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, das zugeben zu müssen in einer Welt, in der alle zumindest so tun, als ob sie genau wüssten, was sie vom Leben wollen und zielstrebig daraufzugehen. Ich hingegen torkele.
Die Verwirrung durch soziale Medien
Tagtäglich prasseln durch die sozialen Medien so viele Bilder, Meinungen und Lebensanschauungen auf uns ein, dass es immer schwieriger wird, zu differenzieren, was möglich ist und was nicht. Wir sind berauscht von der Vielzahl an Optionen, dem „Choice Overload“, der zu Unsicherheit, Stress und letztendlich einer geringeren Zufriedenheit mit der getroffenen Entscheidung führt. Es wird komplizierter, darüber nachzudenken, was noch real und was schon Fiktion, was erreichbar oder bloß übertriebene Selbstinszenierung ist. „Trust the process“, heißt es nur immer. Aber ist es denn glaubhaft, dass all diese erfolgreichen „LinkedInfluencer“ mit Mitte 20 schon die eigene wahre Passion gefunden haben? Um ehrlich zu sein, ich bezweifle es. Ich bezweifle es ebenso, wie ich Zweifel an meinen eigenen Entscheidungen hege. Und ich hinterfrage es so ebenso kritisch, wie ich mich selbst und die Welt um mich herum hinterfrage. Man könnte zusammenfassen: Ich hinterfrage mein Hinterfragen. Doch wie hört man damit eigentlich wieder auf?
Auf einer meiner Sinnsuchen durch das Internet stieß ich auf den vielleicht bekanntesten Zweifler der Welt, den französischen Philosophen René Descartes. Descartes war an einem Punkt in seinem Leben (mit 44 Jahren, also mitten in der Mid-Life-Crisis) wohl so verzweifelt, dass er das Verfahren des „methodischen Zweifels“ entwickelte. Descartes wollte alles infrage stellen, was er bisher für wahr gehalten hatte. Und da ihm der französische Wein offensichtlich nicht stark genug war, tat er dies, indem er sich vorstellte, dass ein Dämon seine Sinneswahrnehmungen manipulierte, um ihn bis zum Äußersten zu täuschen. Alles was den Test bestehen würde, seien absolut unerschütterliche Erkenntnisse, so Descartes Ansatz. Durch die Schaffung dieses Wesens versuchte er, sich gezielt freizumachen von jeglichen Vorurteilen und Unsicherheiten. Übrig blieb tatsächlich nicht viel. Die einzige Erkenntnis, die Descartes als vollends unzweifelhaft ansah, war seine berühmte Aussage: „Cogito, ergo sum“ (Ich denke, also bin ich). Denn selbst wenn er von einem Dämon getäuscht würde, belege sein eigenes Denken zumindest, dass er, also Descartes, existiere. Das ist ja schon mal was.
Eine Erkenntnis
Wenn Descartes das mitten in seiner eigenen Lebenskrise niederschrieb, beruht seine größte philosophische Erkenntnis vielleicht tatsächlich auf der simplen Feststellung, die Hälfte seines Lebens bereits „verlebt“ oder sogar „vergeudet“ zu haben? Und wenn ja, macht das seine Philosophie nicht sogar noch wertvoller für uns Quarter-Life-Zweifler? Ich meine damit nicht, dass wir dem Streben Descartes folgen sollen, der im vergeblichen Warten darum, der schwedischen Königin seine Arbeit vorzustellen, starb, sondern vielmehr darin, uns mit unseren eigenen Dämonen anzufreunden. Indem Descartes das Bild des Dämons schuf, konnte er sich klarer davon abgrenzen. So konnte er von dem erdachten Wesen in allem getäuscht werden, aber an einem konnte der Dämon nicht rütteln: an Decartes Zweifeln und Gedanken. Er schlussfolgerte daraus, dass unter allen Umständen seine Gedanken und Zweifel ihn zu dem machten, was er war. Ich denke, also bin ich.
Die Orientierungslosigkeit der Generationen
Vor gefühlt endlos vielen Optionen sind wir als Generation wohl gerade dazu prädestiniert, die Orientierung zu verlieren und werden von vielen Dämonen geplagt. Unter allen Wegen, die uns heute (scheinbar) offen stehen, wollen wir vor allem eine durchdachte Entscheidung treffen und alles richtig machen – was auch immer das bedeuten mag. Der aktuelle „Choice Overload“ verlangt es deshalb mehr denn je, Freundschaft mit dem Zweifel zu schließen. Denn es ist die Unsicherheit, die uns das wirklich Wesentliche aufzeigt und gesunde Nüchternheit bringt.
Auch wenn sich die oberflächlichen Lebensrealitäten seit Descartes verändert haben, das Menschsein und die Fragen, die uns im Laufe des Lebens umtreiben, bleiben doch dieselben. Nicht ohne Grund ist die Frage nach dem Sinn des Lebens ein stetiges Thema durch alle Zeiten und Kulturen hindurch, das alle zweifeln lässt. Eine schlussendliche, allgemeingültige Antwort darauf wurde noch nicht gefunden. Vielleicht ist das ehrlicherweise auch nicht der Zweck dieses Gedankenspiels. Denn was am Ende übrig bleibt, wenn man alles reduziert, ist, dass das Leben da ist, um gelebt zu werden – mit all seinen Höhen und Tiefen, Hoffnungen und Zweifeln. Vielleicht ist deshalb unser Job mit Mitte 20, alle Zweifel zwar wahrzunehmen, uns aber nicht von ihnen ausbremsen zu lassen.
Was mache ich jetzt also nun aus all meinen gegensätzlichen Wünschen und Vorstellungen? Ganz ehrlich, ich lasse sie einfach sein. Ich möchte meine Verwirrtheit als Teil meiner Lebensphase akzeptieren. Sie darf nur nicht zwischen mich und meine Lust auf das Leben kommen. Wer weiß schon, auf welche tollen Wege mich das Torkeln verschlagen mag.
Mehr zum Thema bei EDITION F
Lanna Idriss über die GEN Z: „Ich erlebe eine Generation, die ein erhebliches Empfinden für soziale Gerechtigkeit hat!“ – Weiterlesen
Warum ich mir mehr Zeit nehmen möchte, um Entscheidungen zu treffen – Weiterlesen
Achtsamkeit – Ein Helfer in stressigen Zeiten – Weiterlesen