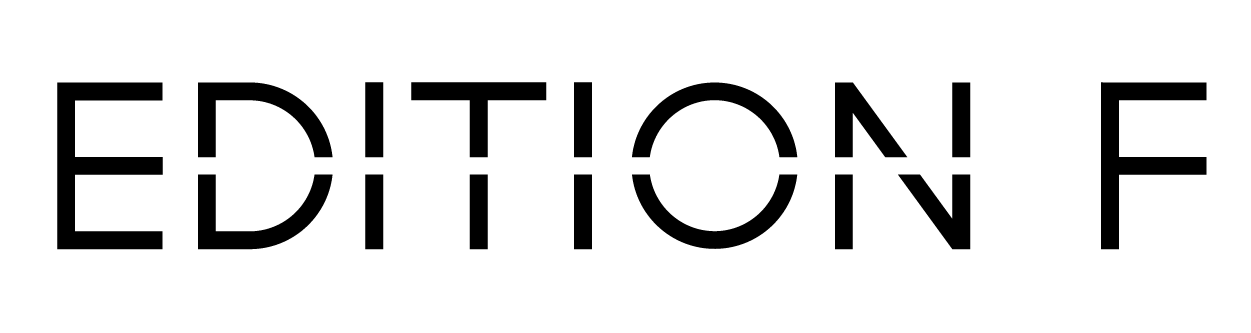Katrin Glatz Brubakk ist Kinderpsychologin und Traumatherapeutin. Seit zehn Jahren arbeitet sie für Ärzte ohne Grenzen in Krisen- und Kriegsgebieten, um traumatisierten Kindern zu helfen. Vor wenigen Monaten kehrte sie von ihrem zweiten Einsatz in Gaza zurück. Im September erscheint ihr Tagebuch aus Gaza.
Grelle Mittagssonne fällt durch das Fenster, als Katrin Glatz Brubakk sich zum digitalen Interview zuschaltet. Die Kinderpsychologin lebt in Trondheim, Norwegen. Gerade ist sie für ein paar Monate zu Hause. Doch voraussichtlich im August wird sie wieder aufbrechen. Es wird ihr dritter Einsatz für Ärzte ohne Grenzen in Gaza sein.
Der Frage, wie es ihr geht, folgt eine längere Pause. „Eigentlich gut“, sagt Katrin Glatz Brubakk. Aber Zuschauerin zu sein und ständig die Meldungen von Freund*innen und Kolleg*innen aus Gaza zu erhalten, sei nicht leicht. „Jedes Mal, wenn das Telefon ein Geräusch macht, könnte das eine Todesnachricht sein. Ich bin seit zehn Jahren unterwegs und pendle immer wieder zwischen Krisengebieten und zu Hause. Meistens kann ich mich relativ schnell an die Umstellung gewöhnen. Aber diesmal ist es anders. Es ist unmöglich, loszulassen.“
Katrin Glatz Brubakk kennt die Situation vor Ort. Sie hat miterlebt, wie sich dauerhafte Unsicherheit und Todesangst anfühlen und was das mit den Menschen macht. Mit uns spricht sie über das Leid der Kinder in Gaza, die Möglichkeiten und Grenzen der Traumatherapie in einer nahezu zerstörten Gesellschaft und die Hoffnung auf ein Ende des Krieges.
Hintergrund: Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas einen groß angelegten Terrorangriff auf Israel, bei dem mehr als 1.200 Israelis getötet und über 200 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die israelische Regierung reagierte mit massiven Luftangriffen und leitete eine umfassende militärische Gegenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen ein. Sie verhängte am 9. Oktober 2023 eine vollständige Blockade des Gazastreifens. Im Verlauf des Krieges wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bis April 2025 mehr als 52.000 Menschen getötet und rund 119.000 verletzt. Es trifft vor allem die Zivilbevölkerung: Rund 1,9 Millionen der etwa 2,2 Millionen Einwohner*innen Gazas mussten fliehen und leben auf engstem Raum in Evakuierungsgebieten.
Nach dem Scheitern von Waffenstillstandsverhandlungen verschärfte die israelische Regierung am 2. März 2025 die Blockade erneut, sodass seitdem keine Hilfslieferungen mehr nach Gaza gelangten. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen berichten, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern immer schwieriger wird, man nähere sich dem „humanitären Abgrund“. Im Mai 2025 begann die israelische Armee eine neue „Großoffensive“ im Gazastreifen, bei der Hunderte Tote gemeldet wurden. Israels Regierung hat angekündigt, die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter unter bestimmten Bedingungen wieder zuzulassen, konkrete Umsetzungen stehen jedoch aus.
Katrin, du warst in diesem Jahr zum zweiten Mal längere Zeit in Gaza, seit Ende Februar bist du zurück. Kannst du uns von deiner Ankunft in Gaza erzählen?
„Als ich in Jordanien ankam, wurde bereits über einen möglichen Waffenstillstand gesprochen. Der kam drei Tage nach meiner Ankunft in Gaza. Diese ersten drei Tage waren sehr intensiv. Es wurde viel gebombt. In der letzten Nacht kamen die Bomben und Schüsse so nah, dass wir in unserem sogenannten Sicherheitsraum schlafen mussten. Das ist ein Zimmer, in dem Fenster und Türen verbarrikadiert sind und in dem es einige Vorräte gibt.
Es war eine seltsame Stimmung. Alle Leute haben darauf gewartet, dass die Bomben endlich aufhören. Sie haben die Stunden, die Minuten gezählt. Gleichzeitig wurden die Bomben immer lauter und bedrohlicher. Ein Kollege erzählte mir, dass er kurz vor dem Waffenstillstand nur knapp einer schweren Verletzung oder dem Tod entkommen sei. Während er draußen noch seine Katze fütterte, hatte ein Granatsplitter sein Zelt durchschlagen.“

„Die Zerstörung ist unvorstellbar“
Was änderte sich, als der Waffenstillstand kam?
„Als der Waffenstillstand kam und auch anhielt, war es anders als bei meinem ersten Aufenthalt in Gaza. Die konstante extreme Angst brach erst einmal ab. Diese Angst, jeden Moment sterben zu können, oder die Angst, dass deine Kinder sterben oder dein Zelt zerstört wird. Die Leute konnten die Schultern ein bisschen senken, ein bisschen mehr atmen.
Wenn man unablässig an der Kante des Überlebens steht, ist für die Trauer kein Platz. Aber jetzt kam sie eben hoch. Die Trauer über alles, was sie verloren hatten. Ein paar Kinder kamen direkt nach dem Waffenstillstand und jubelten: ,Ich kann endlich wieder nach Hause, ich kann wieder in mein Zimmer, ich kann wieder spielen mit meinen Sachen.‘ Dann musste man ihnen erklären, dass wirklich nichts mehr da ist. Dass alles zerstört ist.“
Viele Menschen sind in dieser Zeit trotz der großen Gefahr nach Nord-Gaza zurückgekehrt – was haben sie dort vorgefunden?
„Ja, als die Grenze zu Nord-Gaza geöffnet wurde, sind sehr viele Menschen in den Norden gegangen. Zum Teil in der Hoffnung, doch noch etwas von ihrem Zuhause zu finden. Teilweise muss man das auch geschichtlich verstehen, dass sie aus vertriebenen Familien gekommen waren und dass sie nun zurückwollten, weil das ihr Zuhause, ihre Heimat ist. Viele wollten lieber dort ein Zelt aufbauen als in Al-Mawasi oder in der sogenannten humanitären Zone, die total überfüllt ist.
Aber dann fing es an, dass wir verzweifelte Nachrichten von Kolleg*innen bekamen, die nichts mehr von ihren Häusern vorfanden. Es war sehr viel schlimmer, als sie sich das vorgestellt hatten. Manche schrieben: ,Ich stehe hier, die GPS-Koordinaten stimmen, aber ich erkenne meine alte Straße nicht wieder.‘ Zum Teil liegen auch Familienmitglieder der Kolleg*innen unter den Trümmern, es stinkt überall nach Tod. Wilde Hunde laufen durch die Straßen auf der Suche nach Essbarem, man kann sich vorstellen, was sie essen, wenn sie nichts anderes finden.
Die Zerstörung, der Umfang dieser Katastrophe ist – auch, wenn man es gesehen hat – fast unvorstellbar.“

Du hast schon während deines ersten Einsatzes entschieden, all diese Eindrücke aufzuschreiben und zu veröffentlichen.
„Das kam schrittweise. Es fing damit an, dass ich täglich kurze Notizen gemacht habe. Es passierte ständig so viel. Es war wichtig für mich, das einzuordnen.
Ich halte hier in Norwegen regelmäßig Vorträge, unterrichte viel. Dass ich irgendwie vermitteln wollte, was ich erlebte, das wusste ich schon. Nun kann man in Gaza nicht wirklich fühlen, wie es einem gerade geht, man muss seinen Job machen und funktionieren. Als aber bei meinem ersten Einsatz die Bomben wieder sehr nah kamen, schickte ich eine Nachricht an Guro Kulset Merakerås, meine Kollegin, mit der ich das Buch über das Flüchtlingslager Moria geschrieben hatte. In der Nachricht erzählte ich ihr, dass ich jeden Tag E-Mails an mich selber schreibe. Und ich bat sie: ,Falls ich nicht nach Hause komme, mach bitte ein Buch daraus.‘
Guro war über die Meldung etwas entsetzt. Sie antwortete: ,Du kommst nach Hause und schreibst das Buch selbst!‘ Und das tat ich dann.“
„Wer fragt schon ein Kind?“
Hast du mit deinen Kolleg*innen darüber gesprochen?
„Ich hatte erst ein bisschen Angst vor ihren Reaktionen, es war ein ungutes Gefühl. Aber es kam ganz anders. All meine Kolleg*innen sagten: ,Wir sind froh, dass du darüber schreibst, damit die Welt versteht, was hier los ist. Es geht immer nur um Zahlen und Statistik. Um die großen Schlagzeilen. Aber keiner redet davon, wie es uns geht, was das mit uns macht. Wie wir seelisch leiden.‘ Und genau das ist es, was ich vermitteln wollte. Eine Menschlichkeit vielleicht, die in den großen Schlagzeilen immer fehlt.“
Du rückst im Buch auch die Kinder in den Mittelpunkt. Warum ist das so wichtig? Ich muss an Alan Kurdi denken, den zweijährigen syrischen Jungen kurdischer Abstammung, der auf der Flucht über das Mittelmeer ertrank. Sein Bild ging um die Welt, machte das Unerträgliche spürbar.
„Erst einmal: In jedem Krieg, in jedem Konflikt, sind es immer die Kinder, die am meisten leiden. Sie haben nun wirklich nichts falsch gemacht. Sie tragen keinerlei Schuld in irgendeiner Weise. Sie können sich kaum schützen. Wir wissen, dass diese extreme Angst, mit der sie leben müssen, ihre Gehirnentwicklung beeinflusst. Es ist also nicht nur so, dass sie jetzt knapp 20 Monate mit dieser schrecklichen Furcht gelebt haben. Das wird sie für den Rest ihres Lebens verfolgen.
Für Kinder in einer Krisensituation oder in einem Krieg ist das alles total unverständlich. Sie verstehen nicht, warum es passiert, sie können es nicht in einen Kontext setzen. Sie haben nicht die Schutzmechanismen, die wir als Erwachsene gelernt haben. Und: Wer fragt schon ein Kind? Wie oft liest man eine Reportage, die die Sicht eines Kindes integriert? Wie viele Journalist*innen reden schon mit Kindern über ihre Angst, rauszugehen, um zu spielen, weil in der Straße plötzlich eine Bombe einschlagen könnte? Über die Trauer, alle Familienmitglieder verloren zu haben?“
Was unterscheidet deine Erfahrungen mit Kindern in Gaza von anderen Einsätzen, die du als medizinische Fachkraft erlebt hast?
„Durch meine Ausbildung und meine Erfahrung bin ich es gewohnt, dramatische Geschichten zu hören. Sehr schwer verletzte oder kranke Kinder zu sehen. Ich habe da eine Professionalität entwickelt, weil das einfach mein Beruf ist. Aber diese verzweifelten Schreie von Kindern voller Angst und Panik in Gaza: ich habe sie nirgendwo anders erlebt. Und sie gehen durch mein ganzes Schutzsystem direkt hindurch.
Das sind Kinder, die stark traumatisiert sind. Die kleinste Kleinigkeit kann dazu führen, dass sie in Panik geraten. Es kann eine Tür sein, die schnell zugemacht wird. Es kann das Klimpern von Metallinstrumenten der Krankenschwestern sein. Wenn ein verbleibendes Elternteil nur kurz auf die Toilette geht, geraten die Kinder sofort in große Panik. Sie schreien, als wären sie wieder in Todesgefahr. Es ist laut. Es ist intensiv. Es ist durchdringend, als würde das ganze Leid Gazas in dieser einen Kinderstimme zusammenfließen. Ihnen zu helfen ist in diesem Augenblick nicht leicht. Sie schauen durch mich hindurch, brauchen sehr lange Zeit, um sich zu beruhigen.“

Warum ist es so wichtig, dass wir ihre Geschichten weitertragen?
„Ich kann nicht darüber reden, ohne dass mir die Tränen kommen. Wenn ich es irgendwie vermitteln kann, das extreme Leid, das diesen Kindern angetan wird, und den immensen Schaden, den man ihnen zufügt, dann ist natürlich meine Hoffnung, dass es eine Form von Empathie weckt. Dass irgendjemand endlich sagt: Das geht nicht mehr! Wir müssen das hier stoppen! Das haben die Kinder in Gaza verdient. Das haben alle Menschen verdient.
Es betrifft natürlich jeden Krieg, aber anders ist hier, dass die gesamte Gesellschaft in Gaza komplett zerstört ist. Es gibt keine Person im Gazastreifen mehr, die nicht Familienmitglieder verloren hat, das Haus verloren hat, den Job verloren hat oder das Gefühl der Sicherheit verloren hat. Sie müssen mit der extremen Todesangst leben. Jeden Tag.
„Ich habe den Klang des Krieges gehört. Nicht in Form von Bombenexplosionen, sondern als schmerzhafte Angstschreie traumatisierter Kinder. Schreie, die so durchdringend sind, dass sie den gesamten Schmerz Gazas verkörpern.“
Katrin Glatz Brubakk, Tagebuch aus Gaza
Sie hatten einen guten Monat Waffenstillstand. Je länger er dauerte, desto mehr wuchs die Hoffnung auf ein Ende. Heute haben sie kaum noch Hoffnung, dass sie überleben. Sie sind total erschöpft. Sie wissen nicht mehr, woher sie die Kraft nehmen sollen, um weiter zu machen. Sie machen sich sehr große Sorgen um ihre Kinder. Und sie flehen uns an, alles zu tun, um das zu beenden. Wir müssen die Hoffnung jetzt repräsentieren, denn in Gaza gibt es nicht mehr viel.“
Jedes Kind ist betroffen
Im Tagebuch aus Gaza schreibst du: „Echte Trauma-Verarbeitung kann erst beginnen, wenn die Unsicherheit aufhört.“ Es scheint kein Ende in Sicht. Wie viel Trauma hält so ein kleiner Körper aus?
„In vielem sind Kinder resilient. Solange da eine Person ist, die ihnen die Hände reicht, die sie in den Arm nimmt, die irgendeine Form von Geborgenheit geben kann, sodass sie wissen: Jemand ist da, wenn ich schlafe. Aber: Jedes einzelne Kind ist von der Lage betroffen. Schon vor der aktuellen Eskalation war die Situation dramatisch. So zeigt eine Studie von Save the Children: 90 Prozent der Kinder in Gaza wiesen bereits 2021 Trauma-Symptome auf. Man kann sich vorstellen, dass die Zahlen mit der neuen Situation exponentiell gewachsen sind.
Ich freue mich, wenn ich Kinder sehe, die noch spielen können. Im Spielen kann der Körper entspannen. Im Spielen atmet man besser. Im Spiel können Kinder kreativ sein, sich entwickeln und lernen. Spielen ist Wundermittel und Gegenkraft zu den Konsequenzen von Traumata. – Aber in Gaza gibt es immer diese Gleichzeitigkeit.“

Was meinst du mit damit?
„Ich kann an der einen Straßenecke beobachten, wie die Kinder Ball spielen oder sich einen Drachen bauen. Und direkt daneben wühlt ein Kind im Müll auf der Suche nach Essen. Oder sie verbringen den ganzen Tag damit, das Wenige, was sie haben, zu verkaufen, weil die Familie irgendein Einkommen haben muss. Und über allem schwebt immer die Möglichkeit des eigenen Todes.
Das heißt: Auch Kinder in Gaza sind unterschiedlich betroffen. Manche Kinder mussten flüchten, haben ihr Zuhause verloren, aber nicht die Familie. Viele haben die gesamte Familie verloren und sind vollkommen allein. Andere waren sehr nah dran an den Kriegshandlungen und waren zum Beispiel Zeuge davon, wie Menschen verwundet, umgebracht wurden.“
Pausen und Hoffnung
Wie groß ist das Ausmaß der Traumata?
„Das Ausmaß ist extrem. Wenn der Frieden irgendwann kommen sollte, dann fängt die richtige Trauma-Arbeit erst an. Aber es sind eine Million Kinder in Gaza. Es gibt nicht genug Psycholog*innen auf der Welt, besonders nicht solche, die auf Traumatherapie spezialisiert sind. Das heißt, wir müssen sehr kreativ und klug darüber nachdenken, wie wir echte Hilfe leisten können.
Bei traumatisierten Menschen geht es zunächst darum, einen stabilen, strukturierten Alltag aufzubauen. Da ist die Schule, die soziale Unterstützung durch das Umfeld, Eltern, die an schlechten Tagen trösten oder bei einer Panikattacke reagieren können. Aber in Gaza ist alles ganz anders. Es gibt keine Schulen. Es gibt keine Nachbarschaften. Die soziale Unterstützung ist abgebrochen, weil die Menschen flüchten mussten, aber auch, weil alle traumatisiert sind, die Eltern, die Lehrer*innen. Viele, die normalerweise unterstützen, sind nicht da.
Ich glaube tatsächlich, wir müssen unsere Traumatheorie-Fachbücher um ein paar neue Kapitel ergänzen. Eine solche Tragweite – die Zerstörung und Traumatisierung einer ganzen Gesellschaft – kennen wir bisher nicht.“
Wir haben ein Interview über deine Arbeit in Moria gemacht. Du hast damals verschiedene Verhaltensmuster bei den Kindern definiert, von „Ausagieren“ bis „Rückzug“. Findest du diese Kategorien auch in Gaza wieder?
„Ja, absolut. Das Muster gibt es in Gaza auch. Aber es ist die Extremversion, weil die Kinder unter so akuter Belastung stehen. Die Kinder in Moria waren aus dem Krieg in Syrien geflüchtet oder haben Terroranschläge in Afghanistan miterlebt. Die Erlebnisse sind also ganz ähnlich, nur sind sie zeitverschoben. In Moria war es drei Monate oder zwei Jahre her.
In Gaza passierte es gestern. Oder heute. Dazu kommt, dass sie noch immer in Lebensgefahr sind. Die Kategorien stimmen immer noch, aber es sind sehr viel mehr Kinder, die in der Extremkategorie sind, als woanders.“
Welche Werkzeuge und Maßnahmen helfen den Kindern? Was hast du immer dabei, wenn du zu ihnen gehst?
„Seifenblasen habe ich immer dabei. Seifenblasen sind… fast magisch. Sie haben eine beruhigende Wirkung. Sie fallen ganz langsam, sie haben wunderschöne Farben. Sie geben den Kindern eine Pause.
Wenn wir im Stress sind, atmen wir immer sehr weit oben. Bei Kindern Atemübungen zu machen, ist nicht leicht. Aber wenn man sehr große Seifenblasen machen will, muss man erst mal richtig tief einatmen. Wenn man schnell atmet, kommen keine richtigen Blasen. Und so kann man Kinder spielerisch dazu bringen, richtig zu atmen und dadurch kurz zu entspannen. Wir wissen: Jede einzelne Pause, auch wenn sie kurz ist, ist wertvoll. Auch weil Pausen verhindern können, dass der Stresszustand chronisch wird.

Wenn ich mit meinen Seifenblasen zu einem apathischen Kind komme und sage: Wie schnell kannst du die Seifenblasen zerplatzen lassen? Dann kann ich das apathische Kind aktivieren. Während ich ein sehr aktives Kind frage: Kannst du mir sagen, wie viele Farben du jetzt siehst? – Sodass sich dieses sehr aktive Kind beruhigen und konzentrieren kann. Auf diese Weise können wir verschiedenen Kindern helfen, ihre Gefühle zu regulieren.“
Sind diese Pausen das wichtigste Therapieziel, das ihr im Rahmen der Möglichkeiten in Gaza erreichen könnt?
„Optimal wäre eine richtige Traumatherapie. Aber wie du sagst: Diese Möglichkeit haben wir in Gaza nicht. Grob gesagt ist das Ziel wirklich, der Entwicklung zur Chronizität vorzubeugen. Aber auch: Hoffnung zu geben. Hoffnung darauf, dass es doch Menschlichkeit gibt auf dieser Welt. Denn wann man so lange so schlimme Erfahrungen macht, fragen sich Kinder – auch schon drei- oder vierjährige: ,Warum wollen sie uns töten?‘ Oder: ,Was hab ich falsch gemacht?‘ Diese Fragen habe ich öfter gehört.
Die Kinder sollen erleben, dass es Menschen gibt, die ihnen Gutes wollen. Dass es Humanität und Lachen gibt auf der Welt, obwohl alles dunkel erscheint. Pausen und Hoffnung – das ist vielleicht das Allerwichtigste, was wir den Kindern geben können.
Für die sehr kranken Kinder ist es wichtig, ihre Vitalität wieder hervorzuholen, damit sie nicht in dieser Apathie steckenbleiben. Das gilt auch für die panischen Kinder. Denn sie verbrauchen ihre ganze Entwicklungskraft durch die ständige Vorsicht und Wachsamkeit.“
Gibt es eine Gesprächssituation oder eine Begegnung, an die du immer wieder denken musst?
„Eine Mutter, die ich getroffen habe. Sie hat – wie ich – zwei Kinder. Sie will das Beste für sie – wie ich. Sie träumt davon, dass sie eines Tages eine gute Ausbildung machen können – wie ich. Das alles verbindet uns.
Doch dann sagte sie etwas, das mir bis heute nachgeht: ,Ich weiß nicht mehr, wohin ich noch flüchten soll. Wir haben schon so oft alles zusammengepackt, sind immer wieder losgezogen auf der Suche nach einem sicheren Ort. Jetzt hoffe ich nur noch eins. Dass wir gemeinsam sterben. Damit meine Kinder nicht ohne Eltern sind.‘
Wenn man sich klarmacht, wie groß die Verzweiflung sein muss, wenn ein Mensch so etwas sagt: dass der größte Wunsch nur noch ist, mit den eigenen Kindern zu sterben, um ihnen das Alleinsein zu ersparen – dann versteht man: Dieser Mensch hat schon fast alles verloren.“

Du hast in einigen deiner Beiträge und Texte den Begriff ‚Privilegienscham‘ verwendet. Was verstehst du darunter, Katrin?
„Für mich wird Privilegienscham immer am deutlichsten, wenn ich nach Hause fahre. Es ist, als würde sich die gesamte Ungerechtigkeit der Welt an diesem Punkt in Gaza versammeln. Ich habe das Privileg, dort arbeiten zu dürfen, das macht sehr viel Sinn. Aber ich habe auch das Privileg, nach Hause zu fahren, wenn es zu gefährlich wird, oder ich bin nur eine begrenzte Periode da. Ich weiß, dass meine Kinder in Sicherheit sind. Ich weiß, ich fahre nach Hause. Nicht nur in ein Haus, das steht, sondern in dem sämtliche Erinnerungen meines Lebens gebündelt sind. Ich weiß, dass ich ins Bett gehen kann, ohne zu befürchten, dass in der Nacht gebombt wird oder ich nicht mehr aufwache. Meine Kolleg*innen träumen nur davon. Alle Menschen aus Gaza träumen nur davon. Nur per Zufall bin ich von einer deutschen Mutter und einem norwegischen Vater geboren worden, hier in einem Land, in dem alles friedlich ist. Ich habe nichts gemacht, um es ,zu verdienen’. Ich bin nicht anders als jeder andere Mensch. Trotzdem sind unsere Privilegien, unsere Möglichkeiten, so unterschiedlich. Da kommt diese Scham hoch.
Viele meiner Kolleg*innen haben zu mir gesagt: ,Wir freuen uns so für dich, dass du zurück zu deiner Familie kannst, dass alle noch am Leben sind, dass du deine Kinder wiedersiehst.‘ Es ist so verdammt ungerecht. Denn sie können nicht zurück. Nirgendwohin.“
Was möchtest du bestenfalls mit dem „Tagebuch aus Gaza“ erreichen?
„Ich versuche, den Kindern und meinen Kolleg*innen schreibend nah zu kommen. Weniger spreche ich von der Zerstörung, den kaputten Häusern, denn: Das sind die Schlagzeilen.
Ich gehe vom Menschen, von der Menschlichkeit aus. Ich habe versucht, das Buch so zu schreiben, dass es Verständnis und Empathie weckt. Ich möchte eine humanistische Annäherung schaffen, die dazu führt, dass wir alle uns auch engagieren, dass wir aufstehen, etwas tun, damit sich die Situation endlich ändert. Das ist meine Hoffnung.“

Ärzte ohne Grenzen
Ärzte ohne Grenzen sind vor Ort in Gaza und in anderen Kriegs- und Krisengebieten. Sie leisten medizinische Nothilfe, wo Kinder und Familien alles verloren haben. Ihre Arbeit ist lebenswichtig – aber sie braucht Unterstützung.