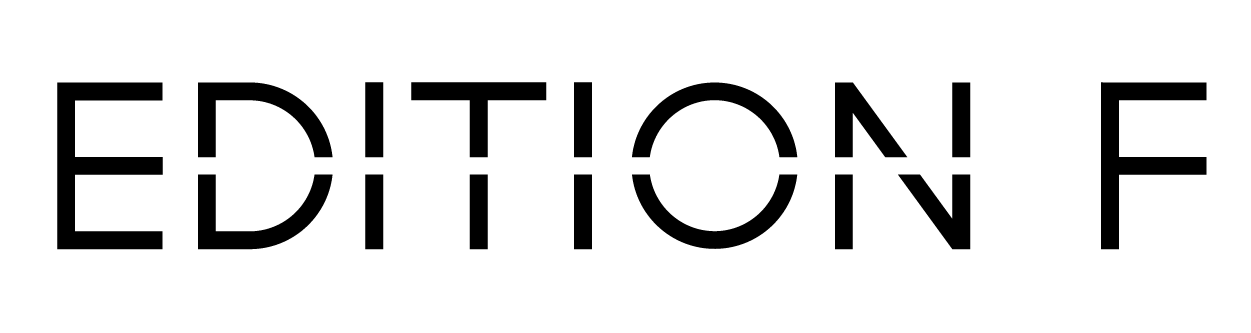Während körperliche Check-ups für uns Routine sind, bleibt die Psyche vernachlässigt. Warum sind Therapien tabuisiert und schwer zugänglich? Unsere Autorin Fiona Rohde gibt einen Einblick in den stillen Kampf gegen innere Dämonen und die gesellschaftlichen Hürden offener Gespräche über psychische Gesundheit.
Der Tag der Entlassung ist da. Die Kliniktasche gepackt, warte ich mit meiner Zimmernachbarin auf den Besuch der Psychologin. Dieser Termin ist Teil einer längeren Liste, die nach der Operation vorgesehen ist. Wir sitzen auf unseren bereits abgezogenen Betten. Die Psychologin schaut erst meine Bettnachbarin an – dann mich. „Wie geht es Ihnen jetzt damit, Frau Rohde?“ Ich bekomme keinen Ton raus. Solche Sätze triggern mich. Ich kann damit nicht umgehen. Das sagte ich ihr. Wir verschieben unser Gespräch. Sie drückt uns zwei kleine, gelbe Zettel in die Hand, auf die sie fein säuberlich ihren Namen und ihre Telefonnummer notiert hat, und verlässt den Raum.
Das alles ist länger her. Den gelben Zettel habe ich seitdem nicht mehr hervorgeholt. Mit dem Verlassen der Klinik bin ich eingetaucht in das – wie man es nennt – normale Leben. Der Alltag hat mich wieder. Eine psychologische Betreuung hat darin keinen Platz. Die Wunde der Operation ist längst verheilt. Zurückgeblieben ist eine längliche, blassrote Narbe. Die Narben in meiner Psyche beachte ich hingegen kaum. Ganz so, als ob Narbensalbe und Silikonpflaster auch hier gewirkt hätten.
Als ich damals nach der OP aus der Klinik entlassen wurde, war ich irritiert, weil sich das für einen Moment seltsam anfühlte. Tagelang hatte ich darauf gewartet, endlich heimzukönnen. Endlich raus. Und dann, als der Moment da war, schien ich irgendwie zu zögern. So als müsste ich mich noch sammeln, für das „Draußen“. Es war ein wenig so, als würde ich einen schützenden Kokon verlassen.
Diese Schwäche, die ich damals gespürt habe, ignoriere ich mittlerweile wieder gekonnt routiniert. Zwar bin ich in regelmäßigen Abständen bei Ärzt*innen, die immer wieder freundlich nachfragen, ob ich nicht doch das Angebot einer psychologischen Betreuung nutzen möchte. Das Angebot stehe. Und immer ist der Impuls gleich: Nein, Danke. Ich komme gut klar. Aber tue ich das?
Augen-Check, Zahn-Check, Haut-Check. All diese Vorsorgetermine stehen auf einer Liste, die wir Jahr für Jahr brav abarbeiten. Aber so gut wie nie steht da ein Termin für unsere Psyche. Geschweige denn ein Vorsorgetermin. Selbst wenn es ihn gäbe, würde er nicht auf der Liste erscheinen. Einfach, weil wir nie gelernt haben, unserer Psyche die gleiche Aufmerksamkeit wie unserem Körper zu schenken.
„Der Freund mit der Panikattacke. Die Freundin mit der Diagnose mittelschwere Depression und die mit der langjährigen Essstörung, die in der Klinik war. Sie alle schweigen. So als sei es eine gesellschaftliche Verpflichtung in diesen Situationen leise zu sein.“
Irgendwie ist das Thema Therapie tabuisiert und kompliziert. Auch im Bekanntenkreis sehe ich ein ähnliches Verhalten. Der Freund mit der Panikattacke. Die Freundin mit der Diagnose mittelschwere Depression und die mit der langjährigen Essstörung, die in der Klinik war. Sie alle schweigen. So als sei es eine gesellschaftliche Verpflichtung in diesen Situationen leise zu sein. Und wir anderen halten brav die Klappe, um sie nicht vor den Kopf zu stoßen mit unseren Fragen.
Letztlich laufen Therapien und Klinikaufenthalte, Panikattacken und Angststörungen in der Regel unter dem Radar. Psychische Probleme werden häufig erstmal verneint. Offenbart sich dann doch jemand, dann meist erst nach längerer Zeit. Und dann sind wir beschämt, dass hier jemand ist, der trotz psychischer Probleme, Ängste und Sorgen lange Zeit alles mit sich allein ausgemacht hat.
„Leider werden psychische Erkrankungen immer noch mit ,Schwäche‘ in Verbindung gebracht.“
Lena Kuhlmann
„Leider werden psychische Erkrankungen immer noch mit ,Schwäche‘ in Verbindung gebracht“, erklärt die Psychotherapeutin Lena Kuhlmann, die ein Buch über die Psyche geschrieben hat.
Vor allem gegenüber Vorgesetzten im Job schweigen viele oft eisern. Vielleicht, weil sie sonst nicht mehr zu den Starken gehören. Vielleicht, weil sie eine Schwachstelle zeigen würden, anstatt zu funktionieren. Und weil das da so wunderbar klappt, mit dem stillen Abschotten, wird dieses Verhalten auch oft auf die anderen sozialen Kontakte übertragen. Auf Freund*innen, auf die Familie.
Dabei sind psychische Erkrankungen keine Seltenheit. Laut Statistiken leiden rund 25 Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben unter Angststörungen. Jeder Dritte in Deutschland ist mindestens einmal in seinemihrem Leben von einer psychischen Krankheit betroffen.
„Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Insgesamt sind 8,2 Prozent, d.h. 5,3 Millionen der erwachsenen Deutschen, im Laufe eines Jahres an einer unipolaren Störung oder anhaltenden depressiven Störung erkrankt. Diese Zahl erhöht sich noch einmal um Kinder, Jugendliche und Menschen über 79 Jahre, die in dieser Studie nicht erfasst sind (…)“, schreibt die Deutsche Depressionshilfe.
Gleichwohl ist die Versorgung mit Therapieplätzen nicht gewährleistet. Für eine Studie wurden die Daten von über 300.000 Versicherten für das Jahr 2019 ausgewertet. Demnach mussten rund 40 Prozent der Patient*innen nach dem Erstgespräch drei bis neun Monate auf einen Therapieplatz warten. Im Schnitt ergab sich eine Wartezeit von 19,9 Wochen, also fast fünf Monate. Und das war vor Corona!
„Warum eine Therapie nicht ebenso Thema sein kann, wie ein entzündeter Blinddarm oder ein Problem mit dem Ischias?“
Wenn man diese Zahlen hört, wundert man sich, warum es immer noch ein Tabu ist, wenn jemand psychische Probleme hat. Warum eine Therapie nicht ebenso Thema sein kann, wie ein entzündeter Blinddarm oder ein Problem mit dem Ischias. Viele stecken fest in diesem Konstrukt des Aushaltens und Weglächelns und werden erst dann aktiv, wenn sie die Krankheit zunehmend im Alltag einschränkt und der Leidensdruck zu stark wird.
Mit der Folge, dass auch kaum jemand über Prävention spricht. Darüber, wie wir vermeiden können, dass unsere Psyche überhaupt erst Schaden nimmt. Stattdessen werden psychische Probleme oft schöngeredet oder verdrängt. Auch ich rede mir ein, dass ich immer alles ohne Hilfe schaffe. Dass ich bis jetzt ganz gut klarkomme. Das gehört zu dem Bild, das ich von mir haben möchte. Aber wann komme ich nicht mehr klar und warum warte ich auf diesen Moment, statt proaktiv zu werden?
Oftmals schätze ich mich stärker ein, als ich tatsächlich bin. Und es ist schwer, selbst zu merken, wann ich diesen einen Punkt überschritten habe. Wenn das, was gerade noch ok war, plötzlich bleischwer wird. Und trotz dieses Wissens muss ich dennoch gestehen: Ich werde den kleinen, gelben Zettel auch in nächster Zeit nicht hervorholen.
DER VOICES NEWSLETTER BY EDITION F
Dieser Text erschien erstmals in unserem Voices Newsletter, für den ihr euch HIER ANMELDEN könnt. Jede Woche teilt darin ein*e EDITION F-Autor*in ihre ganz persönlichen Gedanken zu Themen wie Sex, Gesellschaftspolitik, Vereinbarkeit, Popkultur, Mental Health und Arbeit.
Du hast einen Voices Newsletter verpasst? HIER findest du unsere Voices Beiträge im Magazin.
Mehr bei EDITION F
Mentale Stärke – Hilfe Suchen, wenn man sie braucht
Linda-Marlen Leinweber über Erfolg im Job: „Mentale Stärke ist ein Key-Skill“
Mentale Gesundheit: Ein Privileg der Mittelklasse