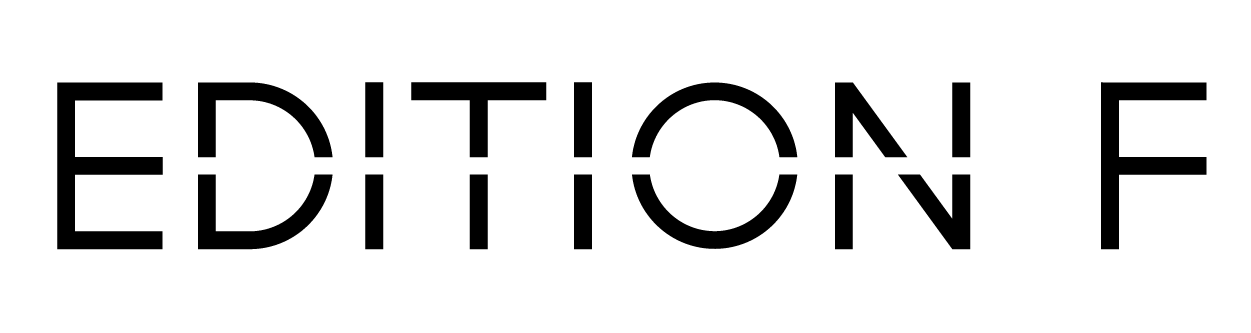Wir haben mit der Sozialpsychologin Pia Lamberty über den fehlenden Faktencheck bei Meta gesprochen. Als Expertin für Verschwörungstheorien und Radikalisierung erklärt sie die Risiken von Desinformation und deren Einfluss auf feministische Arbeit und unsere Demokratie.
Am 21. Januar trat Donald J. Trump, ein mehrfach schuldig gesprochener Sexualstraftäter, erneut das Amt zum Präsidenten der USA an. Auf der anschließenden Party für seine Anhänger*innen hat X-Besitzer Elon Musk den Hitlergruß gezeigt. Und nur wenige Tage später war Musk per Videocall Stargast auf einer AfD-Wahlkampveranstaltung. Zeitgleich zu Donald Trumps Präsidentschaft hat Mark Zuckerberg Anfang 2025 angekündigt, in den USA die Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern bei Instagram und Facebook zu beenden und stattdessen ein System namens „Community Notes“ einzuführen, bei dem Nutzer*innen selbst irreführende Inhalte kennzeichnen können. Zugunsten der Meinungsfreiheit, wie er sagte. All das sind Wahrheiten, die im krassen Gegensatz zu den Fake News und Verschwörungserzählungen stehen, die seit einigen Jahren und heute mehr denn je weltweites politisches Geschehen prägen.
Wieso ist es so wichtig, diese Wahrheiten zu erwähnen?
Obwohl sie nur einen Auszug aus unserer politischen Lebensrealität darstellen, sind die oben genannten Beispiele bezeichnend für eine Welt, die in Zukunft vermutlich „postfaktisches Zeitalter“ genannt wird. Eine Welt jenseits erwiesener Tatsachen, in der einige kleine Gruppe aus Gründern und Vorständen – wie Mark Zuckerberg, Elon Musk und Jeff Bezos, mittlerweile Inhaber der „Washington Post“ -, weitreichende Kontrolle darüber haben, welche Informationen verbreitet werden. Wenn sich Inhaber der weltweit größten Social Media-Plattformen und Online-Unternehmen mit autoritären Staatsoberhäuptern verbünden, hat das drastische Konsequenzen für das Aufrechterhalten einer demokratischen Brandmauer.
Im sogenannten „Superwahljahr“ 2024 fanden weltweit 70 wichtige Wahlen statt. Bei der Europawahl 2024 gaben rund 360 Millionen Wahlberechtigte in 27 EU-Ländern ihre Stimme ab. Konservative und Rechtsaußen-Parteien erzielten dabei massive Gewinne und gehörten damit zu den Wahlsiegern. Ein Zufall? Wer verstehen möchte, wie stark Politik, Geld und Patriarchat miteinander verbunden sind, kommt um die neue „Broligarchy“ nicht herum. Superreiche Oligarchen, die es bis in die erste Reihe des Politik-Zirkus geschafft haben.
Mächtige Männer, die durch ihre Nähe zu Staatsoberhäuptern noch mehr Macht erringen möchten. Wahrheit oder Pflicht? Wäre das Weltgeschehen ein Partyspiel, würden sich die „Broligarchs“ für Letzteres entscheiden. Die Pflicht, dem Feminismus und Klima-Aktivismus, der Einwanderung, Inklusion und LGBTQAI+-Community Einhalt zu gebieten. Sie würden praktisch alles andere tun, als die Wahrheit als das zu benennen, was sie nun mal ist: ein Fakt. Denn die USA stehen nicht, wie Trump es in seiner Antrittsrede behauptete, vor dem Abgrund. Kriminalität, illegale Einwanderung und Inflation gingen erwiesenermaßen in den letzten Jahren zurück.
Alles nur ein Problem der USA? Nein!
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl kursieren auch in Deutschland viele Falschbehauptungen zu Politiker*innen und Parteien im Netz. Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, fragte kürzlich auf der Plattform X: „Ist das echt?“ und bezog sich auf ein Wahlplakat der AfD, in das angeblich bewusst SS-Symbole eingebaut wurden. Es stellte sich heraus, dass es das Plakat gibt – aber die SS-Runen nicht. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass wir uns nicht vor der Verbreitung von Fake News schützen können.
Doch was bedeutet Metas Umgang mit Fake News für unseren Alltag in den Sozialen Medien? Um eine realistische und professionelle Einschätzung rund um den fehlenden Faktencheck in den USA, die europäische Brandmauer und die Gefahr für Vielfalt und Demokratie zu erhalten, haben wir mit Pia Lamberty gesprochen.
Pia ist eine deutsche Sozialpsychologin, die zu Verschwörungsideologien forscht und Antworten auf die Frage hat, wie sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch Verschwörungserzählungen radikalisieren. Pia ist außerdem Mitgründerin und Geschäftsführerin des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), das sich mit der Analyse von Desinformation und Extremismus beschäftigt.
Sind Menschen, die sich in ihrem Alltag mit aktivistischen Themen wie Diversität, Inklusion und Feminismus auseinandersetzen, zu hysterisch, was den seit Anfang dieses Jahres in den USA gestoppten Faktencheck bei Meta angeht? Welche Auswirkungen können wir mittelfristig und kurzfristig erwarten?
„Wenn ich mir aktuelle Debatten angucke, fällt mir auf, dass man sich oft an Symboliken abarbeitet und es kaum tiefgründig wird. Wenn ich Elon Musk sehe, der den Arm hebt, dann denke ich mir, dass man darüber sprechen muss. Ich möchte das nicht unter den Teppich kehren oder relativieren. Noch viel gefährlicher als der gehobene Arm ist die Ideologie, die dahintersteht. Ich würde mir daher generell wünschen, dass wir als Gesellschaft tiefer in die Analyse der Gefahren gehen und über die Empörung hinauswachsen.
Die Bedrohung ist mittlerweile so groß, dass wir uns die pure Empörung nicht mehr leisten können. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich diese Entwicklungen auf Deutschland oder Europa auswirken, denn Meta hat mit der EU kein spezielles Abkommen geschlossen. Durch die massive Kritik von der EU hat Meta aber erklärt, dass es keine unmittelbaren Pläne gibt, die Faktenprüfung durch Dritte in der EU abzuschaffen. Ich bewerte das aber eher als Symbol oder Signal, das gesendet wurde. Denn faktisch wenden sie (Anm.d.Red. die Entscheider aus Silicon Valley) sich Donald Trump zu und passen sich aus ökonomischem Interesse seinen Regelungen an. Es war vorher vieles mit Faktencheck problematisch und jetzt wird es vor allem in den USA immer schlimmer. Dass dort alle Regelungen zurückgefahren wurden, die Falschnachrichten unterbinden können, und sich dadurch auch bei uns immer mehr Hass und Hetze auf diesen Plattformen breitmachen wird, finde ich schon besorgniserregend.“
INFO-BOX
Meta, das Unternehmen hinter Facebook und Instagram, hat kein spezifisches Abkommen mit der Europäischen Union (EU) bezüglich Faktenchecks. Allerdings unterliegt Meta den Regelungen des Digital Services Act (DSA) der EU, der große Online-Plattformen verpflichtet, systemische Risiken wie Desinformation zu minimieren. Dies kann durch Maßnahmen wie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfer*innen erfolgen.
Marginalisierte Gruppen sind ein guter Seismograf für bedenkliche Entwicklungen, weil sie Hass und Hetze zu spüren bekommen, bevor es die Mehrheitsgesellschaft merkt. Nun haben es rechtskonservative Politiker wie Donald Trump trotz eines damals aktiven Faktenchecks an die Spitze der Macht geschafft. Wie abhängig sind wir als Gesellschaft eigentlich noch von der Wahrheit, wenn sie als moralisches Barometer kaum noch eine Rolle spielt?
„Grundsätzlich finde ich es immer schwierig, Ära- oder Epochenaussagen zu treffen, weil wir oft gar nicht so gute Daten haben. War es vor 20 Jahren so, dass die Wahrheit als ein hohes Gut gehandelt wurde? Oder hat man damals nicht auch gelogen, dass sich die Balken biegen? Trotzdem würde ich sagen, dass gerade durch Donald Trump die Lüge zum politischen Instrument wurde, mit dem auch gefühlte Wahrheiten eine größere Rolle spielen als noch vor 20 Jahren.
Was man aber schon quantifizieren kann, ist, dass wir global eine Zunahme von rechtsextremen, faschistischen oder populistischen Akteuren haben und dass sich die Welt gerade hin zu autoritäreren Strukturen verschiebt. Das ist in Ländern wie Russland der Fall, aber auch im Westen. Das ist nichts, was ein Faktencheck lösen kann. Ich würde auch sagen, dass Minoritäten Tendenzen und Strömungen früher mitbekommen. Ich glaube, dass man klar benennen muss, was da gerade passiert. Wenn ich mir die Geschichte der Welt angucke, hatten wir ja immer freiere und unfreiere Phasen und ich sehe, dass wir gerade in eine unfreiere steuern. Bei vielen kommt das aber nicht an, sie stecken eher den Kopf in den Sand und wollen nicht sehen, was sich da zusammenbraut.“
Wie lange kann so eine Brandmauer, die wir in der EU noch aufrechterhalten, stehen? Wie lange dauert es noch, bis sich Unternehmen wie Meta und Elon Musks X durchsetzen?
„Die Frage ist doch, ob sie das nicht jetzt schon tun. Wir sind in meinen Augen bereits an einem Punkt, an dem ich mich frage, was diese gravierenden Änderungen auch für unsere Arbeit und Medienbildung gegen Desinformation bedeutet, wenn es gleichzeitig Plattformen gibt, die die Kommunikation verweigern und ihre Maßnahmen immer mehr einstellen. Und sind unsere Tools überhaupt die richtigen für die aktuelle Bedrohungslage. Was das angeht, glaube ich, dass Demokratien häufig schlechter aufgestellt sind.
Generell halten sich Antidemokrat*innen nicht an Spielregeln, an die sich Demokrat*innen im besten Fall halten. Allein, wenn ich mir Demokratieprojekte angucke, die nur kurzfristig gefördert sind und im Gegenzug dazu langfristige Pläne von den Feinden der Freiheit. Wie lange sich die EU dagegen noch behaupten kann und wie das weitergehen wird – ich bin mir nicht sicher. Vor allem auch, weil das Thema „Fake News“ immer wieder instrumentalisiert wird und wir sehen, wie es auch in Europa überall bricht. Das heißt nicht, dass übermorgen der Faschismus da ist, aber …“
… aber er ist schon gefährlich nah. Man kann schon die Silhouette im Horizont erkennen.
„Genau. Es gibt aus der Klimawissenschaft die Theorie der Kipppunkte, und die wurde von Wissenschaftler*innen auf soziale Faktoren übertragen. Ich war mir oder bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich diese Adaption gutheiße, weil Gesellschaften nicht so verlaufen wie biologische Phänomene oder Klimawissenschaften. Was wir aber beobachten, sind Kaskadeneffekte (Anm.d.Red.: Ein Kaskadeneffekt ist eine unvorhergesehene Ereigniskette, die auftritt, wenn ein Ereignis in einem System negative Auswirkungen auf andere, damit verbundene Systeme hat), dass Dinge gerade so schnell passieren und das für viele Menschen enorm belastend ist.
Wir haben, was die Aufnahme von Informationen betrifft, keine Ruhepausen mehr, es kommt permanent etwas Neues hinzu, das uns aufwühlt. An einem Tag geht es um Grönland und Kanada, dann sind auf einmal nordkoreanische Soldaten in der Ukraine – es passiert gerade enorm viel, sehr schnell und das finde ich im Kontext der Fake News erschreckend.“
Fake News verbreiten sich seit vielen Jahren nicht nur durch Nachrichten in den Sozialen Medien, sondern auch in den Kommentarspalten. Gibt es überhaupt ein Anrecht auf diese Art der Kommunikation? Oder wäre eine schnelle Maßnahme gegen Desinformation, Hass und Hetze erst mal, die Kommentarfunktion zu deaktivieren?
„Es sind auch ganz viele gute Sachen durch die Möglichkeit entstanden, dass wir Dinge kommentieren können. Wie eine Art Verschiebung von Autorschaft, durch die mehr Menschen (wichtige) Botschaften senden können. Sie hat auch dazu geführt, dass sich marginalisierte Personen Raum erkämpfen konnten. Wie ein fünfzehnjähriger, schwuler Junge vom Dorf, der nicht mehr allein zu Hause sitzt, sondern sich mit anderen austauschen kann. Ob das jetzt in den Kommentarspalten immer so gut funktioniert, ist natürlich eine andere Frage.
Bei der Beantwortung dieser Frage setzt sich die Psychologin in mir durch, die überzeugt davon ist, dass Verbote immer der letzte Schritt sein sollten, weil sie auch zu Reaktanz (Anm. Redaktion: Reaktanz ist ein psychologisches Phänomen, das auftritt, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Freiheit oder Autonomie eingeschränkt wird. In der Folge bildet sich ein innerer Widerstand mit dem Ziel, den subjektiven Freiheitsverlust wiederherzustellen) führen können. Wenn Räume dieser Art verboten werden, kann das dazu führen, dass sich Menschen in noch radikalere Räume begeben, die man noch schlechter beobachten kann.“
Wir müssen leider davon ausgehen, dass sich auch in Europa Falschinformationen immer flächendeckender durch die Sozialen Medien verbreiten. Brauchen wir deiner Meinung nach vielleicht einen viel „radikaleren“ Richtungswechsel in der Art, wie wir Informationen senden und aufnehmen?
„Ich hoffe ganz ehrlich, dass Soziale Medien, wie wir sie jetzt kennen, nur eine Phase sind. Das ist bereits in der Vergangenheit passiert: Studi VZ und Myspace gibt es nicht mehr, zum Beispiel. Auch in diesem Bereich gab und gibt es Wandel. Die Frage ist, ob es langfristig so sein wird, dass junge Menschen alles teilen wollen oder ob die Tendenz nicht in Richtung Privatsphäre gehen wird? Ist das vielleicht etwas, das wir als Wert fördern sollte?
Anstatt über Verbote nachzudenken, mit jungen Menschen über Privatheit und Privatsphäre zu sprechen und zu überlegen, in welchen Räumen man sich ausprobieren und auch doofe Sachen sagen darf. Wir alle sagen mal doofes Zeug, vor allem, wenn wir jung sind. Natürlich sind Kommentarspalten für alle Plattformen ein angenehmes Werkzeug, weil sie zu Diskussionen und vor allem Gegenrede anregen und User*innen dadurch viel länger im jeweiligen Medium verweilen. In manchen Punkten macht ein Verbot oder eine Einschränkung des Kommentierens sicherlich Sinn. Aber generell wünsche ich mir, dass wir uns mehr rausziehen, anstatt immer weiter reinzugehen.“
Wie abhängig ist der Feminismus von der Wahrheit?
„Für die Gleichberechtigung von Frauen und FLINTA-Personen, ein progressives Werteverständnis und die Verbesserung von Lebensbedingungen für diese Gruppen, können wir auf die Wahrheit nicht verzichten. Wir brauchen einen realistischen Blick auf die Welt, um Missstände zu benennen, Veränderung voranzutreiben und zu wissen, wo unsere Herausforderungen liegen. Dieser Realismus wird aktuell durch rechtsextreme Akteure und ihre Verzerrung von Fakten stark angegriffen, was sich sofort negativ auf den Alltag von FLINTA-Personen auswirkt.
Wenn queere Menschen zum Beispiel während politisch aufgeladener Debatten in den Fokus geraten und Hass, Hetze und Verschwörungserzählungen über sie verbreiten werden, dann macht natürlich etwas mit den ihnen. Wir beobachten aktuell, dass sich FLINTA-Personen und queere Menschen aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, weil sie Angst haben und sich davor fürchten, wie es weitergeht.“