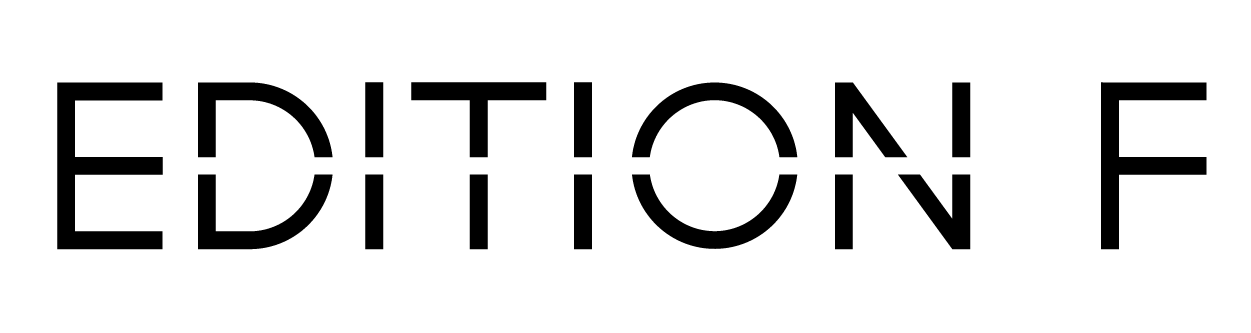Sterben gehört zum Leben – und doch fällt es uns oft schwer, darüber zu sprechen. Bei faarwel in Hamburg ist das anders. Hier gestalten Julia Kreuch und Renske Steen Abschiede, die so individuell sind wie die Menschen selbst: herzlich, ehrlich, ungekünstelt. In unserem Interview erzählen sie, warum sie Bestatterinnen wurden, welche neuen Wege sie in der Trauerbegleitung gehen und wieso Frauen in der Trauer auch ihren Feminismus entdecken.
CN: Im folgenden Text geht es um die Themen Tod und Trauer, einschließlich des Verlusts von Kindern und Babys. Bitte sei achtsam, wenn diese Inhalte dich emotional belasten könnten.
Mit „faarwel“ habt ihr einen Ort für Trauernde geschaffen, der so ganz anders ist als die oft geschmacklos dekorierten Fensterfronten von Bestattungshäusern. Wie seid ihr zu diesem Beruf, oder besser gesagt der Berufung gekommen?
Renske Steen: „Wir sind beide Quereinsteigerinnen. Ich bin eigentlich studierte Musikwissenschaftlerin und habe Kommunikation und Marketing für Ensembles und Konzerthäuser und Orchester gemacht. Nach sechs oder sieben Jahren fühlte ich aber eine gewisse Leere, weil ich an die Grenzen des Möglichen gestoßen bin und in der Branche nicht mehr glücklich war. Als ich mit meinem zweiten Kind in Elternzeit war, habe ich auf einem der vielen Spaziergänge ein Interview mit einem Bestatter aus Berlin gehört, Eric Wrede. Eric ist einer der bekanntesten Pop-Bestatter in Deutschland, der früher Promoter war und im Bestattungsbereich viel aufgewirbelt und erreicht hat.
Beim Hören dachte ich: Krass, ich glaube, das könnte ich auch machen. Trotzdem habe ich den Gedanken erst mal weggepackt, obwohl er sich nicht wirklich wegpacken ließ: Meine Oma, bei der ich die ersten Jahre meines Lebens aufgewachsen bin, war zwei Jahre vorher gestorben. Und zwar in derselben Nacht, in der meine erste Tochter geboren wurde. Da meine Tochter auch noch einige Woche zu früh geboren wurde, hatte es sich für mich so angefühlt, als ob meine Oma die Tür aufgemacht und gesagt hätte: ‚So, ich muss jetzt gehen, aber komm du mal rein‘.
Durch die Geburt wurde ich nicht in die Planung der Beerdigung einbezogen und hatte keine Zeit, Abschied zu nehmen. Meine Familie war in meiner Heimat Ostfriesland, ich zu dieser Zeit in Berlin, wo ich auf einmal damit beschäftigt war, sieben Wochen zu früh Mutter zu sein. Dann fiel mir das Interview mit Eric Wrede wieder ein und ich fragte mich, warum ich damals aus dem ganzen Bestattungsprozess rausgedrängt wurde. Ich weiß, dass meine Familie keine bösen Absichten hatte, daher mache ich niemandem einen Vorwurf. Nach dieser Erfahrung fing ich an, mich immer mehr mit dem Thema Sterben zu beschäftigen, und mir fiel auf, dass man in dem Bereich noch viel bewegen konnte – vor allem mit dem, was ich gut kann: Geschichten erzählen und Social Media. Weil mein Mann Hamburger ist und es in Berlin nicht mehr ausgehalten hat, sind wir zurück in seine Heimatstadt gezogen.
Während der Corona-Pandemie habe ich mich auf eine Stellenausschreibung eines Bestattungsunternehmens beworben. Ich habe dort natürlich nicht gleich als Bestatterin, sondern als Minijobberin angefangen und sämtliche Hilfsarbeiten gemacht. Nach einiger Zeit, in der ich parallel digitale Kunst für ein Ensemble entwickelt hatte, wurde ich gefragt, ob ich als Bestatterin arbeiten möchte. Dafür bin ich denen auf ewig dankbar. Vor allem, weil ich dort Julia kennengelernt habe, und wir viel machen und ausprobieren durften.“
Und du, Julia? Welchen Weg bist du gegangen?
Julia Kreuch: „Ich habe deutsche Literatur und Geschichte studiert, in Shanghai und Zürich gelebt und bin mit meinem damaligen Mann 2015 nach Hamburg gezogen, wo ich bei Xing im Vertrieb anfing. Während ich in der Weltgeschichte unterwegs war, hat mein Bruder das Gleiche getan und in Mexiko seine heutige Frau Carolina kennengelernt. Ich hatte dann plötzlich eine mexikanische Schwägerin und habe sie ganz doof gefragt: Sag mal, tanzt ihr wirklich auf den Gräbern?“
Der „Dia de los Muertos“!
Julia Kreuch: „Genau, der Tag der Toten. Carolina erzählte mir, dass ihre Mutter an Krebs verstorben ist, als sie erst 14 Jahre alt war, und wie man in Mexiko mit dem Tod umgeht. Ich habe gelernt, dass sie zwar genauso traurig sind wie wir, die Trauer aber schnell in Dankbarkeit übergeht. Die Lebenden umgeben sich immer wieder mit den Toten, sie picknicken auf ihren Gräbern und freuen sich an dem, was ihre verstorbenen Familienmitglieder hinterlassen haben. So fing ich an, mich für das Thema zu interessieren, Zeitungsartikel zu lesen und Podcasts zu hören.
Während Corona kam ich an einen Punkt, an dem ich im Homeoffice saß und mir dachte: Mein aktueller Job ist nicht schlecht. Keine Kinder, keine Waffen, kein Alkohol, kein Tabak, das kann ich mit gutem Gewissen verkaufen. Aber ist es das wirklich? Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie einen verstorbenen Menschen gesehen und wollte das ausprobieren. Durch Glück konnte ich ein Praktikum bei besagtem Eric Wrede ergattern, habe zwei Wochen Urlaub genommen und bin nach Berlin gefahren. Dieses Erlebnis war so einschneidend, dass ich Bestatterin werden wollte und überzeugt davon war, das auch zu können. Die Verstorbenen blieben in ihrer Welt, die kamen nicht in meine Träume und nicht an mein Bett, alles cool also.
Durch einen Tipp fing ich im selben Bestattungsunternehmen wie Renske als Minijobberin an und wollte direkt für alles eingesetzt werden. Nach drei Monaten wurde ich dann (auch) gefragt, ob ich nicht selbst bestatten möchte und war unendlich dankbar. Es war ein absoluter Sprung ins kalte Wasser, weil ich nach vier Wochen die erste Familie in ihrer Trauer begleiten durfte – es hat funktioniert.“
In den letzten zehn Jahren möchten immer mehr junge Menschen, vor allem auch immer mehr Frauen Bestatter*in werden. Laut Statistischem Bundesamt waren es 2013 etwa 390 Auszubildende, jetzt sind es 860 im Jahr. Wie erklärt ihr euch das?
Renske Steen: „Vor allem der Hype um die Serie ,Six Feet Under’ hat viel dazu beigetragen. (Anm.d.Red.: Eine Dramaserie über eine Familie, die ein Bestattungsinstitut führt). Plötzlich konnten sich Menschen vorstellen, als Bestatter*innen zu arbeiten, was einerseits überraschend, aber auch sehr wichtig für den Berufszweig war. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass die meisten Bestatter*innen ihren Job nur machen, weil sie den elterlichen Betrieb fortführen müssen. Nicht, weil sie das wirklich wollen.
Wir waren mal auf einer Messe, wo es unter anderem um die Frage ging, ob Bestatter*innen Social Media brauchen. Wir saßen dort, umgeben von Männern in karierten Kurzarmhemden, die alles plattgeredet haben, was ihnen die Person mit ihrer Social Media-Agentur für Bestattungsunternehmen vorgestellt hat. Und ich dachte mir, ‚ja, ihr alle habt euch das nicht ausgesucht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Entwicklungsmöglichkeiten es in diesem ganzen Feld noch gibt, weil ihr das einfach alle so macht, wie ihr es schon immer gemacht habt‘.
Das ist der Unterschied zu mir und Julia. Wir haben uns für diesen Beruf entschieden, weil wir das Thema weiter nach vorne bringen und moderner machen möchten. Das können sich diese Bestatter nicht vorstellen, weil das nie eine Anforderung an sie war. Wahrscheinlich sind auch deshalb so viele Frauen dabei. Ich habe letztens gelesen, dass inzwischen sogar ein Großteil der Auszubildenden Frauen sind.“
Man hat Frauen wohl über lange Zeit den körperlichen Aufwand des Bestattens nicht zugetraut, heute gibt es dafür viele Hilfsmittel. Dabei ist der größte Anteil eurer Arbeit von der emotionalen und bürokratischen Begleitung der Trauernden geprägt, oder? Wenn ich mir vorstelle, wie bürokratisch Heiraten in Deutschland ist, kann ich nur ahnen, wie viel Papierkram der Tod für uns bereithält …
Renske Steen: „Ja, es ist sehr bürokratisch. Und davon können wir den Trauernden viel abnehmen. Vor allen Dingen glaube ich, dass man sich einer Frau am Telefon ganz anders öffnet, wenn man ihr erzählt, dass der*die Partner*in gestorben ist. Außerdem habe schon zweimal das Kompliment bekommen, dass ich ,so schön gehe’, wenn ich vorne die Urne trage und die Zugehörigen hinter mir laufen. Zweimal waren Menschen froh, dass es kein Mann in einem schlechtsitzenden Anzug war.
Für mich ist die Arbeit mit den Zugehörigen die, die mich immer noch am meisten herausfordert, weil sich traurige Menschen auch sehr, sehr komisch und sehr, sehr irrational verhalten. Ich befinde mich immer noch in einem Prozess der Abgrenzung und arbeite daran, zu verstehen, dass Trauernde schwierig sind, weil sie traurig sind. Nicht, weil ich schwierig bin. Das ist (leider) etwas sehr Weibliches, den Fehler erst mal bei sich zu suchen.“
Wie geht ihr mit euren emotionalen Grenzen um? Zum Beispiel in der Trauerbegleitung eines verstorbenen Kindes.
Julia Kreuch: „Da war der alte Arbeitgeber für mich sehr hilfreich. Dort habe ich schon gelernt, dass es okay ist, nicht nur auf Trauerfeiern Gefühle zu zeigen, sondern auch im Gespräch. Ich weine nicht oft in Gesprächen, vielleicht drei oder viermal in den letzten Jahren. Wenn ich Tränen in den Augen habe, sieht mein Gegenüber aber, dass ich gerührt bin und Anteil nehme. Solche Momente helfen dabei, die Stimmung nicht komisch werden zu lassen. Während meines Praktikums als Bestatterin wurde mir klar, wie gut ich mich abgrenzen kann. Ich habe mich vorher als Emotionsbündel gesehen, meine Eltern nennen mich bis heute Drama Queen.
Wenn ich in meinem Beruf emotional werde, weiß ich, dass dieses Gefühl einen halben Tag anhält und ich mir dann sagen kann: Es ist nicht mein Freund, nicht mein Opa, nicht mein Mann. Es sind nicht meine Verstorbenen. Wenn die Zeit gekommen ist, um meine Leute zu trauern, werde ich traurig sein. Natürlich berühren mich die Schicksale trotzdem, ich zweifle manchmal an der Welt und denke mir ,was für eine Scheiße’. Mich wirft das alles aber nicht aus der Bahn. Das ist eine Gabe, für dich ich kein Coaching gemacht habe. Wenn man diese natürliche Abgrenzung nicht hat, kann man den Job in meinen Augen nicht machen.“

Renske Steen: „Das ist definitiv ein anderer Aspekt als meiner. Abgrenzen von Trauer und empathisch sein, das muss von innen kommen. Fehler nicht auf mich zu beziehen, das kann ich noch lernen.“
Julia Kreuch: „Ich bin aber auch ein absoluter Goldfisch. Selbst wenn ich mit den schlimmsten Sorgen und mit den schlimmsten Vorstellungen ins Bett gehe, schlafe ich sehr gut und wache dann sehr befreit auf. Das ist eine enorm gute Voraussetzung für den Job. Ich habe auch schon Kinder und Babys bestattet und wir haben gefeiert, dass das Baby überhaupt zwei Tage gelebt hat. Das waren sehr intensive Begleitungen, die mich mit den Angehörigen haben weinen lassen. Das waren Menschen, die vor der Bestattung regelmäßig zu uns gekommen sind, um ihr Baby noch mal zu berühren und in den Arm zu nehmen. Diese Möglichkeit zu schaffen, das gibt uns so viel. Dass wir diese Wege ebnen können, ohne dass jemand sagt, ,das darfst du aber nicht!’ oder ,wie könnt ihr nur?.’”
Ich bin so still, weil ich als Mutter ganz schwer Erzählungen über verstorbene Babys aushalte …
Renske Steen: „Mir hilft es sehr, dass ich zwei Kinder habe. Du musst dir vorstellen, dass ich manchmal einer Frau gegenübersitze, die gerade geboren hat. Ich kann daher nachvollziehen, in welchem Zustand ihr Körper ist. Ich fühle in diesem Moment mit ihr, weil mein Fokus nicht auf so sehr auf dem Baby liegt, das nicht mehr da ist. Neben der ganzen Trauer haben vor allem Mütter nach einer Geburt viele andere körperliche Empfindungen. Wenn eine Frau darüber nachdenkt, ob sie auf unserem Stuhl blutet, gebe ich ihr die Sicherheit (oder das Gefühl), dass sie sich darüber wirklich keine Sorgen machen muss.”
Die unbeholfen dekorierten Schaufenster der meisten Bestattungshäuser vermitteln mir persönlich mangelnde Kompetenz in der Frage, welche Gefühle sie vermitteln wollen. Ich würde intuitiv niemals dort Hilfe in der Trauer suchen. Wieso ist der Tod so „geschmacklos“?
Renske Steen: „Der Unbeholfenheit dieser Schaufenster liegt zugrunde, dass diese Bestatter – ich sage jetzt ganz bewusst Bestatter, weil es mehrheitlich Männer sind – keine Idee haben, was sie vermitteln wollen. Weil sie nicht wissen, warum sie diesen Job überhaupt machen. Sie meinen es vielleicht zu wissen, weil sie den Betrieb vom Vater übernommen haben und, seitdem sie 15 sind, im Keller Särge ausgeschlagen haben. Durch die langanhaltende und einseitige Perspektive auf die Branche ist totale Ratlosigkeit entstanden. Auch bei uns in Hamburg gibt es Bestattungsunternehmen, deren Schaufenster sich in dem Jahr, in dem es faarwel gibt, nicht einmal verändert haben. Da hängen dann Sprechblasen, Gardinen und Raffrollos und es sieht aus wie bei einem Raumausstatter.”
Da ich für ein feministisches Online-Magazin arbeite, interessiert mich natürlich, wie feministisch das Sterben und der Tod in euren Augen ist.
Renske Steen: „Ich finde, dass Sterben ein absolut feministischer Akt ist. Wenn man sich vorher gut drum kümmert. Es passiert häufig, dass sich Frauen im Vorsorgegespräch explizit wünschen, dass wir sie versorgen. Dass sie von keinem Mann als tote Person angesehen oder berührt werden.“
Frauen, die unheilbar krank sind und gemeinsam mit euch ihre Beerdigung planen?
Renske Steen: „Genau. Oder eine Frau kommt gezielt zu uns, weil ihre Mutter gestorben ist und wir zwei Frauen sind. Aus einer Familiengeschichte heraus möchte sie nicht, dass ein Mann an der Bestattung beteiligt wird. Weil durch den Vater vielleicht körperlicher und oder psychischer Missbrauch geschehen ist, schlimme Geschichten passiert sind und ein Mann jetzt keine Rolle mehr spielen darf.”
„Sie mich bat, nicht zu lachen, wenn ich sie für
die Beerdigung vorbereite.“
Julia Kreuch: „Manchmal ist Körperlichkeit ganz plump. Denn auch in dieser Situation sagen uns Frauen, dass sie aus welchen Gründen auch immer nicht zufrieden sind mit ihrem Körper. Sie sagen dann: ,Ich schäme mich, ich möchte nicht, dass ein Mann mich sieht. Auch über den Tod hinaus nicht.’ Das ist schon krass, oder?”
Renske Steen: „Du hast doch eine krebskranke Frau im Hospiz besucht, bei der das auch ein Thema war.“
Julia Kreuch: „Sie hatte nur noch eine Brust, die andere wurde ihr abgenommen. Das war für sie so schlimm, dass sie mich bat, nicht zu lachen, wenn ich sie für die Beerdigung vorbereite. Ich fragte sie dann, warum ich denn lachen sollte. Wie tief sitzt diese Scham bei uns (Frauen), wenn man das auch noch laut aussprechen muss?“
In unserer immer noch frauenfeindlichen Gesellschaft sind die Räume, in denen Frauen echte Kontrolle haben, rar. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Frauen allein durch eure Anwesenheit einen Safer Space bietet und auf den letzten Metern ihres Lebensweges die Möglichkeit gebt, elementare Entscheidungen zu treffen …
Renske Steen: „Ich hatte schon sehr häufig mit älteren Frauen zu tun, deren Mann gestorben ist und die sich erst dadurch ermächtigen konnten, Kontrolle zu übernehmen. Vorher, in ihrer Ehe und in ihrem Leben, haben sie diese komplett abgegeben. Die sind dann erstmal sehr verloren und schauen mich hilfesuchend an, wenn es um den Berg an Formalitäten geht, den sie nicht zu überblicken wagen. Das ist ein Moment, in dem wir sie als Frauen an die Hand nehmen und sagen können: Wir schaffen das jetzt und ich zeig dir, wie das geht. Auch da können wir eine Ermächtigung begleiten, die positiv ist. Frauen, die sich das eigene Leben zurückholen, wenn ihr Mann gestorben ist.“
Es gibt diesen Spruch: „Vor Gott sind wir alle gleich“. In der Realität ist zwar der Tod umsonst, das Sterben aber nicht. Beerdigen ist teuer und damit auch ein Klassismus-Thema. Wie seht ihr das?
Julia Kreuch: „Zu uns kann jeder kommen. Wir sind sehr transparent mit unseren Preisen, sie stehen auf unserer Website, was nicht viele machen. Wir versuchen, mit dem Thema so transparent und so offen umzugehen, dass auch Menschen mit Geldproblemen im ersten Gespräch gemeinsam mit uns Lösungen finden können.“
Zum Beispiel Ratenzahlungen?
Julia Kreuch: „Das bieten wir auch an. Oder wir überlegen gemeinsam, wie viel sie selbst machen können? Es hilft schon sehr, dass wir überhaupt über Geld und unsere Preise sprechen. Zu fragen, wo der finanzielle Spielraum liegt und was wir damit machen können. Das machen die meisten Bestatter gar nicht.”
In vielen Religionen und Glaubensrichtungen werden Menschen in einfachen Leichentüchern oder Holzkisten beerdigt. In unserer Kultur kosten Särge je nach Modell mehrere Tausend Euro, hinzu kommen dann Satindecken und sonstige Accessoires. Wie handhabt ihr das?
Renske Steen: „Über diese Seite unseres Unternehmens haben wir uns wirklich sehr viele und genaue Gedanken gemacht. Denn die meisten Bestattungsunternehmen verdienen ihr Geld mit dem Verkauf von Särgen, von Sargmatratzen, von Sterbehemdchen aus Satin und Dingen, die absolut unnötig sind. So was gibt es bei uns nicht. Was man bei uns bezahlt, ist unsere Begleitung. Dass wir dabei sind und Menschen durch den Dschungel navigieren. Dass wir Türen öffnen und dann gemeinsam schauen, durch welche wir gehen möchten.
Wenn das Geld irgendwann aufgebraucht ist, dann sind wir dazu da, zu schauen, wie Zugehörige selbst mitgestalten können. Wir müssen keine Feier für sie ausrichten, können sie aber dabei unterstützen, eine eigene umzusetzen. Manchmal händigen wir auch nur die Urne aus, was in einigen Bundesländern erlaubt ist.“
Julia Kreuch: „Dass wir das überhaupt ansprechen und sagen, dass diese und jene Dinge möglich sind, das wissen die meisten Menschen gar nicht.“
Ich dachte immer, dass man Urnen nur in den USA mit nach Hause nehmen und auf den Kamin stellen darf …
Renske Steen: „In Deutschland darf man eine Urne auch nicht für immer mitnehmen, nur für eine gewisse Zeit. Dieses Gesetz stammt aus der Zeit von Napoleon, der gesagt haben soll, dass jeder Deutsche auf einem deutschen Friedhof beerdigt werden muss. Wieder so ein Mann, der irgendwelche Dinge beschlossen hat. Bei uns darf man eine Urne für eine private Trauerfeier ausleihen, muss sie danach aber zum Bestattungsort bringen. Es gibt viele Möglichkeiten, zu denen wir Türen öffnen, das kostet uns nicht viel. Aber es kostet unsere Gegenüber sehr viel Geld, wenn wir ihnen sonst was verkaufen.
„Ich möchte in Ruhe in meinem Sarg liegen und auch langsam vergehen. Ja, ich vergammle, aber das finde ich nicht schlimm.”
Wir müssen einen Vertrag in einer absolut beschissenen Situation abschließen, in der jemand vollkommen aufgelöst vor uns sitzt, weil eine nahestehende Person gestorben ist. Und dieser Mensch muss jetzt dafür sorgen, dass der oder die Verstorbene unter die Erde kommt – ob sie ihn mochten oder nicht. Weil sie in der Bestattungspflicht sind. Hier auf Sankt Pauli bieten wir auch ein Bestattungspaket an, an dem wir gar nichts mehr verdienen. Wir begleiten dann nicht mehr, sondern sorgen dafür, dass der Mensch – auch anonym – eine würdevolle Bestattung erhält.”
Wie möchtet ihr mal sterben, wenn ihr es euch aussuchen könntet?
Julia Kreuch: „Sterben wollen wir doch eigentlich fast alle gleich, oder? Im hohen Alter ohne Schmerzen zu Hause einschlafen, nicht mehr aufwachen. Dass es vor allem schnell geht.“
Und wie möchtet ihr mal bestattet werden?
Renske Steen: Wir wollen beide gerne ganz im Sarg bestattet werden. Julia hat auch eine schöne Erklärung dafür!“
Julia Kreuch: „Ich bemühe mich ja, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, gut auf der Welt rumzuspazieren und ich kümmere mich dementsprechend auch um meinen Körper. Ich mache Sport, ich schaue auf meine Ernährung. Und dann? Bei einer Einäscherung ist innerhalb von 90 Minuten alles, was ich im besten Fall 94 Jahre lang behütet und betüddelt habe, einfach weg. Alles fort, alles umsonst. Das möchte ich nicht. Ich möchte in Ruhe in meinem Sarg liegen und auch langsam vergehen. Ja, ich vergammle, aber das finde ich nicht schlimm.”
Renske Steen: „Verbrennen hat etwas sehr Gewaltvolles. Ich verstehe, warum das manchmal die richtige Lösung ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Körper hege und pflege, und dann kommt so ein scheiß Krebs oder eine Krankheit – dann ist dein Körper nur noch Feind. Er verändert sich durch diese Krankheit so sehr, dass er nichts mehr mit dem zu tun hat, was du mal warst oder wer du jetzt bist. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn mich so ein Schicksal ereilt.”
Was möchtet ihr Menschen, die sich mit dem Sterben und dem Tod nicht so gut auskennen wie ihr, mit auf den Weg geben?
Renske Steen: „Sprecht drüber, packt das Thema nicht weg. Auch nicht in jungen Jahren, weil ihr meint, unsterblich zu sein. Zumindest mal mit eurem Partner, eurer Partnerin oder einer nahestehenden Person drüber sprechen und klären, ob es eine Patientenverfügung gibt. Was Menschen über das Bestatten wissen sollten, ist, dass so viel mehr möglich ist, als uns über Jahrzehnte eingebläut wurde durch die Industrie. Sprecht mit euren Eltern und drängt sie, wenn es sein muss, in das Gespräch. Man muss natürlich aushalten lernen, dass das Sprechen über den Tod wehtut, dass es traurig ist und man weint. Das ist aber nicht schlimm ist, weil das Leben weitergeht. Es gibt diesen Spruch: ‚Vom Sprechen übers Sterben stirbt man nicht.‘ “
Julia Kreuch: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich mit der eigenen Endlichkeit schon mal beschäftigt haben, nicht so ganz umgehauen und weggeweht werden, wenn sie mit einem Sterbefall konfrontiert werden. Es geht nicht darum, mit diesem Bewusstsein traurig und gebrochen durch die Gegend zu laufen und sich vor der Sterblichkeit zu fürchten. Wir alle sterben einmal und wünschen uns gleichzeitig, dass wir ein langes Leben haben. Menschen mit diesem Wissen können einen Schicksalsschlag besser aushalten.
Wenn die Engsten wissen, was man möchte, braucht man nicht viel Vorsorge. In meinem Fall ist es die Erdbestattung, die mir wichtig ist. Welche Lieder dann gespielt werden und welcher Kuchen gegessen wird, ist mir wurscht. Mir ist wichtig, dass ich in die Erde komme. Ganz oft wissen Eheleute nicht mal voneinander: Erde oder Feuer? Dabei geht es nicht um Feiern oder nicht Feiern, Baum oder Friedhof. Sondern einfach nur: Erde oder Feuer.“